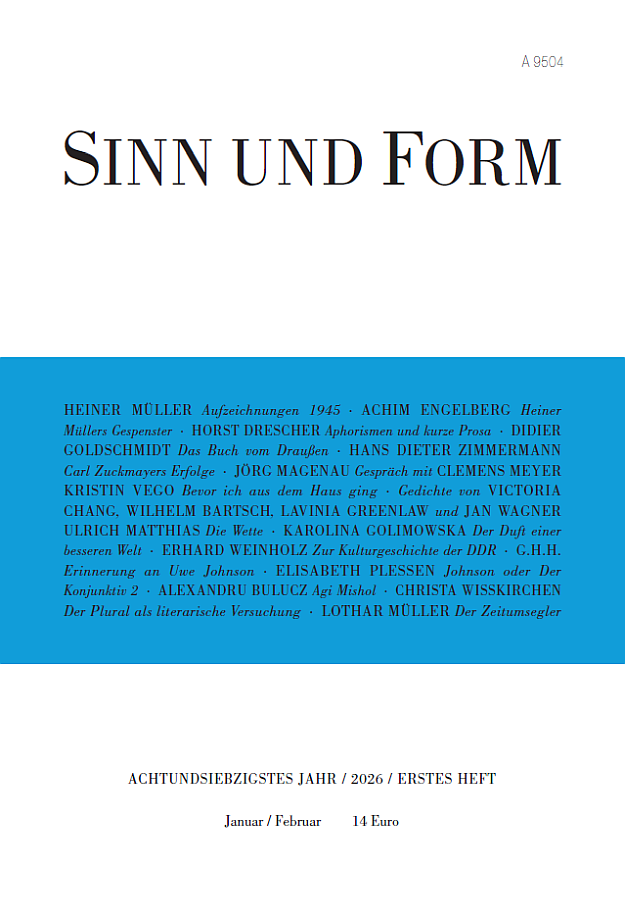
[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-87-4
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2026
Vego, Kristin
Das habe ich geschrieben, bevor ich aus dem Haus ging.
Wer ist der Ich-Erzähler eines Romans?
Ich wurde gebeten, eine kleine Poetikvorlesung zu halten: Ob ich über meine Methode sprechen könne, warum ich beim Schreiben tue, was ich tue. Ich habe bisher zwei Bücher geschrieben, das erste war ein Band Kurzgeschichten. Nach vielen Jahren der Suche nach meiner eigenen Stimme war die Kurzgeschichte mein Tor zum Schreiben. Die begrenzte Form erlaubte es mir herauszufinden, welche Geschichten ich erzählen wollte. Plötzlich bekam ich ein Gespür dafür, wie ich um eine Situation, ein Bild oder eine Stimmung einen kleinen Raum schaffen und etwas in ihm verweilen konnte. Es war beglückend, mittels der neun Geschichten meines Debüts meine eigene Antwort auf die Frage zu finden: Was ist eine Kurzgeschichte?
Als mir nach dem Debüt aufging, daß der neue Text, an dem ich saß, keine Kurzgeschichte werden würde, sah ich mich als Schriftstellerin zum ersten Mal mit der Frage »Was ist ein Roman?« konfrontiert. Die Geschichten des Erzählbands hatte ich in relativ kurzen, konzentrierten Arbeitsphasen komponiert. Angesichts der Fülle des Romanstoffs wurde klar, daß ich ein dynamischeres Verhältnis zur Form brauchte. Das Textmaterial, mit dem ich zu tun hatte, war umfangreicher als gewohnt. Was bedeutete, daß ich länger – mehrere Jahre – in dem wunderbaren, phantastischen, aber auch frustrierenden Schwebezustand leben mußte, in dem der Text sich in alle möglichen Richtungen bewegen kann.
Ich sitze in einem Kinderzimmer in einer kleinen Bettnische, während ich das schreibe. Das Kind, das sonst hier schläft, ist nur jedes zweite Wochenende hier. Meine eigene Tochter – drei Wörter, die laut auszusprechen mir immer noch ein wenig unwirklich vorkommt – liegt nebenan in dem großen Schlafzimmer und schläft. Sie ist drei Monate und elf Tage alt. Sie kann lächeln und nach Sachen greifen. Jeden Abend bringe ich sie um neun ins Bett. Danach bleiben mir etwa drei Stunden zum Arbeiten, bevor ich selbst schlafen muß.
»Spät am Tag« (2024) handelt von Johanne, die mit Anfang dreißig nach einer Scheidung aus der Stadt zieht und ein Zimmer in einem Haus auf dem Land mietet. Sie verliebt sich in Mikael, der in dem Haus lebt, und beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm. Mikael hat eine dreijährige Tochter – und eine Ex-Frau, die dort aus- und eingeht, wie es ihr paßt. All das wird im Rückblick erzählt – das ist die Vergangenheitsebene. Siebzehn Jahre später sitzt Johanne in demselben Haus und schreibt ihre Geschichte auf. Sie ist allein, abgesehen von Miez, der alten Katze, die damals bei Johannes Einzug ein kleines Kätzchen war. Wir spüren, daß Mikael gestorben ist. Es ist Herbst, Tag für Tag wird es ein wenig dunkler und kälter. Das ist die Gegenwartsebene.
Der Roman beruht auf Notizen, die ich machte, als ich ein Jahr lang in einer ganz bestimmten Landschaft – Tjodalyng zwischen Sandefjord und Larvik – verbrachte. Ich wollte den Wandel der Jahreszeiten einfangen, das Licht, die Luft, die Gerüche und Farben, lange, bevor ich wußte, daß ich diese Skizzen einmal in einem Roman verwenden würde. Später kamen die vier Personen – Johanne, Mikael, das Kind und die Ex-Frau – dazu, ich schrieb lose Szenen von Hand, die ich in einem Haus in dieser Landschaft plazierte. Der Roman entsprang einer Art Traurigkeit oder Sehnsucht, einem Zustand, der rückwärtsgewandt und zukunftsgerichtet zugleich war, gemischt mit Begeisterung. Ich vermißte die Landschaft, als ich in Oslo lebte und schrieb, und war bis über die Ohren verliebt in den Mann, der der Vater meiner Tochter werden sollte. Wir heirateten, und ich schrieb einen Roman über eine Frau, die ihren Mann verliert.
»Spät am Tag« handelt nicht von Trauer. Die Handlung schildert die ersten zwei Jahre, die Johanne im Haus verbringt: die Verliebtheit, die Leidenschaft, die Eifersucht. Aber die Trauer zieht sich als Unterton durch die Erzählung. Das liegt daran, daß die Geschichte von einem Punkt in der Zukunft aus erzählt wird und die Stimmung der Erzählerin auf das Erzählte abfärbt. Und an der Tatsache, daß Liebe – das ist jedenfalls meine Erfahrung – auch als vorweggenommene Trauer erlebt werden kann, als Angst vor Verlust. Immer wieder hat die junge Johanne Angst, Mikael könnte sterben. Sie stellt sich vor, wie er vorm Haus im Nebel verschwindet, oder daß eine Horde von Kindern, die aus dem Wald gerannt kommt, ihn überfällt. Das Glück, das Johanne erlebt, hat etwas Zerbrechliches. Diese Doppelheit findet sich auch in den Naturschilderungen. Es gibt Andeutungen auf menschengemachte Umweltzerstörung – eine Autobahn soll gebaut werden, Wälder brennen. Alles, was wir lieben, ist vergänglich.
Der Roman beginnt in der Gegenwart: Johanne muß an Mikael denken, und das setzt einen Erinnerungsprozeß in Gang. Gleichzeitig nimmt sie an sich eine Veränderung wahr: Zum ersten Mal ist sie so weit, daß sie ihre Geschichte erzählen kann. Miez liegt ihr auf dem Schoß, während sie im Dachzimmer sitzt und schreibt. Sie hat auf dem Computer ein neues Dokument angelegt.
Johanne weiß, wie die Geschichte ausgeht. Sie möchte die Vergangenheit noch einmal wiedererleben, sie wie in Bernstein einschließen und bewahren: die Jugend, die Liebe und die Landschaft. Das Schrei ben wird eine Art Gegengift zur Verlustangst. Jedes Kapitel erstreckt sich über einen Tag und endet – mehr oder weniger – damit, daß die Sonne untergeht. Ich mag die konzeptuelle Schlichtheit dieses erzählerischen Kniffs (und ich liebe es, mir immer neue Arten auszudenken, einen Sonnenuntergang zu beschreiben). Die Zeit in der Gegenwartsebene schreitet spürbar voran. Johanne druckt die geschriebenen Seiten aus, sie liegen auf dem Schreibtisch und fühlen sich warm an, wenn sie die Hand auf den Stapel legt. Fast, als hätte jemand anderes sie geschrieben.
Die Erzählerin wird dabei selbst von dem, was sie erzählt, beeinflußt. Im Lauf des Romans söhnt sich Johanne mit etwas aus. Mit dem Verlust von Mikael, vielleicht; damit, keine Kinder zu haben und in die Wechseljahre zu kommen, oder mit dem Gedanken, eines Tages Haus und Landschaft verlassen zu müssen. Sie arbeitet sich durch die Trauer hindurch und schafft es – vielleicht – auf die andere Seite. Der Roman hat ein offenes Ende: Es bleibt ungewiß, ob Johanne die Trauer überwindet oder ob sie sich ihr ganz hingibt und in ihr versinkt. Am Ende steht eine Art Auflösung, in der Traum und Erinnerung miteinander verschmelzen.
Mein Mann steckt den Kopf ins Kinderzimmer und fragt, ob ich etwas brauche. Ich frage ihn, wie das hier bloß eine Poetikvorlesung werden soll. Er meint, wenn er mich recht kenne, werde ich wohl so zu Werk gehen: mir einen Text, den ich liebe, vornehmen und herauszufinden versuchen, warum. Er kennt mich genau. Egal, ob als Rezensentin, als Schreibdozentin oder wenn ich nur für mich lese, ist das die Hauptmotivation. Jedesmal, wenn ich etwas lese, das mir gefällt, das funktioniert, habe ich keine Ruhe, bis ich herausgefunden habe, warum.
Als ich mich daranmachte, meine eigene Antwort auf die Frage »Was ist ein Roman?« zu finden, interessierte ich mich vor allem für eine bestimmte Form: den Ich-Erzähler aus der Rückschau. Ich wußte einfach, daß Johanne ihre Geschichte selbst erzählen mußte. Beim Lesen und Wiederlesen hatte ich gelernt, daß es (mindestens) vier Arten von rückblickenden Erzählern gibt: den sprechenden Ich-Erzähler mit begrenzter Gegenwartsebene; den sprechenden Ich-Erzähler mit erweiterter Gegenwartsebene; den schreibenden Ich-Erzähler mit begrenzter Gegenwartsebene und den schreibenden Ich-Erzähler mit erweiterter Gegenwartsebene.
[…]
Aus dem Norwegischen von Hannes Langendörfer
SINN UND FORM 1/2026, S. 76-84, hier S. 76-78
