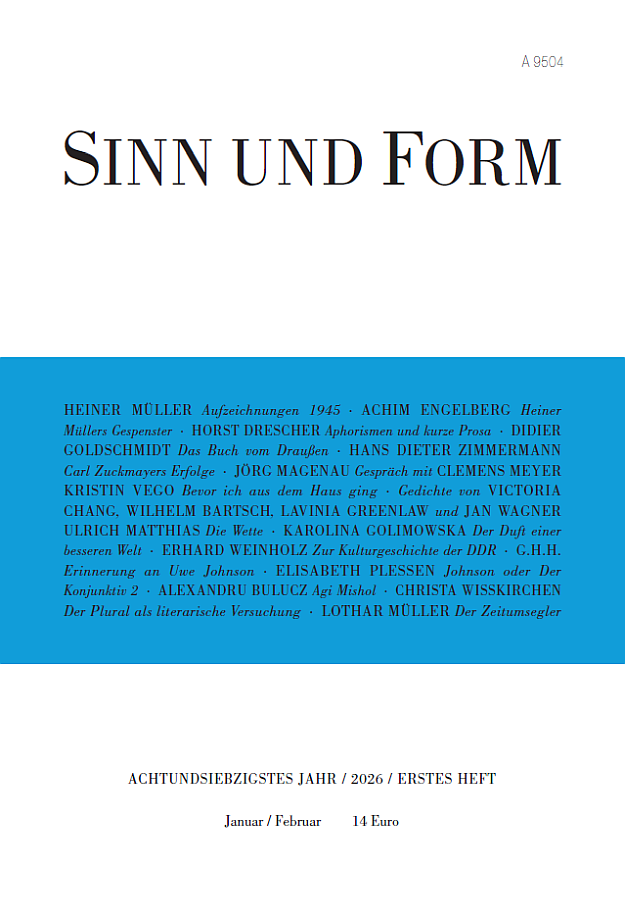
[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-87-4
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2026
Meyer, Clemens
»Die Welt ist ein unruhiger Ort«.
Ein Gespräch mit Jörg Magenau über das Mysterium des Erzählens, das Raubtier Mensch und Bahnhöfe als mythologische Räume
JÖRG MAGENAU: Ihr Roman »Die Projektoren« ist ein Jahrhundertroman, nicht nur deshalb, weil der historische Bogen von 1930 bis 2016 reicht. Er löst ein, was der Vater der Hauptfigur, ein Literaturwissenschaftler, an einer Stelle sagt: »Der moderne Roman ist ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen.« Doch bevor wir über dieses tausendseitige Opus magnum sprechen, würde ich gerne mit Ihnen Ihr bisheriges Werk besichtigen und am Anfang beginnen, bei Ihrem Debüt »Als wir träumten«. Das liegt nun schon fast zwanzig Jahre zurück und hat Sie auf einen Schlag bekanntgemacht. Ein »Roman wie ein Fausthieb« hieß es damals in der Kritik. Es geht um die letzten Jahre der DDR und um die Zeit nach der Wende, um Jugendliche in Leipzig, um Einsamkeit und Außenseitertum, viel Gewalt, Rechtsradikalismus – auch schon in der DDR –, Männerbündelei, Kleinkriminalität, prekäre familiäre Situationen. Diesen Themen sind Sie auch in Ihren Erzählungen und Ihrem zweiten Roman »Im Stein« treu geblieben, der ins Rotlichtmilieu führt und von käuflichem Sex handelt. Sie haben außerdem Poetikvorlesungen veröffentlicht, Essays über Literatur und ein emphatisches Buch über Christa Wolf. Diesen Texten ist zu entnehmen, daß Sie ein leidenschaftlicher Leser waren und sind und daß das Schreiben für Sie mit dem Lesen beginnt. Das fing bei Ihnen früh an, mit dem Bücherregal Ihres Vaters. Was haben Sie da gefunden?
CLEMENS MEYER: Eigentlich alles. Mein Vater war bis zur Rente Krankenpfleger. Das Besondere an so einer Ost-Sozialisation – also nicht meiner eigenen, denn ich bin 1977 geboren, und da war es mit der DDR schon fast vorbei – war dieses vielbesungene »Leseland«. Das gab es tatsächlich. Mein Vater und seine Freunde, Schlosser, Handwerker und auch Krankenpfleger, die lasen. Mein Vater kam aus einer Molkerei-Familie in Pommern, aus Züssow bei Greifswald, und er las wie besessen. In seinem Zimmer standen mehrere Regale mit Büchern, alles durcheinander: Thomas Mann, die großen russischen Realisten, DDR-Literatur, Abenteuerromane, Weltliteratur. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist auch durch ein Foto verbürgt. Darauf bin ich zu sehen, drei oder vier Jahre alt, wie ich die Regale leergeräumt und mit den Büchern einen riesigen Haufen gebildet habe. Da muß etwas gewesen sein, das mich angezogen hat.
MAGENAU: Stand in dieser Bibliothek auch Karl May, der in den »Projektoren« ja von zentraler Bedeutung ist?
MEYER: Mein Vater las keinen Karl May. Eines der ersten Bücher, das ich geschenkt bekam, von einem Onkel mütterlicherseits, war dann aber »Der Ölprinz«. Da habe ich den Fehler gemacht, mir zuvor den Film anzuschauen, der im Kino lief. So merkte ich, daß das ein riesiger Unterschied ist, Film und Literatur. Ich bin natürlich nicht mit Thomas Mann eingestiegen, obwohl mein Vater ein großer Leser von ihm war. Er erzählte immer wieder von den »Buddenbrooks «, auch jetzt im höheren Alter läßt ihn das nicht los. Wobei ich eher »Zauberberg«-Anhänger bin. Angefangen habe ich mit Abenteuerliteratur: Jules Verne und vor allem »Die Schatzinsel« von Stevenson. Da hatte ich das Gefühl, das ist mehr als »nur« Abenteuerliteratur. Und so ging es weiter, bis ich plötzlich, mit Anfang zwanzig, gemerkt habe, oh, ich lese sogenannte Weltliteratur.
MAGENAU: Und dann wurden Sie selber, wie zuvor Ihr Vater, Büchersammler. Sie schreiben in Ihren Poetikvorlesungen über die »Bücherinsel« in Leipzig, ein Antiquariat, in dem Sie Ihren ganzen Verdienst in Bücher umgesetzt haben. Sie wollten also Ihre eigene Bibliothek aufbauen?
MEYER: Meine Eltern haben sich 1989 scheiden lassen. Das war in mehrfacher Hinsicht ein Cut für mich als zwölf-, dreizehnjähriger Junge. Zu meinem Vater hatte ich eine gute Beziehung. Als wir auszogen, schenkte er mir Anfang der Neunziger den Großteil seiner Bibliothek. Ich habe heute noch Bücher, in denen sein Name drinsteht, Heinrich Böll zum Beispiel. Da hat er vorne reingeschrieben »1972 Nobelpreis für Literatur«, und dann mit etwas anderer Handschrift »1985 gestorben«. Diese Bücher habe ich geerbt, dann aber viel dazugekauft und erst später angefangen zu sammeln. Vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel eine Erstausgabe von Kafkas »Das Schloß« erworben. Die hat fünfhundert Euro gekostet, das darf ich gar keinem erzählen. Wahrscheinlich hat Kurt Wolff selbst dieses Buch schon in der Hand gehabt. Aber ich habe auch per Meter gekauft, als es in der »Bücherinsel« Bücher für fünf Mark gab. Da bin ich mit der Reisetasche hin. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Und jetzt entdecke ich diese Bücher. Letztens habe ich Steinbecks »Früchte des Zorns« rausgekramt, schlechtes Papier, fast kaputt, verrottet. Und siehe da, auch das war kein Fehlkauf. Was für ein tolles Buch.
MAGENAU: Anfang der Neunziger haben Sie angefangen, viel zu schreiben. Ging das aus dem Lesen hervor? Wenn man so viele Bücher liest und besitzt, entsteht daraus der Wunsch, das auch selber zu machen? Was war der Impuls, als Sie mit dreizehn zu schreiben begonnen haben?
MEYER: Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich muß schon mit zehn angefangen haben zu schreiben. Ich war zweimal im »Talente«-Wettbewerb. Das fing im Stadtviertel an, und dann wurde man weiterdelegiert. Da habe ich Geschichten geschrieben. Die erste hieß »Die Abenteuer der Ameise Pontifax«, wahrscheinlich motiviert durch die Mäusecomics »Fix und Fax« von Jürgen Kieser in der Jugendzeitschrift »Atze«. Ich bekam das Prädikat »sehr gut«, wurde weitergeleitet, von der Schule zum Bezirk, aber da war dann Schluß. Vermutlich war die Ameise Pontifax zu unideologisch, was mich aber nicht davon abgehalten hat, noch eine Fortsetzung zu schreiben: »Die Rückkehr der Ameise Pontifax«. Mindestens eine dieser Geschichten habe ich aus dem Stegreif vorgetragen. Ich stand auf der Bühne und habe erzählt. Eine andere habe ich abgelesen. So war das am Anfang. Aber ich merkte schnell, daß es mehr wird, daß es einen Drang gab zu schreiben. Damals ist auch ein Indianerroman entstanden, aber den habe ich angezündet auf dem Balkon und in den Hof hinuntergeschmissen. »Starker Wolf« hieß der, taugte aber nichts. Und so ging das weiter, auch mit Gedichten, und dann fing ich an, über einen Bomberpiloten zu schreiben. Da tauchten Sätze auf wie »Ein Regenbogen teilte den Himmel in zwei Hälften«, bei denen ich dachte, ich wäre wirklich gut! Da war ich schon zwölf oder dreizehn und schrieb immer weiter, merkte aber irgendwann: nein, du bist überhaupt nicht gut! Um besser zu werden, mußt du noch mehr lesen und gucken, wie die das machen. Aber mir war klar, daß ich schreiben werde. Ich wollte nie etwas anderes machen.
MAGENAU: Woran merkt man, daß man es wirklich will? Daß es nicht nur eine kindliche Spinnerei ist?
MEYER: Ganz einfach am Gefühl, nichts anderes machen zu können, auch wenn mir schnell klar war, daß ein Brotberuf vonnöten sein würde, weil es damals in der DDR immer hieß, daß man vom Schrei ben nicht leben kann. Meine Mutter sagte mir, daß Schriftsteller kein richtiger Beruf sei, und legte mir nahe, Bibliothekar zu werden. Zur Wendezeit war ich in der siebten Klasse, und wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte ich nach der Schule wahrscheinlich eine Lehre als Bibliothekar gemacht. Ein Studium kam nicht in Frage, weil ich nicht in der Pionierorganisation gewesen bin und meine Eltern in der Kirche waren. Ich wäre auch nicht in die FDJ gegangen. Also hatte ich mich darauf eingestellt, Bibliothekar zu werden, weil ich da mit Büchern zu tun hätte und nebenher weiterschreiben könnte. Davon zu leben, war Zukunftsmusik. Es war bleiern. Aber ich blieb dran, wollte etwas formen und schauen, wie die großen Vorgänger das gemacht hatten, an denen ich mich orientierte. Es war für mich ein Mysterium, wie aus Sätzen Handlung entsteht und aus Szenen eine Erzählung und wie aus ganz vielen Szenen ein Roman wird. Das ist bis heute ein Mysterium.
[…]
SINN UND FORM 1/2026, S. 61-73, hier S. 61-63
