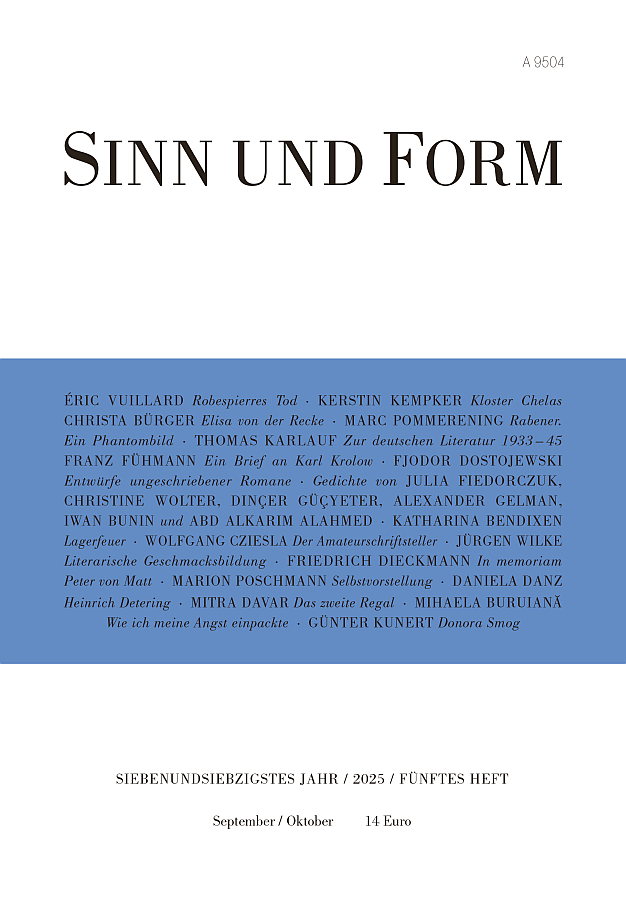
[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-85-0
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2025
Fühmann, Franz
»Kennen Sie Weinheber? Kennen Sie Rußland?«
Ein Brief an Karl Krolow vom 28. Mai 1943 und unveröffentlichte Gedichte
Vorbemerkung
Das erste Schreiben Franz Fühmanns in der 1994 erschienenen Sammlung seiner Briefe ist datiert auf den 30. Januar 1950 und gerichtet an den Dichter und Kulturpolitiker Johannes R. Becher. Da lagen bereits ereignisreiche Jahre hinter ihm, prägend für sein schriftstellerisches Werk bis zum letzten Atemzug: Kindheit im böhmischen Rochlitz an der Iser, mehrjähriger Aufenthalt im Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien, Gymnasialbesuch in Reichenberg, Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Hitlerjugend, 1938 Eintritt in die Reiter-SA, 1941 nach Ablegen der Matura (Abitur) bis Mai 1945 Soldat in der deutschen Wehrmacht mit Einsätzen erst an der Ost-, dann an der Westfront, zuletzt russische Kriegsgefangenschaft und von 1946 bis Ende 1949 Kursteilnahme und Lehrgruppenleitung an den Antifa-Schulen in Noginsk, Rjasan und Ogre. Fühmann war achtundzwanzig Jahre alt und stand am Anfang einer kulturpolitischen Karriere in der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NDPD) sowie einer literarischen in der DDR.
Briefe aus seinem Leben vor 1950 fehlen; sie sind verschollen, möglicherweise in den Kriegs- und Nachkriegswirren verlorengegangen. Nun ist ein Brief aus dem Mai 1943 aufgetaucht. Er fand sich in den Beständen des Dichters Karl Krolow (1915 –1999), die sein Sohn vor einigen Jahren dem Deutschen Literaturarchiv Marbach übergeben hatte. Dank einer Reihe urkundlicher und lebensgeschichtlicher Dokumente aus Fühmanns Nachlaß, der sich im Archiv der Berliner Akademie der Künste befindet, sind wir einigermaßen verläßlich unterrichtet über jene Jahre bis 1945. Eine Leerstelle sind allerdings authentische Zeugnisse aus eigener Hand. Die Herausgeber und Biographen haben diese Lücke zu schließen versucht, indem sie Teile des Erzählwerks uneingeschränkt autobiographisch lasen und bedenkenlos daraus zitierten, als handele es sich um historisch Beglaubigtes. Ähnliches, wenn auch abgemildert, gilt für den wissenschaftlichen Umgang mit späteren gedruckten Gesprächen und Interviews.
Mit dem am 28. Mai 1943 verfaßten Brief Fühmanns an Karl Krolow liegt ein unmittelbares Zeitdokument vor uns, eine Momentaufnahme des einundzwanzigjährigen Gefreiten, der in einem Luftwaffenstab der deutschen Wehrmacht als Funker und Telegraphenbauer eingesetzt wurde. Warum er den Brief schrieb, teilt der erste Satz mit: Ihm war eine Ausgabe der im Hamburger Verlag Heinrich Ellermann erschienenen Reihe »Das Gedicht. Blätter für die Dichtung« in die Hand gekommen, die 4. Folge des 9. Jahrgangs Januar 1943. Sie trug den Titel »Hochgelobtes gutes Leben« und versammelte auf vierzehn Seiten jeweils sechs Gedichte von Hermann Gaupp und Karl Krolow. Mag sein, daß ihm der Verleger dieses schmale Bändchen hatte zukommen lassen, war doch Fühmann ein Jahr früher selbst in der Reihe vertreten gewesen (8. Jahrgang, 5. Folge, Februar 1942). Unter dem Titel »Jugendliches Trio. Gedichte junger Menschen« hatte Ellermann damals fünf Gedichte von ihm gedruckt und jeweils vier von Edith Tohde (1922 – 1990 [?]) und Alois Timmesfeld (geb. 1920, am 27. April 1945 standrechtlich erschossen wegen Kriegsdienstverweigerung). Daß das Bändchen mit den Gedichten von Gaupp und Krolow, das ihn im Frühjahr 1943 erreichte, nachhaltigen Eindruck hinterließ, bezeugt die späte Erwähnung im Gespräch mit Wilfried Schoeller 1982. Es sei das nächste nach seinem gewesen, erinnerte er sich nicht ganz korrekt, und »war einem einzelnen Debütanten zur Verfügung gestellt – und der hieß Karl Krolow«. Die Beteiligung von Hermann Gaupp (1901–1966), der damals Dramaturg am Reichssender in Stuttgart war und bereits einen Gedichtband vorweisen konnte, hatte im Gegensatz zu Krolow, der seit den fünfziger Jahren zu den maßgeblichen Lyrikern der Bundesrepublik gehörte, in seinem Gedächtnis keine Spur hinterlassen.
Ganz offensichtlich war es im Spätfrühling 1943 aber nicht die literarische Prominenz Krolows, von der sich Fühmann Förderung erhoffte. Denn von einer solchen konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein. Aus der Ellermann-Publikation wußte Fühmann nicht mehr, als daß Krolow ihm sieben Lebensjahre voraus war, aus Hannover stammte und »zur Zeit an der Universität Göttingen« studierte. Spontane Begeisterung führte die Feder – richtig: die Hand auf einer Schreibmaschine, deren Tastatur Fühmann auf Großbuchstaben arretiert hatte –, und die unbestimmte Hoffnung, im anderen einen Gleichgesinnten getroffen zu haben. Er schrieb hier nicht nur einem Gegenüber, von dem er außer einigen Gedichten nichts kannte, er schrieb auch sich selbst. Ob noch an der östlichen oder wenig später an der griechischen Front: Es hätte wohl auch nichts geändert, wenn Fühmann gewußt hätte, daß Krolow bis 1942 erst evangelische Theologie, dann Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert hatte, daß er seit 1937 NSDAP-Mitglied und seit 1941 verheiratet war. Selbst die kurzzeitige Referentenstelle Krolows beim »Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums«, in dessen Aufgabenbereich nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten lag, hätte ihn kaum interessiert. Eher wäre er neugierig gewesen, was der andere schon publiziert hatte. Doch wie hätte er an die vereinzelten Drucke in größeren Zeitungen kommen können? Eine Ausnahme mochte die »Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben«, »Das Innere Reich«, sein, deren Schriftleiter Paul Alverdes seit Anfang der vierziger Jahre wiederholt Texte Krolows publiziert hatte. Gedichte wie »Lebenslied« und »Für mein Kind« im Mai / Juni-Heft 1942 fielen nicht weiter ins Gewicht, Krolows Revue zeitgenössischer Lyrik im ersten und zweiten Heft 1943 hätte aber allemal Fühmanns Leseinteresse gefunden (»Betrachtungen zu Gedichtband-Titeln und Zur Gegenwartslyrik«). Immerhin hatte Krolow hier auf 32 Druckseiten die aktuell maßgeblichen in Deutschland erschienenen Gedichtbände von Friedrich Georg Jünger, Gotthard de Beauclair, Werner Bergengruen, Oda Schaefer, Franz Tumler, Eberhard Meckel, Manfred Hausmann, Friedrich Bischoff, Hermann Struppäck und Georg von der Vring besprochen – mit einem reservierten Fazit: Durch »den Umgang mit bildungsmächtigem Geist« entziehe sich ein »nicht geringer Teil der heutigen Lyrik (…) der Fülle nothafter Gegebenheiten des Daseins« und könne sich »mit der drangvollen Nähe nicht verstehen (…), wie sie uns angeht«. Das »Ateliermäßige und Akademische« sei der »Wirklichkeit des Krieges« nicht gewachsen, werde ihr nicht gerecht. Daß Krolow nur die einzige Frau in dieser Reihe gelten ließ, hatte weniger mit deren Geschlecht zu tun als mit der baltischen, »ostdeutschen« Landschaftsprägung. »Man ist in dämonisches Land ausgeschlüpft und wird darüber selbst zum Dämonenwesen.«
Vermutlich kannte Fühmann diesen kritischen Gleitflug Krolows über das weite Feld zeitgenössischer deutscher Dichtkunst nicht. Er hätte darauf Bezug genommen, beiläufig zumindest. Aber er las aus dessen sechs Gedichten heraus, wonach dieser in seiner Bestandsaufnahme gefahndet hatte: »Sie schreien den Schrei der Zeit nicht mit. Sie verleugnen sich auch nicht vor ihr. Sie stehen schon darueber.« Was er mit diesen Worten den Versen Krolows attestierte, klang nach einem poetischen Credo. Indem Fühmann dem Brief eine kleine Auswahl eigener Gedichte beifügte, setzte er sich dem Vergleich mit den »jetzt im Mittelpunkt des Interesses stehenden Lyrikern« und auch der Prüfung aus, ob er – was er seinerseits Krolow wertschätzend bescheinigte – »etwas zu sagen« habe.
Fühmanns Brief kommt gleich ›zur Sache‹. Er beläßt es nicht bei bloßer Huldigung, sondern wird konkret, und der Ton, in dem das geschieht, ist nicht anders als unumwunden zu nennen. »Kennen Sie Weinheber?« Diese Frage, unter Dichtern gestellt, war Mitte 1943 reine Rhetorik. Der 1892 in Wien geborene Josef Weinheber gehörte nicht erst seit dem »Anschluß« Österreichs zu den prominentesten Lyrikern im deutschsprachigen Raum. Nach einem politischen und konfessionellen Schlängellauf hatte er sich entschieden auf die Seite des NS-Regimes und Adolf Hitlers geschlagen. Weinheber, immerhin an Karl Kraus geschult, hatte sich seit den frühen zwanziger Jahren dank seines breiten lyrischen Gestaltungsvermögens einen Namen gemacht. Dabei hielten sich in seiner höchst widerspruchsvollen Persönlichkeitsstruktur Größenwahn und Nichtigkeitsgefühle die Waage. Galt er den einen als kultureller Repräsentant des »Dritten Reiches«, war er den anderen ein Nachfolger Hölderlins. Den jungen Fühmann interessierte ausschließlich der Lyriker. Weinheber, bekennt er 1980 im Gespräch mit Margarete Hannsmann, sei »auch mein Dichter gewesen, vor dem bin ich auf den Knien gelegen« und habe »à la Weinheber gedichtet«. Das »ziemlich unbekannte« Gedicht jenes so verehrten Dichters, aus dem er für Krolow zitiert, war unter einem abweichenden Titel bereits im Juli 1934 in der Ostdeutschen Rundschau erschienen. (Möglicherweise hatte Fühmann es im »1. Kunstjahrbuch des Reichsgaues Salzburg« gelesen. Das nämlich war vom Salzburger Verlag Bergland-Buch 1941 herausgegeben worden, was die Titelverwechselung erklärte. In ihm waren neben Weinheber alle maßgeblichen nationalsozialistischen Dichter vornehmlich Österreichs versammelt.) Es charakterisiert Fühmanns damalige lyrische Affinitäten, daß ihm gerade diese Weinheber-Verse gegenwärtig waren. In ihnen entdeckte er eine poetische Korrespondenz zu jener Zeile, mit der die zweite Strophe von Krolows Gedicht »Waldmusik« beginnt: »Wenn der Nachmittag im Himbeerwald / Dunkelte im Tönen des Fagott: / Hornklee roch und Nebel braute bald, / Schauder überrieselte mich kalt, / Und ich sah den starken Hirtengott.« Viermal pries Fühmann Krolows erahnte Kunst mit einem »Sie koennen«, und er nannte die poetischen Tugenden, die für ihn maßgeblich waren: beschwören, träumen und leben. Ein für ihn im soldatischen Dasein gefährdetes Maß.
Diesem Dasein, das als »da draußen« aufscheint, widmet der Brief in unmittelbarem Anschluß einen kompakten Absatz. Dem »Kennen Sie Weinheber?« folgt ein »Kennen Sie Russland?« Der hochgestimmte Ton, in dem Fühmann die landschaftliche Schönheit ins fast Märchenhaft-Mystische erhebt, verschlägt dem, der sich die unmittelbaren Kriegsumstände dieser Region vor Augen führt, die Sprache. Nachdem das deutsche Heer unter fürchterlichen Verlusten bei Stalingrad besiegt war, hatte der deutsche Oberbefehlshaber Adolf Hitler die unbedingte Verteidigung der ukrainischen Gebiete um Charkow befohlen. Als es Mitte Februar 1943 der Roten Armee gelungen war, die Stadt zurückzuerobern, war Hitler persönlich an die Front geflogen, um einen bei der Militärführung umstrittenen militärischen Großeinsatz durchzusetzen. Charkow, so ein damaliger Wehrmachtsgeneral, habe wie ein »magischer Anreiz« auf die deutschen Truppen gewirkt. Am 18. März 1943 war es zu einer qualvollen Rückeroberung von Charkow gekommen, die die beteiligten Divisionen, unter ihnen Spezialeinheiten der SS, über hunderttausend Tote gekostet hatte. Dieser Pyrrhussieg war der letzte der deutschen Wehrmacht an der Ostfront. Ende März hatte die Rasputiza (russ. »Wegelosigkeit«), die Schlamm- und Regenperiode, eingesetzt, und die Kämpfe waren zum Erliegen gekommen. Daß von alldem nichts in Fühmanns Brief steht, darf nicht verwundern, so nachdenklich die schillernd-verklärenden Schilderungen der ukrainischen Welt, in der er damals lebte, stimmen. Militärisches zu berichten, konnte Kopf und Kragen kosten. Aber es lag auch außerhalb seiner Schreibintention. Er wollte einen lyrischen Freund gewinnen, keinen Teilhaber an seiner soldatischen Existenz und Lage.
Die war vorgezeichnet: weniger für ihn und seinesgleichen, gewiß aber für die, die die Gesamtsituation des Krieges überschauten. Nach einer Großoffensive im Sommer gelang es der Roten Armee im August 1943, Charkow und die umliegenden Gebiete wieder einzunehmen, nun endgültig. Fühmann, der bereits wieder in das 150 Kilometer entfernte Poltawa verlegt worden war, mußte mit seiner Einheit überstürzt den weiteren Rückzug antreten. Mit einem Antwortschreiben von Karl Krolow wird er nicht gerechnet haben. Das Briefende deutet an, wie er sich, den offenen Ausgang ahnend, zu trösten suchte. Und Trost war es ihm, seine beigelegten Gedichte in eine Unbestimmtheit geschickt zu haben, in der er eine eigene Bestimmung wähnte.
Tief saß sein Bedürfnis, Verse zu »trinken wie das Gift von Äther«. Er wisse noch, heißt es 1953 in dem Poem »Die Fahrt nach Stalingrad«, »wie das war, als ich Gedichte schrieb im flammenversengten Charkow«. Er habe »schon als Kind«, seit er »schreiben konnte, geschrieben: (…) fast nur Gedichte, wahllos, kritiklos, fast automatisch und ohne Korrekturen, tagaus, tagein (…)«, erinnert er sich 1971. Eine »Existenznotwendigkeit« sei ihm das Schrei ben gewesen, auch dann noch, als in Gefangenschaft alles Papier fehlte und er nichts hatte als eine Schiefertafel, die er vollkritzelte und wieder und wieder löschte.
Von dem, was er bis 1950 gedichtet habe, meinte er 1982, sei »fast alles abhanden gekommen«, ausgenommen jene Arbeiten, die seine Mutter vor ihrer Umsiedlung 1945 im Heimatdorf Rochlitz unter die Leute verteilte. Im Nachlaß im Archiv der Akademie der Künste befindet sich eine erstaunliche Anzahl lyrischer Texte Fühmanns von 1936 bis 1945, beinahe ausschließlich unveröffentlicht (vgl. Uwe Buckendahl. »Keine Auswahl. Werkverzeichnis Franz Fühmann«). Dabei sticht – neben 181 Schulheftseiten handgeschriebener Lyrik unter der Überschrift »Athen« – eine gebundene Broschur mit 137 Typoskriptseiten von Versen heraus. Fühmann hatte ihr den Titel »Feierliche Beschwörung« gegeben und als Untertitel »Gedichte von Franz Peter Fühmann«, ergänzt um Ort und Jahr: Athen, im Herbst 1943. Hier findet sich mit kleineren Abweichungen auch das Titelgedicht der an Krolow geschickten Sammlung. Eine weitere Mappe enthält das Gedicht »Untergang«. Die drei anderen Texte, die Fühmann an Krolow sandte – »September«, »Charkow Jänner 1943« und »Dämmerung in Rußland« – sind, nach ersten Recherchen, im Nachlaß nicht überliefert.
Fühmann ist mit diesem umfangreichen lyrischen Frühwerk unbarmherzig umgegangen. Keine Gnade hat es vor seinem Auge gefunden. In der Werkausgabe, die er mit seiner Lektorin Ende der siebziger Jahre in Angriff nahm, wollte er nichts davon gedruckt sehen. Kaum weniger schroff verfuhr er mit seiner Lyrik der fünfziger Jahre. Das hat dazu geführt, daß wesentliche Teile dieser Werkphasen unbekannt sind. Gewiß, dem Dichter stand das frei, der Forschung indes nicht und auch nicht der Edition. Indem sie sich ebenfalls diese Freiheit nahmen, versäumten sie ihre Pflicht – bis heute. Hätte Fühmann diesen Werkteil nicht gewollt, hätte er ihn vernichtet. Die Forschung darf Bestände von dieser Substanz nicht ignorieren, auch wenn der Autor sie in seiner Werkauswahl unberücksichtigt ließ. Karl Krolow übrigens verfuhr nicht anders als Fühmann. Seine »Gesammelten Gedichte« (1965) beginnen mit fünf Texten von 1944, alles Folgende stammt aus der Zeit nach Kriegsende. Erst lange Jahre später entschloß er sich, eine Auswahl dieser frühen Lyrik zu veröffentlichen.
Fühmanns Nachlaß enthält keine Korrespondenz mit Krolow. Wenn es ein Erwiderungsschreiben 1943 oder später gegeben hat, ist es verlorengegangen. Zu weit entfernt voneinander waren die realen Welten, um eine persönliche Annäherung zu gewähren. Belege, daß Fühmann nach 1945 oder nach Rückkehr aus Kriegsgefangenschaft noch einmal den Kontakt zu Krolow suchte, gibt es nicht. Wahrgenommen dürfte er ihn haben, denn Krolows Gedichte erschienen sowohl im Westen als auch in der Sowjetischen Besatzungszone (»Heimsuchung« im Verlag Volk und Welt 1948, mit einer Vorbemerkung von Stephan Hermlin). Doch selbst ein Gedicht wie »Nachtstück mit fremden Soldaten« (1948) hätte den aus Rußland Heimkehrenden wohl nicht mehr interessiert. Vielleicht kam es Dezember 1975 zu einer persönlichen Begegnung, als der Suhrkamp Verlag eine Feier anläßlich Rilkes hundertstem Geburtstag veranstaltete, wer weiß. Doch wenn, dann wird es bei einem Händedruck geblieben sein. In seinem Taschenkalender, den er zunehmend wie ein Tagebuch führte, vermerkte Fühmann nichts davon.
Roland Berbig
SINN UND FORM 5/2025, S. 648-658, hier S. 648-652
