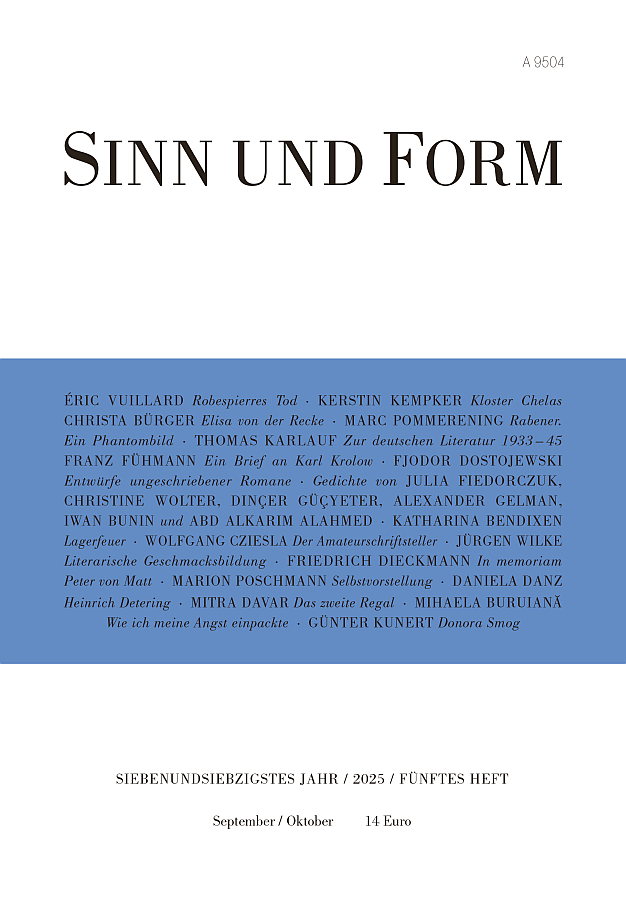
[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-85-0
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2025
Pommerening, Marc
Rabener
Ein Phantombild
Das letzte Buch der Weimarer Republik erschien nach ihrem Untergang. Dem Verleger Ernst Rowohlt war der Inzest-, Inflations- und Muttermordroman eines Debütanten so wichtig, daß er ihn als Abrechnung mit einer überwundenen Zeit bewarb und dem vierundzwanzig Jahre jungen jüdischen Autor Jacques Rabinowitz ein kerndeutsches Pseudonym verpaßte – Johann Rabener.
Seitdem sitzt die Tarnkappe, denn das Erscheinungsjahr 1933 und die für Rowohlt untypische Fraktur lassen einen aus politischer Verlegenheit ins Programm gehievten Provinzautor vermuten. Dabei ist das Buch dampfender Asphalt: Schelmenroman und Inflationsgroteske, Künstlerroman und dessen Parodie, ein von sprühendem Pessimismus befeuertes Berlin-Panorama. Es heißt »Verurteilt zum Leben«, und sein Held, der Musiker Fedor Feuerhahn, ist ein Candide der Weimarer Republik: Der ungeliebte Sohn eines Rittmeisters wird zum Liebhaber seiner nymphomanischen Mutter, durchläuft, vor ihr fliehend, ein Pandämonium aus Schiebern, Spekulanten, Prostituierten und Revolutionären, sinkt vom Opernkomponisten zum Jazzpianisten, wird, von Geldnot getrieben, im Affekt zum Muttermörder und begeht Selbstmord, indem er sich mit seiner Geliebten auf die Gleise des Schnellzugs Köln – Berlin legt.
Bei Erscheinen des Buches im Juli 1933 waren seine potentiellen Kritiker und Leser auf der Flucht; das Romanische Café, wo Rabener Schach spielte, halb leer. »Verurteilt zum Leben« wurde zum großen Wurf ins Leere und hat sein deutsches Publikum nie gefunden.
Daß er Rabeners Buch »fürchterlich und herrlich« findet, schrieb immerhin der Rowohlt-Autor Hans Fallada seinem Verleger. »Da wächst ein Erzähler herauf, vor dem können die Meisten einpacken. Das alles erinnert an Balzac, mit seiner Eindringlichkeit, seiner sturen Verbohrtheit in das Thema – und dann in der Leichtigkeit des Erzählens. Lieber Gott, was sind da für Wendungen darin … und ich Affe habe dem Rabener erzählen wollen, wie man Romane schreibt.« Fallada wirbt für den jungen jüdischen Kollegen bei der einflußreichen »Neuen Rundschau« des Rowohlt-Konkurrenten S. Fischer. Peter Suhrkamp, seit 1932 deren Chefredakteur, reagiert mit heftiger Abneigung und läßt gleich drei Verrisse schreiben, die er alle nicht druckt. Vielleicht, weil Samuel Fischer einen jungen, ebenfalls jüdischen und gleichaltrigen Debütanten im Programm hat: Hans Keilson, dessen Romantitel »Das Leben geht weiter« wie eine programmatische Entgegnung auf Rabener klingt. Oder, weil Suhrkamp der Deutschlehrer jenes hochtalentierten Freaks war, der Rabener als Vorbild für seinen Muttermörder Feuerhahn diente. Der junge Kalistos Thielecke war Protegé von Gerhart Hauptmann, wurde vom Fischer-Cheflektor Moritz Heimann an die Reformschule Wickersdorf vermittelt und ermordete am 6. August 1930 seine ihn tyrannisierende Mutter in der Badewanne. Ein Sensationsprozeß folgte; der Fall Thielecke schien wie die Steglitzer Schülertragödie symptomatisch für die grassierende »Krankheit der Jugend« und wurde von Rabener so überzeugend in seinen Roman aufgenommen, daß Zeitgenossen argwöhnten, er sei selbst in die Vorgänge verstrickt.
Nicht Keilson, Rabener ist zunächst der Erfolgreiche. Er wird in Großbritannien und Ungarn gedruckt, in Österreich breit diskutiert und in der Schweiz verrissen. Sein Übersetzer ins Ungarische, Paul Tabori, skizziert Rabener als »Jungen mit klaren dunklen Augen und unbändiger Mähne«, der »in seltsam sprunghaften Sätzen« von Wanderjahren und »mindestens sieben verschiedenen Berufen« erzählt und wie ein amerikanischer Autor wirkt – für Rowohlt eine unwiderstehliche Kombination. Dabei war S. Fischers Erfolgsschriftsteller Jakob Wassermann Rabeners erster Mentor, der als wohlmeinender »Johann Victor« am Anfang und am Ende von »Verurteilt zum Leben« seinen Auftritt hat. Wassermann quetscht den jungen Rabener für eine eigene »Rede an die Jugend« aus und vermittelt, »damit Sie nicht länger in Ihrer originellen Weise schmachten«, sein Buch an Rowohlt. 1933 allerdings zieht er sich, als Jude bedrängt, krank und verfolgt von einer rachsüchtigen Exfrau, nach Österreich zurück und ist nicht mehr recht brauchbar für einen Hochbegabten, der Fürsprache und einen Meister sucht. Rabener wendet sich an Thomas Mann.
Er entschuldigt sich kokett, daß sein Buch »gleichsam raucht von Morden, Selbstmorden und anderen unseligen Toten«, und versichert, daß es Mann »recht intensiv unterhalten« werde. Dieser, Emigrant wider Willen und sich immer noch im verlängerten Urlaub in der Schweiz wähnend, greift, nach »recht lahmer Arbeit« und einem bald überwundenen »Schwäche-Anfall«, am Abend des 23. Oktober 1933 zu Rabeners Buch und bemerkt in dem »sehr begabten epischen Wurf« etwas »Zeitwildes und jugendlich Großartiges«. Wie Fallada und vor ihm Wassermann erkennt der Erzähler den Erzähler. Und schickt ihm den ersten seiner Josephsromane, »Die Geschichten Jaakobs«, dessen Vorwort eine Theorie des Erzählens entwirft. Manns Sentenz »Fest der Erzählung, du bist des Lebensgeheimnisses Feierkleid« preist Rabener als »Prachtsatz«, dessen »großartige Mischung aus höchstem Geist und holder Naivität« ihn an Goethe erinnert.
Daß Mann Rabener schrieb, steht in seinen Tagebüchern. Was er ihm schrieb, ist bestenfalls erahnbar, denn seine Briefe sind verschollen, einige von Rabener haben sich im Thomas-Mann-Archiv erhalten und sind (bislang unveröffentlichte) Dokumente schwärmerischer Hingabe. Sie lesen sich wie Liebesbriefe. Rabener wirbt um den »hochgeehrten Herren«, dessen Kunst »überaus schön und erhaben« durch »die Jahrhunderte leuchten« wird, spricht von »einer Liebesbeziehung zwischen Ihrem Buch und mir«. Und Mann, zutiefst verletzt durch einen Schmähartikel in der Literarischen Welt, registriert am 4. November dankbar, mit wie »großer Liebe« der »junge Rabener« sein Buch preist, »in Ausdrücken, von denen man nicht glauben sollte, daß sie gleichzeitig mit den Niedrigkeiten des nationalsozialistischen Literaturblattes über ein und dieselbe Sache gesagt werden können«. Es beginnt eine mehrjährige Korrespondenz, in der Rabener Mann herausfordernd schmeichelt oder schmeichelnd herausfordert, Mann Rabeners Lob wohlwollend vermerkt und dessen Bedrängnis ignoriert – eine für Mann ganz untypische Meister-Schüler-Beziehung, die eher an den George-Kreis erinnert.
Ende 1933 wird Rabeners Buch verboten, es kommt zu einer nicht aktenkundig gewordenen Begegnung mit der Gestapo. Depressiv und unter Schreibblockaden leidend sitzt er auf der Galerie des Romanischen Cafés und spielt Schach, ist wieder der den irdischen Konflikten entrückte »Mondbewohner«. Zug um Zug erprobt der junge jüdische Autor die noch vorhandenen Spielräume, zu vorsichtig für Rowohlts Geschmack, der ihm eine Monatsrente zahlt und seinen Lektor Paul Mayer vorbeischickt, der ihm den Ruhm eines deutschen Dostojewski ausmalt – Rabeners zweites, nach einem Goethe-Zitat benanntes Buch »Denn ich bin ein Mensch gewesen« erscheint Ende 1934. Von »verzweifeltester Vorsicht« schreibt Rabener danach an Thomas Mann und von seiner Schwierigkeit, »überhaupt etwas Lesbares zustande zu bringen«.
Johann Rabener maskiert sich im Roman als Joachim Ruderer. Kein Musiker diesmal, sondern ein Schreiber. Gegenstand des Buchs ist das Erzählen selbst in einer Welt, in der Freiräume sich verengen und Wände Ohren haben. Der jäh als Romancier erfolgreiche Ruderer verläßt seine Studentenbude und wird möblierterHerr, verliebt sich in seine finanziell bedrängte Vermieterin und erzählt ihr die »Gewitterjahre« seiner Jugend als hinreißend komischen Schelmenroman. Rabener überschreibt sein eigenes Leben und übertreibt seine Erfahrungen. Ernst Rowohlt etwa ist als »Wolter« vertreten, Paul Mayer als »Paul Germer«, aber auch die Kunstseidenfabrik in Kreuzberg kommt vor, wo der Autor 1926 kurz Lehrling war.
Hier öffnet sich, vielleicht von Mayer freigesprengt, ein Spielraum, in dem die tolldrastische Brillanz des Erzählers, seine Lust an der grotesken Zuspitzung sich austobt. Rabener nutzt die Bühne, um Boheme und Halbwelt des republikanischen Berlins einen letzten Auftritt zu verschaffen. Die Zeit von Weimar wird nicht verdammt, sondern beschworen – aber politisch nicht konkretisiert, denn Kommunisten und Nazis werden nicht erwähnt. Rabener erschafft für seinen Avatar Ruderer eine Parallelwelt, in der die Republik fortbesteht, als wäre die »Schattenparade« der NS-Herrschaft, die an den Fenstern des Romanischen Cafés vorbeizieht, ein durch die Erzählung verfliegender Alptraum. (...)
SINN UND FORM 5/2025, S. 626-636, hier S. 626-629
