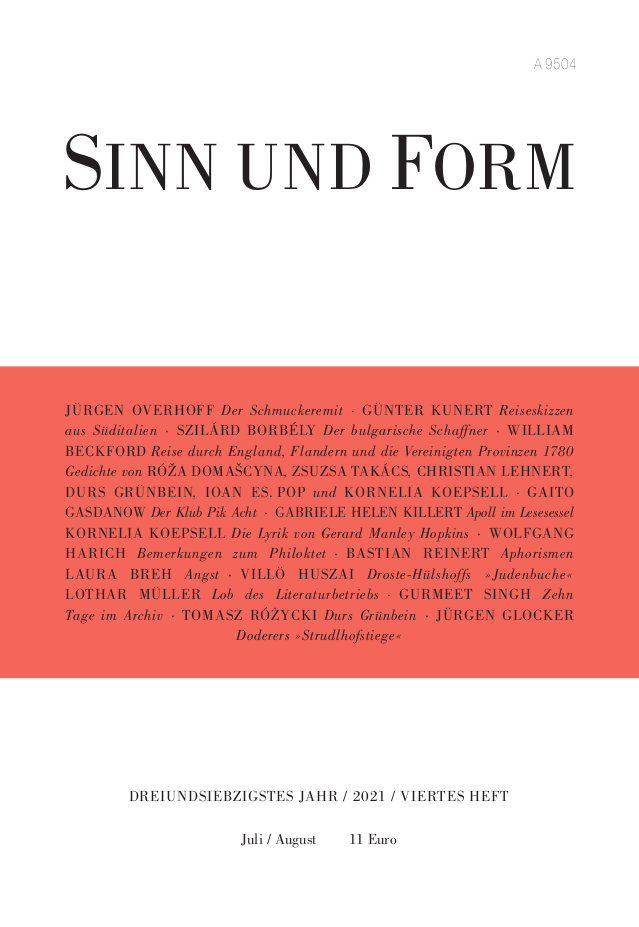
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-60-7
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 4/2021
Overhoff, Jürgen
Der Schmuckeremit. Jean-Jacques Rousseau und die exzentrische Betrachtung der Einsamkeit
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei.
(Genesis, 2,18)
Der menschliche Atem ist seinesgleichen tödlich;
das gilt im eigentlichen nicht weniger als im übertragenen Sinn.
(Jean-Jacques Rousseau, Emile)
1
Seit es menschliche Aufzeichnungen gibt, wird an allen Orten und Enden der Welt von Einsiedlern berichtet, von freiwillig im Abseits lebenden Einzelgängern, die sich den verbindlichen Zusammenhängen von Gemeinschaft und Gesellschaft auf Dauer entziehen. In der Literaturgeschichte kommt diesen in selbstgewählter Abgeschiedenheit hausenden Gestalten sogar eine herausragende Bedeutung zu. Die ältesten Werke und Epen verdanken ihnen ihre Wirkung oder gar Entstehung. Das Grundbuch der altchinesischen Weisheitslehre, Lao Tses jahrtausendealte Spruchsammlung Tao-Te-King, kann erst niedergeschrieben werden, als sich ihr Verfasser im Alter in die Einsamkeit der Berge zurückzieht. Dort, an entlegener Stätte, wohnt er ganz allein bei dem Greis Yin Hsi, der ihn dazu drängt, seine Lebensweisheit in knappen Sentenzen zu bündeln. Erst die steinige und karge Einsiedelei des monastisch lebenden Gastgebers bietet ihm den nötigen Ruheraum, fernab vom Getümmel der Welt seine Gedanken schriftlich zu ordnen. »Zieh dich zurück, wenn die Arbeit getan ist«, lehrt Lao Tse, denn nur »Stille und Ruhe bringen die ganze Welt ins Maß zurück«.
Ein einsam und in einer felsigen Höhle lebender Mann spielt auch beim gewaltigen Auftakt der altgriechischen Literatur eine gewichtige Rolle. Hier ist es der riesenhafte Polyphemos, ein Kyklop, der gleich am Beginn der europäischen Dichtung von Homer in seiner Odyssee als archetypischer Einzelgänger geschildert wird. Anders als der legendäre Chinese, dessen entrückte Zuflucht im Gebirge als Winkel kontemplativ-schöpferischer Muße gepriesen wird, ist der griechische Hüne ein abstoßender Outcast, den Homer in den widerwärtigsten Farben malt. Die Einsamkeit des Polyphemos ist gekennzeichnet durch Wildheit und Willkür, er ist ein Mann, dem Gesetze nichts gelten und der weder willens noch fähig ist, durch Kultur zu glänzen. Ackerbau, Technik, Wissenschaft oder Literatur bedeuten ihm nichts, in seinem Alleinsein ist er ganz roh. Nur über ein einziges Auge verfügend, ist er mit einem Tunnelblick ausgestattet, der ihn einzig auf die Befriedigung der basalen körperlichen Bedürfnisse schauen läßt. »Er kümmert sich nicht um den andern«, heißt es lakonisch im neunten Gesang der Odyssee, und damit ist zugleich gesagt, daß der asoziale Kyklop nicht einmal über sich selbst und seine eigene dürftige Existenz reflektiert. Ohne Teilnahme an einer wie auch immer gearteten öffentlichen Versammlung, auch ohne den stillen Dialog mit sich selbst, bewegt sich der einsame Polyphemos in einem Zustand gefräßiger Lethargie und Stumpfheit. Bei Homer entbehrt die Einsamkeit jeder Verheißung. Die selbstgewählte Isolation ist hier der genaue Gegenentwurf zur Zivilisation.
Wieder anders stellt sich die Lage in den ältesten Passagen der heiligen Schriften Israels dar. Der Prototyp und Inbegriff eines Einsiedlers ist hier der Prophet Elia. Er begibt sich für lange Zeit in ein abgelegenes Tal, wo er auf eine Eingebung seines Gottes JHWH wartet. Nahrung bieten ihm dort nur die wenigen Brotreste und Fleischbrocken, welche die Wüstenraben hinterlassen. Erst nach langem Ausharren in einem vollständig ausgetrockneten Flußbett kommt »das Wort des HERRN« zu ihm, dem darbenden Propheten, der den göttlichen Zuspruch als Signal zum Aufbruch aus der Einsamkeit versteht. Doch wiederholt Elia zu späterer Zeit noch einmal seinen Weg in die Stille. Er geht »in die Wüste« – ἐν τῇ ἐρήµῳ [en te eremo] heißt es im griechischen Text der Septuaginta – und haust dort als Eremit, also als ein einsamer Bewohner dieser Ödnis und Wüstenei. Schutz bietet ihm allein eine Höhle auf dem Berg Horeb. Auch jetzt wird ihm die Rückkehr in die Gemeinschaft der Menschen erst gestattet, als er nach aufmerksamem Hören das Wort seines Gottes wie »ein stilles, sanftes Säuseln« vernimmt.
Die Urschriften des Christentums, die für das Verständnis der Einsiedelei in Europa bis in die Neuzeit maßgeblich sind, orientieren sich ausdrücklich und wiederholt am Propheten Elia als Vorbild des alleinlebenden Gottsuchers. Im Lukasevangelium wird auch der Messias Jesus von Nazareth in die Tradition des Elia gestellt: Im vierten Kapitel verbringt Jesus vierzig Tage allein in der Wüste – auch im neutestamentlichen Koine-Dialekt heißt es im Griechischen hier ἐν τῇἐρήµῳ –, bis er erst im unbedingten Vertrauen auf Gottes Wort die Kraft des Geistes verspürt, die es ihm ermöglicht, wieder die Gemeinschaft der Menschen aufzusuchen, denen er sogleich von den nachahmenswerten Taten des großen Elia berichtet, mit dem er sich ausdrücklich und vorbehaltlos identifiziert. In der Übertragung der Vulgata prägen diese Geschichten dann die gesamte lateinische Christenheit und ermuntern asketisch gesinnte Menschen dazu, es Elia und Jesus gleichzutun, um in einer Einöde – dem klassischen desertus locus – als einsame Gottsucher auszuharren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß der Verfasser der Vulgata, der heilige Hieronymus, in seiner Jugend zunächst einsam in der Wüste Syriens lebt, bevor er bereit ist, sich in Bethlehem seinem umfassenden schriftstellerischen Werk zu widmen. Die syrische Wüste ist dann auch der Ort, an dem sich in der Nachfolge des Hieronymus der Eremit Symeon aufhält, um dort als Stylit, also als ein auf einem hohen steinernen Turm lebender, langbärtiger Anachoret, als sogenannter Säulenheiliger, ein besonders extremes Einsiedlerdasein zu führen, das in den spätantiken und mittelalterlichen christlichen Hagiographien eine vielbeachtete Rolle spielt.
Bis weit ins 18. Jahrhundert – ein Zeitalter, in dem sich Aufklärer und Dichter gleichermaßen von der altchinesischen Philosophie, Homer, der Bibel oder auch den Schriften der Kirchenväter inspirieren lassen – ändert sich in Europa das auch in der Literatur festgehaltene Bild vom Einsiedler kaum. Der Eremit gilt als radikaler Einzelgänger, der über einen langen Zeitraum hinweg fernab der Menschen siedelt und sich zu einem solchen Lebensentwurf auch bewußt entschlossen hat. Er kann zwar, wie Polyphemos, entweder ein dumpfer und kulturloser Rohling sein oder, ganz im Gegenteil, wie Lao Tse, Elia, Jesus, Hieronymus und Symeon ein schöpferischer Sucher der stillen Einsamkeit, die als konzentrierter Raum dichterischer Inspiration oder göttlicher Erkenntnis geschätzt wird. Doch immer ist es ein klarer und fester Vorsatz, der dazu führt, daß der Einsiedler der Welt für eine lange Weile entsagt: Entweder ist man Eremit oder man ist Weltmensch, es gibt kein halbherziges Dazwischen, kein Sowohl-Als-auch. Für die Dauer des Aufenthalts in der Einsamkeit hat das Resultat der persönlichen Entscheidungsfindung einen fest umrissenen Ort.
Erst im Jahrhundert der Aufklärung, einem so innovativen wie extravaganten Säkulum, das durch vielfältige innere Spannungen und offenkundige seelische Zerrissenheit gekennzeichnet ist, taucht unvermutet eine neue, seltsame und geradezu bizarre Einsiedlergestalt auf, die es so zuvor noch nirgends gab und die symptomatisch ist für den Beginn der Moderne. Diese ganz und gar ungewöhnliche Figur ist eine Erfindung der englischen Aristokratie, deren Spleen sie entspringt, wobei sie sich dann rasch auf dem europäischen Kontinent verbreitet, um dort nicht nur die Imaginationskraft des Adels zu beflügeln. Diese genuin neuzeitliche Erscheinungsform des Einsiedlers steht für das aufkeimende Gefühl einer prinzipiellen Unentschiedenheit, für das durchaus beklemmende emotionale Dilemma, es weder in der Gesellschaft noch in der Einsamkeit ganz aushalten zu können. Sie ist der Versuch einer spielerischen Flucht aus einer Kalamität, der man nur mit den Mitteln der Skurrilität entkommt. Die Rede ist von jenen sich zuerst in den Landschaftsparks der Nobilität verdingenden Einsiedlern, deren Vertreter man in England als Garden Hermit kennenlernt und in Frankreich dann als Ermite de Jardin bewundern kann. Seinen vielleicht schönsten Namen erhält dieser sonderbare Typus des Einsiedlers jedoch in Deutschland. In einer entzückenden Wortkreation heißt er dort »Schmuckeremit«.
SINN UND FORM 4/2021, S. 437-452, hier S. 437-440
