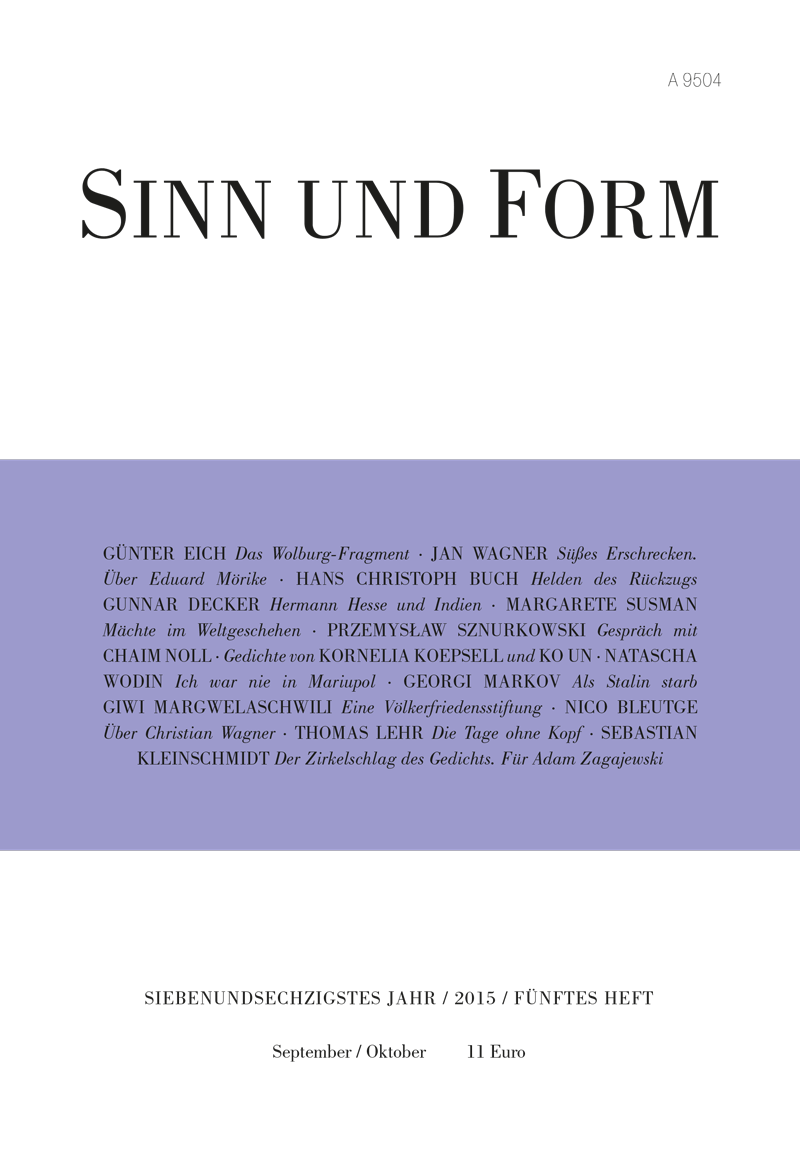
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-25-6
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 5/2015
Sznurkowski, Przemyslaw
»Wo Juden sind, entsteht auch Literatur«.
Gespräch mit Chaim Noll
PRZEMYSŁAW SZNURKOWSKI: Sie zeichnen in Ihren Büchern ein differenziertes Bild der israelischen Gesellschaft. Besonders in Ihrem 2014 erschienenen Roman »Die Synagoge« lernt man Sie als aufmerksamen Beobachter der politischen Ereignisse und sozialen Zustände in Israel, vor allem aber auch als kritischen Bürger kennen.
CHAIM NOLL: Kritik gilt hier in Israel als etwas vollkommen Normales. In Deutschland neigt man dazu, Konsens auf allen Gebieten herzustellen, man ist bemüht, möglichst immer einer Meinung zu sein, bis zur bösen Einheitlichkeit, die alle anderen Meinungen unterdrückt und totschweigt. So etwas ist hier unvorstellbar. Wenn man nach Israel kommt, dauert es einige Tage, bis man sich daran gewöhnt hat, daß hier jeder alles möglichst laut und möglichst zugespitzt zum Ausdruck bringt. Sonst wird man nicht wahrgenommen. Aber dieses auf den ersten Blick Verwirrende und Chaotische hat für Intellektuelle große Vorteile. Es ist ja das, was uns am meisten interessiert: Wie gebe ich meinen Gedanken Ausdruck? In der israelischen Gesellschaft kann ich sagen, was ich denke, und es wird immer jemanden geben, der das für einen bedenkenswerten Aspekt hält.
SZNURKOWSKI: Einer der wichtigsten Protagonisten Ihres Romans ist Holly, ein junger Mann, der gegen die Gesellschaft revoltiert. Er blickt ganz anders auf die Welt als die Generation seiner Eltern, er hält die Sicherheit Israels für gefährdet und steht der Politik des Landes ablehnend gegenüber. Sie haben ihn als typischen Außenseiter geschildert, der antisemitische Haltungen vertritt und sogar eine Freveltat begeht, indem er eine Tora-Rolle verbrennt.
NOLL: Außenseiter sind in der jüdischen Gesellschaft nichts Besonderes. Im Grunde sind wir alle Außenseiter. Die Toleranz gegenüber charakterlichen Eigenheiten oder Absonderlichkeiten ist unter Juden traditionell groß. Deshalb läßt die Gemeinschaft des Wüstenortes, in dem Holly lebt, ihn weitgehend tun und lassen, was er will. Bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt immer wieder Juden, die dem Judentum ablehnend, sogar feindlich gegenüberstehen. Wir kennen solche Fälle seit der Antike. Der Stratege der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, der Generalstabschef von Kaiser Titus, war Tiberius Julius Alexander, ein alexandrinischer Jude, der in Rom erzogen worden und vom Judentum abgekommen war. Sein Vater hatte noch zu den Förderern des Tempels gehört.
SZNURKOWSKI: Beim Lesen gewinnt man den Eindruck, daß die Wüste, die den Hintergrund der Handlung bildet, Sie außerordentlich fasziniert. Sie wird eindrücklich geschildert, manche Ihrer Figuren sind Wüstenforscher. Hatten Sie damit eine Art Huldigung an die Leute beabsichtigt, die dort leben?
NOLL: Wenn Sie den Roman als Huldigung an die Bewohner des Wüstenortes empfinden, freut mich das. Es sind Menschen, die sich aus Idealismus einer extremen Situation aussetzen. Sie beschäftigen sich mit einem Wissenschaftszweig, den vor zwanzig Jahren noch niemand ernst genommen hat. Inzwischen wissen wir: Die Erde befindet sich schon seit Jahrzehnten im Zustand der Desertifikation, wir leben in einem Prozeß der Versteppung der Erdoberfläche, zurückgehender Wälder, Erosion, Abgrasung der Steppen, ein jährlicher weltweiter Verlust an landwirtschaftlicher Anbaufläche von der Größe Deutschlands. Es muß etwas geschehen. Die Wüstenforschung hat sich zu einer bedeutenden Wissenschaft entwickelt. Viele von Desertifikation bedrohte Länder haben ihre Beziehungen zu Israel verbessert, weil sie an den hier gewonnenen Erfahrungen teilhaben wollen. Sie schicken ihre Studenten in die Wüste Negev, damit sie lernen, wie man in einem solchen Gebiet zivilisatorische Strukturen aufbauen, wie man ein Wüste gewordenes Land revitalisieren und landwirtschaftlich erschließen kann. Das sind die Fragen, mit denen sich diese Leute seit Jahrzehnten beschäftigen, unter Entbehrungen, improvisiert, mit wenig Geld. Der Ort wurde lange Zeit stiefmütterlich behandelt, obwohl Ben Gurion die Bedeutung der Wüstenforschung erkannt und dort draußen mit amerikanischen Sponsoren Institute gegründet hat. Inzwischen sind das weltbekannte Einrichtungen mit üppigen Forschungsetats. Die Zahl der Studenten hat sich verfünffacht, der Ort ist ein anderer geworden. In gewisser Weise ist es ein historischer Roman: Das Milieu, das ich beschreibe, gibt es so nicht mehr. Die meisten Bewohner sind zwar nicht im traditionellen jüdischen Sinn religiös, aber doch so spirituell, daß sie ihr Leben einer höheren Bestimmung widmen als dem Gelderwerb und der Karriere. Trotz aller Kontroversen sind sie sich einig, daß das, was sie zusammen machen, eine gute Sache ist, daß man Opfer bringen muß. Das ist vielleicht das Geheimnis der israelischen Gesellschaft überhaupt.
SZNURKOWSKI: Haben Sie sich auch über den Roman hinaus mit der Wüste als literarisches Phänomen befaßt?
NOLL: Ich arbeite seit zwanzig Jahren an einem Buch über die Literatur der Wüste. Das ist eines der Projekte, mit denen ich noch nicht fertig bin. Es gibt unendlich viel Material über all die Aspekte, unter denen die Wüste wahrgenommen worden ist. Einiges habe ich inzwischen in Zeitschriften veröffentlicht, zum Beispiel den Essay »Die Metapher Wüste. Literatur als Annäherung an eine Landschaft« in »Sinn und Form« und eine englische Fassung in der Zeitschrift des Internationalen PEN. Oder einen Aufsatz über T. S. Eliots »The Waste Land«, das den Topos nicht real als Sandwüste, sondern als Zustand des menschlichen Lebens behandelt. Das hat auch viele andere Autoren fasziniert. Wüste als Metapher oder Realität ist ein ewiges Thema der Literatur. Mich beschäftigt die Frage, welche Rolle die Wüste in unserem Bewußtsein oder Unterbewußtsein spielt. Wie ist es zum Beispiel zu erklären, daß Autoren, die nie in einer Wüste waren, anschaulich darüber schreiben konnten? Etwa Wilhelm Hauff in seinem Erzählzyklus »Die Karawane«. Oder Balzac in seiner wunderbaren Novelle »Leidenschaft in der Wüste« – auch er hat nie im Leben eine Wüste gesehen. Trotzdem war er imstande, die Einsamkeit dort genau zu schildern.
SZNURKOWSKI: In Ihrem Roman schreiben Sie über das Verhältnis der Israelis zu den deutschen Einwanderern. Eine Figur beispielsweise »schmerzte es, täglich die verhaßte Sprache zu hören«, »ein hartes, böses Gezisch«, »wie militärische Kommandos klingende Ausrufe«. Wie werden die deutschen Juden heutzutage in Israel wahrgenommen? Hört man Deutsch häufig im Alltag?
NOLL: Die Einstellung zur deutschen Sprache hat sich stark verändert. Es hat damit zu tun, daß sich auch die Beziehung zu Deutschland verändert hat. Das liegt zu einem guten Teil an den Deutschen selbst, die nach der Shoah in sich gegangen sind und versucht haben, ihre Vergangenheit kritisch zu betrachten und aufzuarbeiten. Das war auch mit einer gewissen Hinwendung zur jüdischen Kultur und Literatur verbunden. Als wir vor zwanzig Jahren nach Israel kamen, war die deutsche Sprache hierzulande weitgehend verachtet. Als wäre sie schuld an dem, was in der Nazi-Zeit geschehen ist. Ich habe diesen Widerwillen nie verstanden. Es schien mir vollkommen unsinnig, die verständliche Aversion gegen das Land ausgerechnet an der Sprache abzureagieren. Deswegen habe ich auch das Deutschverbot in der frühen Kibbuz-Kultur nicht begriffen. Familien, die aus dem deutschen Sprachraum kamen, haben ihre Kinder daran gehindert, ihnen regelrecht verboten, die Sprache ihrer Eltern zu lernen. Als wir in den Süden kamen, gab es kaum deutschsprachige Lehrer an der Universität, man konnte nicht einmal die Gründerliteratur des Landes studieren. In Sde Boker befindet sich das Ben-Gurion-Nachlaß-Institut. Dort liegen zahlreiche auf deutsch geschriebene Dokumente, denn viele der frühen Zionisten waren deutschsprachig, nicht nur Theodor Herzl, sondern auch Leute wie der Botaniker Warburg, die sich mit technischen und landwirtschaftlichen Fragen beschäftigten. Wir haben an der Universität gegen große Widerstände ein deutschsprachiges Programm gegründet, einer unserer Studenten ist ans Ben-Gurion-Nachlaß-Institut gegangen, um die Korrespondenz zu sichten. Sie war seit Jahrzehnten unbearbeitet, weil von den Historikern des Instituts keiner Deutsch lesen konnte. Dabei waren es oft Kinder deutscher Einwanderer. Ich habe vom ersten Tag an gesagt: Was wir hier brauchen, sind möglichst viele Sprachen. 1997 bin ich von der Universität in Beer Sheva eingeladen worden, an einem Programm für deutschsprachige Studenten mitzuarbeiten. Wir haben dazu in der Wüste Negev ein Studienzentrum gegründet, was damals noch abwegig schien. Ich kann mich erinnern, daß Leute von der Straße in den Hörsaal kamen, um zu protestieren. Eine Frau lief nach vorn und rief: »Ich will hier im Land kein Deutsch hören!« So war die Stimmung damals. Doch davon ist nichts geblieben, höchstens bei sehr alten Leuten. Wenn ich heute auf der Straße Deutsch rede, mit Freunden oder weil ich mit meiner Frau oder Tochter telefoniere, sprechen mich oft junge Leute an und sagen mir, daß sie sich freuen, hier in Beer Sheva Deutsch zu hören. Daß sie diese Sprache lernen, weil ihre Großeltern Deutsch gesprochen haben oder weil sie eine Weile in Deutschland leben wollen. Es ist erstaunlich, wie sich das gewandelt hat.
SZNURKOWSKI: Auch bei Ihnen gab es eine Phase der Abwendung von der deutschen Sprache.
NOLL: Ich habe erst 2000 wieder auf deutsch geschrieben, und zwar den Roman »Der Kitharaspieler«. Eine historische Geschichte, die im 1. Jahrhundert im alten Rom spielt. Ich habe versucht, das Buch in einer antikisierenden Sprache zu schreiben, und das konnte ich nur auf deutsch. Als wir nach Israel kamen, hatte ich eine starke Aversion gegen das Land, aus dem wir weggegangen waren. Meine Frau war seit 1994 nicht mehr in Deutschland. Ich fliege inzwischen regelmäßig hin, aber zunächst war auch ich zehn Jahre nicht dort. Unsere Bemühungen an der Universität, die deutsche Sprache wieder ins israelische Leben einzuführen, die Begegnungen mit den Studenten, die veränderte Haltung der israelischen Jugend – all das hat mich zur deutschen Sprache zurückgebracht. Auch als Schreibsprache. Heute bin ich froh darüber. Ich stehe in jener Lücke der deutsch-jüdischen Literatur, die durch die Shoah entstanden ist. Jemand muß die Stellung halten. Und es wird wieder viele deutsch-jüdische Autoren geben, denn inzwischen gibt es wieder viele Juden in Deutschland, und wo Juden sind, entsteht auch Literatur. Ich habe als Kind die Bücher der großen deutschsprachigen jüdischen Autoren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gelesen. Ein gewaltiges Erbe. Irgendwann habe ich begriffen, daß ich selbst in dieser Tradition stehe, und dann natürlich auch in der Sprache, in der ich aufgewachsen bin und in der diese Literatur lebte. Und hoffentlich fortbesteht.
SZNURKOWSKI: Ihr Roman »Die Synagoge« ist auch eine Auseinandersetzung mit nationaler und religiöser Identität. So sagt etwa die Figur Abi, daß er – im Gegensatz zu Heine – kein Problem damit habe, Jude zu sein. »Jude sein ist die wunderbarste Sache der Welt.«
NOLL: Für mich ist Judentum nicht nur eine Religion, sondern eine über mehrere Jahrtausende gewachsene Lebenshaltung, die weit über das Religiöse hin ausgeht. Sie hat zu einer besonderen Form des Menschseins geführt, zu besonderen Ausprägungen, besonderen Fähigkeiten, allerdings auch zu besonderen Schwächen. Wenn mein Protagonist sagt, für ihn sei es die wunderbarste Sache der Welt, Jude zu sein, dann heißt das nicht, daß auch alle anderen Menschen das so sehen, nicht mal alle Juden. Es gibt Juden, die nicht glücklich darüber sind, Jude zu sein, was ich persönlich nicht verstehen kann. Es gibt Menschen, die offen sagen, es bedeute ihnen nichts, es sei ihnen zu kompliziert. Ein Jude trägt immer mehrere Jahrtausende Geschichte mit sich herum. Daher das ständige Lernen und Studieren, auch in Form ritueller Handlungen, am Seder-Abend oder beim Laubhüttenfest. Jüdische Kinder wachsen im Bewußtsein einer uralten Vorgeschichte auf, einer starken Verbundenheit mit frühesten Menschheitskulturen. Sie erwerben Kenntnisse, die man anderswo an der Universität studieren muß. Biblische Geschichte ist Volks- und Landesgeschichte, dazu gehört auch Babylonien, das alte Ägypten, Griechenland, Rom. Um zu verstehen, was es heißt, Jude zu sein, muß ich tief in der Geschichte verwurzelt sein, daher unsere geradezu manische Erinnerungskultur. Wir leben zu einem großen Teil in der Erinnerung. Das macht uns allerdings nicht rückwärtsgewandt, sondern ist das Potential für die Fähigkeit, die Zukunft zu erkennen und mit der Gegenwart zurechtzukommen. Wenn man Jahrtausende im Bewußtsein hat, auch die Katastrophen, die Fehlentwicklungen, die Niedergänge, ist man natürlich im Hinblick auf die Schwierigkeiten des Lebens viel erfahrener als andere Völker, die zum Vergessen und Verdrängen neigen. Das ist der zweite Gesichtspunkt, der die Juden auszeichnet: Sie haben eine ungeheure Erfahrung im Überwinden katastrophaler Situationen. Ich habe vor Jahren in einem Interview gesagt, Juden seien geborene Spezialisten für den Katastrophenschutz. Für das Überleben hoffnungslos scheinender Situationen. Das kann kein anderes Volk so gut wie wir.
SINN UND FORM 5/2015, S. 657-667, hier S. 657-661
