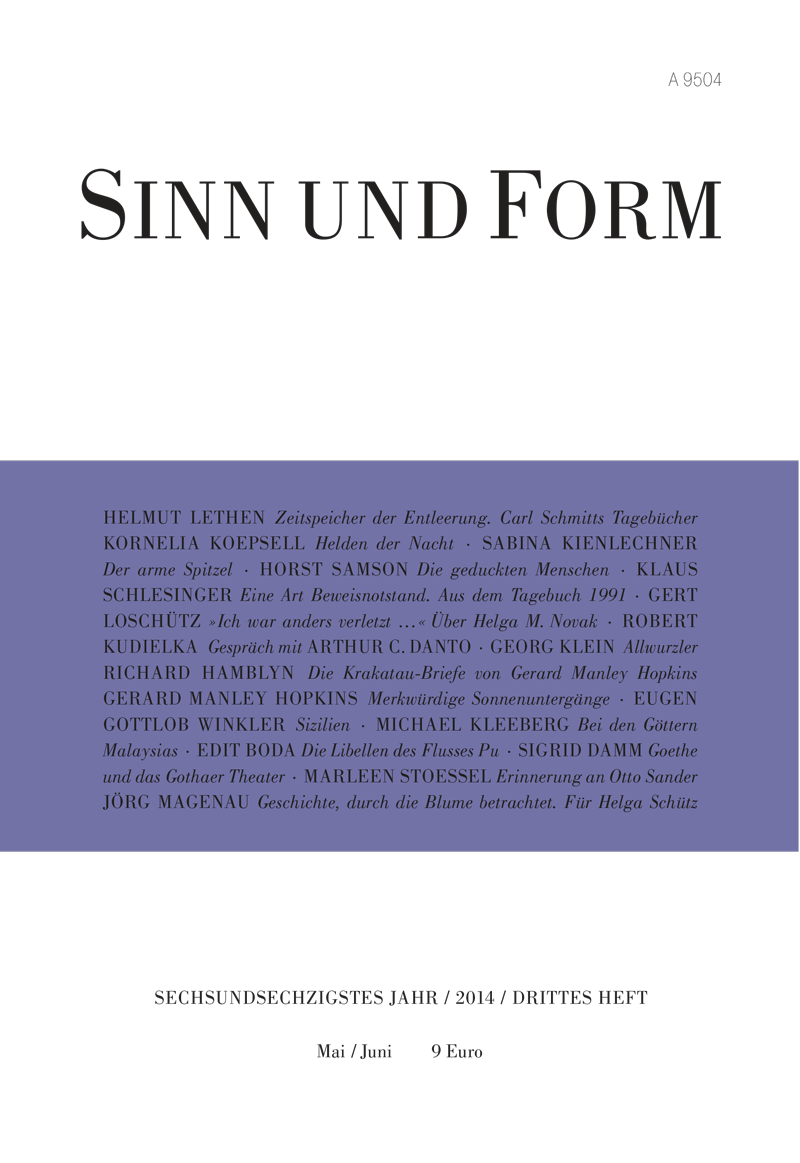Leseprobe aus Heft 3/2014
Schlesinger, Klaus
AUS DEM ARCHIV DER AKADEMIE DER KÜNSTE
»EINE ART BEWEISNOTSTAND»
Aus dem Tagebuch 1991
Vorbemerkung
Am 28. Oktober 1991 stand im »Spiegel« ein »Offener Brief an Sarah Kirsch, Jürgen Fuchs und Wolf Biermann«:
»Wenn schon, denn schon – ich war auch mal ein Spitzel! Die ‚Einsamkeit der weißen Weste’ paßt mir also nicht. Seit Posen/Ungarn (`56) war ich dagegen. Nicht gegen den Kommunismus, aber gegen die asiatische Despotie. Ohne Herkunft, Studentin vor dem Staatsexamen, liiert mit einem isländischen Studenten – war ich erpreßbar. Und ich unterschrieb, September `57. Ich wollte nämlich nicht, wie Erich Loest, sieben Jahre in Bautzen sitzen, wo mir, da ich keine Familie, gar keine Blutsverwandten hatte, niemand auch nur eine Schachtel Zigaretten gebracht hätte. Die Scham beißt ein Leben lang, aber sie ist auch eine energische Lehrerin. Ihr seid auch mal in der Partei gewesen, genau wie ich. Zwar habe ich mir erlaubt auszutreten, was damals (`57) noch verboten war, doch Komplizen waren wir alle. Das kriegt Ihr nie raus, was ich alles weiß, über Leute, mit denen wir befreundet sind. Und eher will ich im polnischen Wald verbluten, als mich auf einen deutschen Richterstuhl setzen.
Berlin, Helga M. Novak"
Gleichwohl muß die Autorin noch am selben Tag in einem Telefonat mit Sarah Kirsch ihr Schweigegelübde gebrochen und Namen genannt haben: falsche. Denn noch am 28. Oktober erhielt Klaus Schlesinger einen Anruf des Journalisten Jürgen Serke, und man verabredete sich für den 31., an dem die hier abgedruckten Seiten aus Schlesingers Tagebuch einsetzen. Sie führen uns in eine Debatte zurück, die im Sommer 1990 begann und in deren Verlauf viele, meist bekannte Künstler und Intellektuelle der DDR einander bezichtigten, nicht nur mit dem Unrechtsstaat kollaboriert, sondern auch für dessen Geheimdienstapparat gearbeitet zu haben. An Fällen wie Ibrahim Böhme und Sascha Anderson zeigt sich, daß es dabei durchaus nicht nur um individuelle Schuldfragen, sondern um die politische Deutungshoheit über die Rolle von Literatur, Kunst und Kultur in der DDR ging. So überrascht es kaum, daß die Situation oft auch zur Austragung privater Fehden genutzt wurde und sich erneut bestätigte, wie eng das Politische und das Private miteinander verwoben sind. Mit einem solchen Fall haben wir es hier zu tun.
Klaus Schlesinger (1937-2001) war während und nach der Wende weder ein Advokat der schnellen Wiedervereinigung noch einer der pauschalen DDR-Verdammung. Zwar hatte auch er, wie viele seiner Kollegen und Freunde, den Staat als Dissident verlassen, weil sein Ausschluß aus dem Schriftstellerverband im Sommer 1979 einem Berufsverbot gleichkam, doch er bestand darauf, nie im Westen angekommen zu sein, und gehörte zu den ganz wenigen Ausgereisten, die ihre Staatsbürgerschaft bis zum Ende beibehielten. »Ich setze meinen Fuß in die Tür eines Hauses, in dem ich mich nicht niederlassen will«, hatte er im März 1980 beim Umzug nach Westberlin notiert. Er versuchte sich die DDR als Projektionsfläche für soziale Utopien zu erhalten, beteiligte sich in Westberlin aber auch aktiv an sozialen und politischen Initiativen, namentlich an der Friedensbewegung und der Hausbesetzerszene sowie an linken Publikationen wie der »literataz«. Fast zehn Jahre lang –also noch im Herbst und Winter 1991 – wohnte er in einem der besetzten Häuser in der Potsdamer Straße, der »Potse«. Zunächst indes hatte er mit Hilfe von Sarah Kirsch eine Wohnung in Charlottenburg gefunden, in dem Haus, in dem sie mit ihrem Partner lebte. Dort lernte er auch Helga M Novak kennen, die seit ihrer gemeinsamen Zeit am Leipziger Literaturinstitut mit Kirsch befreundet war. Sie war 1966 exmatrikuliert worden und kurz danach ausgereist. Schon zehn Jahre vor Biermann hatte man ihr »wegen Verbreitung regimekritischer Texte« die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie hatte in Island und in Westdeutschland gelebt und war erst kurz vor Schlesinger nach Westberlin gezogen. In seiner Chronik »Fliegender Wechsel« (1990) vermerkte er: »Erster Eindruck: Schwierige, harte Frau, extrem im Verbalen, achtete auf jeden Satz, kritisierte mich einmal scharf für eine Großkotzigkeit (…). Zweiter Eindruck (…): lebendige, anziehende Frau, in Gefühlsdingen absolut und mit aufregender Biographie. Ich hätte stundenlang zuhören können. Und streiten. Sentenz, auf einer Gitanesschachtel notiert: Liebe erklärt man wie Krieg.«
Ihre Beziehung gestaltete sich in der Tat turbulent und endete im September 1982 mit einer ungewöhnlich bitteren Trennung: »Gebrüll, Vorwürfe auf beiden Seiten; der Gipfelpunkt war ihr Satz: (…) Ich werde mich fürchterlich an Dir rächen! – ich brülle zurück, daß es mir nichts ausmacht und daß sies eben machen soll, und daß ich auf solch einem Niveau nicht mehr mit ihr rede (…). Es hat sich schon einmal einer an mir gerächt aus dem einfachen Grund, daß ich unser Verhältnis verlassen habe und nicht er, und er hat es auf eine gemeine Weise getan: Thomas Brasch mit seiner Stasilüge.« (Tagebuch 13.8.–13.9.1982. AdK, KSA, 143) Schlesinger konnte damals noch nicht ahnen, daß sie ein Gleiches tun würde, allerdings zu einem Zeitpunkt, als eine solche Unterstellung auf weit fruchtbareren Boden fiel: im Herbst 1991.
Die Gerüchteküche kam sofort auf Hochtouren, ein Gegenmittel gab es nicht. Besonders perfide war für Schlesinger, daß weder Sarah Kirsch noch Helga M. Novak sich öffentlich äußerten und er somit auch nicht öffentlich widersprechen konnte ("Nachher stehe ich mit einem Verleumdungsprozeß am Hals da!«). Die »Neuigkeit« verbreitete sich so subkutan wie wirkungsvoll. Im November untermalte Wolf Biermann einen an mutmaßliche Stasi-Spitzel adressierten Abschnitt seiner Mörike-Preisrede mit der Bemerkung »Nicht wahr, lieber Klaus?« Einige Journalisten behandelten Schlesinger wie einen erwiesenen Stasi-Mitarbeiter, Karl Corino fand in seinen Texten plötzlich deutliche Hinweise auf eine solche Verstrickung. Man forderte ihn zu Stellungnahmen auf und ermunterte andere Autoren wie Lutz Rathenow zu »Enthüllungen« über ihn. Bereits angenommene Rundfunkmanuskripte wurden vorerst nicht produziert.
Noch am 28. Oktober schrieb er an Sarah Kirsch und nach einigem Zögern auch an Helga M. Novak: »Liebe Helga, ich weiß nicht, ob Du nun Opfer einer Halluzination geworden bist oder was Dich sonst bewogen haben mag, Sarah gegenüber zu behaupten, ich hätte Dir einst eine Stasi-Mitarbeit ‚gestanden’ (…). Was ich aber weiß: daß Du, auch um deinetwillen, ganz schnell aktiv werden und Deine Phantasmagorie aus der Welt schaffen solltest. Schreib Sarah oder besser: Ruf sie an und dementiere den Quatsch!« Sarah Kirsch hatte er aufgefordert, ihn, wenn schon, wenigstens öffentlich zu beschuldigen, »damit ich endlich Gelegenheit bekomme, diese ganze schmutzige Sache vor einem Gericht zu klären«. Da keine von beiden reagierte, war ihm diese Möglichkeit versagt, und seine Entwürfe für einen »Offenen Brief in die polnischen Wälder« blieben in der Schublade. Seine Entlastung hing von den schleppenden Nachforschungen der Gauck-Behörde ab: »Absurde Situation, in der ich, eben noch Betroffener, mich als (potentieller) Täter überprüfen lassen muß.« (Tagebuch 20.12.1991-1.2.1992, Heft 2, AdK, KSA 171)
Die Qual des Wartens spricht nicht nur aus seinen Tagebuchnotizen, sondern auch aus der Korrespondenz seines Anwalts Hans-Christian Ströbele mit der Gauck-Behörde. Dessen drängende Anschreiben, stets mit der Bitte um schnelles Handeln, wurden wie in Amtsstuben üblich bearbeitet: Zunächst wurde auf die Menge derartiger Anfragen und die zu erwartende Bearbeitungsdauer verwiesen, dann wurden immer wieder neue Angaben eingefordert. Und natürlich mußte Ströbele »glaubhaft machen, daß die beantragte Auskunft zur Abwehr einer gegenwärtigen und drohenden Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Herrn Schlesinger unerläßlich und unaufschiebbar ist«.
Das gelang schließlich, unter anderem durch ein Schreiben des Journalisten Hans-Georg Soldat, der die Existenz und das Diffamierende des Gerüchts bestätigte. Der erlösende Brief der Gauck-Behörde datiert vom 15. Januar 1992 (ein gleichlautendes Telefonat hatte es bereits zwei Tage vorher gegeben). Nun erst, da die Anschuldigung amtlich widerlegt war, konnte sich Schlesinger öffentlich dazu äußern. Unter dem Titel »Ich gestehe! Ich verlange!« beschrieb er in der »Zeit« vom 14. Februar 1992 das ihm Widerfahrene als Rufmord und skizzierte den äußeren Ablauf des Geschehens, die Reaktionen von Kollegen, die sich bis dato Freunde genannt hatten, sowie seinen eigenen Umgang mit der Situation. Ihm lag vor allem daran, die existenzvernichtende Wirkung solcher Verleumdungskampagnen zu zeigen. Später wurde daraus der Text »Das Gerücht«, den er in den Essayband »Von der Schwierigkeit, Westler zu werden« (1998) aufnahm. Der Titel verweist auf die gleichnamige Grafik von A. Paul Weber, auf der eine Schlange an den unzähligen Fenstern eines Häuserblocks vorbeihuscht und in jedes etwas hineinraunt, während ihr Schwanz zu monströser Größe anwächst.
Eine der schlimmsten Erfahrungen dieser zweieinhalb Monate war, daß Schlesinger sich auf seine Menschenkenntnis nicht mehr verlassen konnte und Vertrauen zum Fremdwort wurde. Freunde und Kollegen, die er gut zu kennen geglaubt hatte und die auch ihn gut genug hätten kennen sollen, um zu wissen, wie absurd die Anschuldigung war, hielten es plötzlich nicht mehr für unmöglich, daß er doch »dabeigewesen« sein könnte. Mochte dies nach mehreren spektakulären Enttarnungen verständlich sein – die Staatssicherheit gewann dadurch nachträglich größere Macht über die Betroffenen, als diese ihr selbst zugebilligt hatten. Was folgte, war eine regelrechte Hetzjagd, die fälschlich Beschuldigten das Leben zur Hölle machte. Schlesinger hatte zeitweise Angst, aus dem Haus zu gehen, nicht nur wegen aufdringlicher Journalisten, sondern auch weil er befürchten mußte, bestimmte Freunde oder Kollegen zu treffen. Das galt natürlich nicht für jeden: Ulrich Plenzdorf glaubte von den Anschuldigungen kein Wort, Friedrich Dieckmann hielt sie für aberwitzig, desgleichen Bettina Wegner ("Tina«, »T«), Kurt Bartsch und Irene Böhme, Inge und Stefan Heym, Adolf ("Eddy«) und Brigitte Endler. Keine drei Wochen nach seiner offiziellen Entlastung durch die Gauck-Behörde saß er denn auch mit diesen Freunden im ehemaligen Stasi-Hauptquartier in der Normannenstraße und arbeitete sich durch die zahllosen Ordner seiner Opferakte. Gegen Ende seiner fast vierzig Seiten umfassenden Notizen dazu findet sich eine Art Zusammenfassung der Eindrücke: »Wahrnehmung der Stasi: Roman, der das Wesen der Figuren nicht getroffen hat. Trivialroman. Sprache – selektives Denken/selektive Sicht – Verstärkung dessen, was man zu sehen glaubt bzw. sehen will. (…) Die IMs: Die Gruppe derer, die wir sowieso im Verdacht hatten bzw. zu denen wir kein Vertrauen hatten. Dann die, bei denen ich es nicht erwartet hätte. Die beiden Gruppen ebenfalls unterschiedlich. Zu ‚Kurt’ und ‚Pedro’ werde ich weiterhin Beziehungen haben. ‚André’, der sich durch die Akte zieht, habe ich damals weder als Schriftsteller noch als Mensch ernsthaft wahrgenommen. (…) Mit ‚Büchner’ werde ich bestimmt irgendwann reden, und es wird kein rücksichtsvolles Gespräch werden. (…) Opfer/Täter: Nein, ich war kein Opfer, ich war Täter. Ich habe mich doch entschieden, etwas zu tun.« Auch diese Auseinandersetzung brachte er in einem »Zeit"-Artikel zum vorläufigen Abschluß ("Ich war ein Roman«, 17. April 1992).
Auch wenn diese Monate nach Schlesingers Aussage für größere literarische Projekte zu schnellebig und zu aufwühlend waren ("Keine Zeit für Erzählthemen. Nicht mal für Gedanken darüber«), brachten sie doch etliche Ideen, die sich später als produktiv erweisen sollten. Und sie verstärkten einen für Schlesinger ohnehin typischen Zug: Geschichtserzählung ist bei ihm ein behutsames Tasten nach Erinnerungen, ein Bewußtmachen ihrer Tücken, eine fortwährende Suche nach der historischen Wahrheit, geleitet von Vorsicht vor übereilter Verurteilung anderer und der Suche nach der eigenen historischen Schuld. In seinem 1996 erschienenen Roman »Die Sache mit Randow« sollte diese Art des Nachdenkens über Geschichte zu einem neuen Höhepunkt finden.
In Schlesingers Nachlaß im Archiv der Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz liegt ein gutes Dutzend Tagebücher aus verschiedenen Lebensabschnitten, schmale schwarze Hefte, in enger Handschrift beschrieben. Manche davon hat er abgetippt oder abtippen lassen, weil er sie für mehr als bloßes Rohmaterial und (nach leichter Überarbeitung) für publizierbar hielt. Die 1990 veröffentlichte Chronik seines Umzugs nach Westberlin etwa, »Fliegender Wechsel«, ist auf diese Art zustande gekommen. Auch die hier abgedruckten Seiten hatten für ihn diese Qualität. Denn was sich weder in den erwähnten Artikeln in der »Zeit« noch in seinen in dieser Situation konzipierten Erzähltexten wie dem »Randow« findet, sind die Unmittelbarkeit und Intensität des Erlebten, die aus diesen Notizen sprechen. Nirgends sonst bekommt man die emotionale Wucht, das Aushaltenmüssen der Verletzung und die Härte der seelischen Belastung, die mit der Beschuldigung einhergehen, so akut wie auf diesen Seiten zu spüren. Und nirgends sonst läßt sich der Prozeß der literarischen Ideenfindung so gut nachvollziehen wir hier. Es ist im übrigen nicht das einzige Kleinod, das noch aus dem Nachlaß zu heben wäre.
Astrid Köhler
[…]
SINN UND FORM 3/2014, S. 323-343, hier: S. 323-326