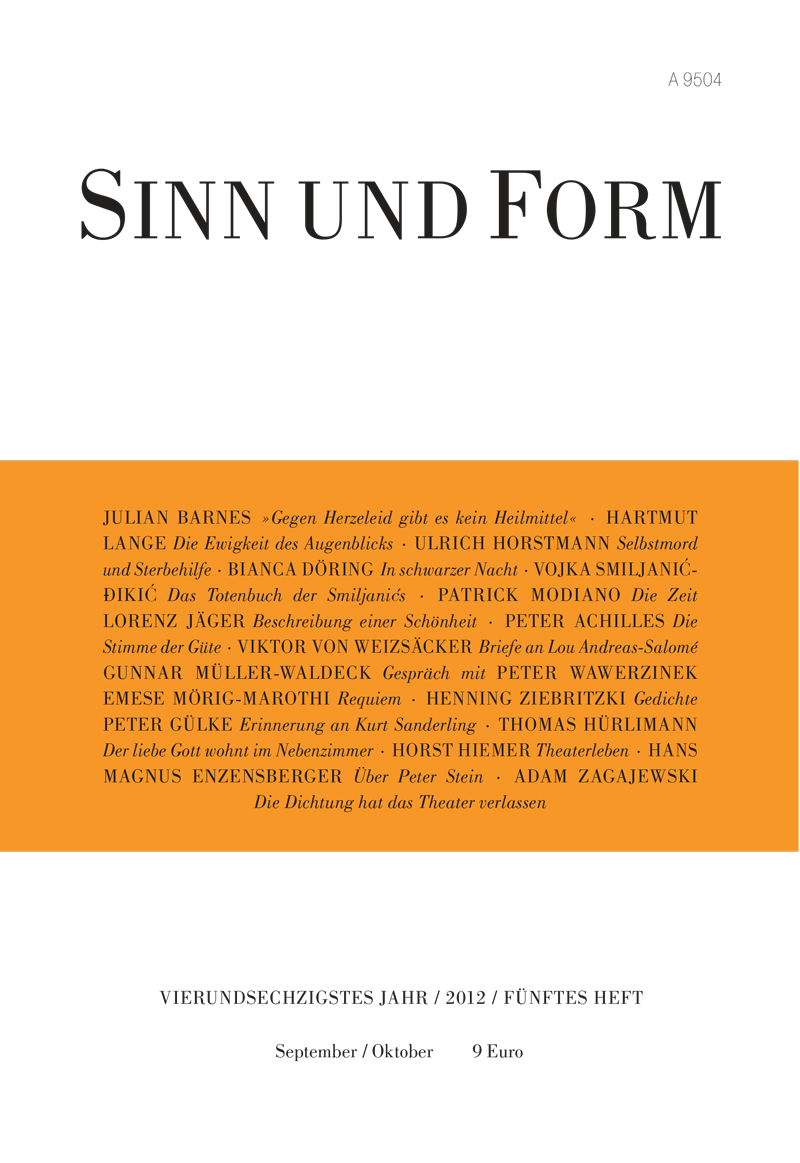
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-07-2
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 5/2012
Hiemer, Horst
THEATERLEBEN
Geschichten und Erfahrungen
Aus dem Deutschen Theater
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versachlichte sich die Theaterarbeit. Auch die Bühnenbilder änderten sich, und der Souffleurkasten, der kleine Hügel in der Mitte des Proszeniums, Relikt des alten Hoftheaters, angestammter Platz der Souffleuse, er verschwand. Sie saß nun, je nach Bühnenbau, in der Gasse neben dem Feuerwehrmann, in der Seitenloge oder sogar in der ersten Reihe.
In den sechziger Jahren inszenierte Benno Besson am Deutschen Theater Sophokles’ »Ödipus, Tyrann« in einer Neuübersetzung von Heiner Müller. Es war die erste Probe, die sogenannte Konzeptionsprobe, eine theoretische Übung. Und Besson erläuterte, wie das Regieteam in den schwierigen Vorbereitungen auf diese Arbeit noch die ganze letzte Nacht hindurch geschuftet hätte, um die für die Aufführung gültige Fabel zu formulieren, was ja bedeutete, sich über die Sicht auf das Stück zu einigen.
Dann folgten von seiten der Regie, des Bühnenbildners und der Dramaturgen Erläuterungen über die Literatur und Philosophie der Antike, über die Antike schlechthin und die Weltgeschichte überhaupt. Eine Flut gesammelten Wissens. Und nachdem die Schauspieler alles über Sophokles, Marx, die griechischen Philosophen, das Schicksal des Menschen, die Weltordnung und die gegenwärtige Politik gehört hatten, saßen sie stumm da, von soviel Wissenskraft wie erschlagen. Obendrein wurden sie nun aufgefordert, ihre Meinung zu sagen. Es entstand eine lähmende Pause. Bis endlich – zur Freude von Besson – Fred Düren, auf den eine Riesenrolle mit langen Textpassagen wartete, er sollte den Ödipus spielen, bis Düren also den Finger hob und sagte: »Eine Frage, Benno. Wo sitzt die Souffleuse?«
***
Schon auf der Konzeptionsprobe kündigte Besson an, daß Reiner Bredemeyer die Musik zur Inszenierung schreiben werde; sämtliche Chöre der Thebaner würden durchkomponiert. Die Proben begannen ohne Musik. Wochen vergingen, und keine Noten waren zu sehen. Besson mahnte. »Brede, wir können ohne Musik die Chöre nicht erarbeiten.« Die Zeit drängte, Besson drängte. Wieder verging eine Woche. Besson stellte ein Ultimatum. Und Bredemeyer versprach für den nächsten Vormittag die Musik.
Große Spannung am nächsten Morgen. Gegen elf Uhr wurde die Bühne geräumt, ein Klavier in die Mitte geschoben. Bredemeyer erschien. Zum allgemeinen Erstaunen ging er jedoch nicht zum Klavier, sondern verschwand sogleich, um irgendwas auf der Hinterbühne zu suchen. Nach einer Weile sah man ihn wieder, wie er einen Zementblock mit Eisenhenkel heranschleppte, den die Bühnenarbeiter zum Beschweren von Versatzstücken verwendeten. Noch immer ging er nicht ans Klavier. Er schob den Block an die Rampe, kramte in seiner Jacke einen U-Bahn-Fahrschein hervor, starrte, kurzsichtig wie er war, lange darauf, sang zwei, drei seltsame Töne, hob den Block empor und ließ ihn krachend niedersausen. Dann steckte er den Fahrschein wieder in die Jacke, kam nach unten und setzte sich.
Besson, der schon einiges Absonderliche in seiner Theaterpraxis erlebt hatte, war baff. »Brede, ist das alles?« Bredemeyer nickte. Das war alles. Denn was er da vorgeführt hatte, war der wunderbare Grundrhythmus für die Trommeln, die in dieser Inszenierung den Chor führten und die Aufführung begleiteten.
***
Später gastierte das Deutsche Theater mit »Ödipus, Tyrann« in Zürich. Aus politischen Gründen erlaubten die DDR-Behörden nicht, die Bundesrepublik zu überfliegen. Obgleich Devisen knapp waren, flogen wir den Umweg über Wien. Dort bestiegen wir eine kleine Swiss-Air-Maschine, die uns schließlich nach Zürich brachte. Auf dem Wiener Flugplatz sah man riesige Reklametafeln – Swiss-Air sei eine einzigartige Fluglinie, Swiss-Air hätte alles an Bord, was man sich nur wünschte. Klaus Piontek, immer vornweg mit seinem Temperament, winkte während des Flugs eine junge Stewardeß heran. »Sagen Sie, gnädiges Fräulein, man liest hier dauernd die Reklame, Sie hätten alles an Bord?« – »Ja, das ist wahr.« Animiert von ihrer Schönheit, fragte er frech: »Haben Sie auch Präservative?« Und sofort antwortete das Mädchen im schönstem Schweizerisch: »Nein, mein Herr, wir sind ein Kurzstreckenflugzeug.« Ich habe nur einmal in meinem Leben Klaus Piontek perplex erlebt, das war in diesem Augenblick.
***
Nach der Absetzung von Wolfgang Langhoff inszenierte der neue Intendant Wolfgang Heinz in den sechziger Jahren am Deutschen Theater den Hamlet. Die Inszenierung gefiel uns nicht. Damals gefiel uns eigentlich überhaupt nichts, außer Brecht. Horst Drinda war Hamlet. Er gefiel uns auch nicht. Wir meinten, er sei eine Fehlbesetzung, zu alt, und in seiner Spielweise das größte Übel. Eberhard Esche war Fortinbras, ich spielte den ersten Schauspieler. In Halle hatte ich bereits den Romeo gespielt, und ein Kritiker schrieb, das sei kein Romeo, das sei eher ein Hamlet. Sicher wollten wir beide, ohne es uns einzugestehen, den Hamlet spielen. Vielleicht wollten wir auch die Tradition der Spaßmacher, der witzigen Vorfälle aus der Geschichte des Deutschen Theaters, die uns die Alten überlieferten, fortsetzen. Jedenfalls waren wir beide uns einig, daß irgendwas geschehen mußte. Nur was? Nach längerer Beratung kamen wir auf die Idee, am Schluß der Hamlet-Premiere an der Max-Reinhardt-Büste auf dem Vorplatz des Theaters einen Kranz niederzulegen, der das ganze Unternehmen lächerlich machen sollte.
In einem Brief bat ich meine gebrechliche Großmutter, wohnhaft in Altenburg in Thüringen, in ein Beerdigungsgeschäft zu gehen und eine mit Goldlettern bedruckte Kranzschleife mit folgender Aufschrift zu bestellen: »Dank Dir! Horst Drinda, Nationalpreisträger«. Das Wort Nationalpreisträger ganz unten, klein, aber doch auffällig.
Die Premiere nahte. Wir hatten den schönen Plan fast vergessen, da erhielt ich von meiner wunderbaren Großmutter ein Päckchen mit der gewünschten Schleife. Und wir besorgten einen Kranz. Unweit des Deutschen Theaters befand sich die jugoslawische Botschaft. Ständig patrouillierten Volkspolizisten in dem Terrain. Das Niederlegen des Kranzes erwies sich als schwierig, aber zwischen dem Auftritt des Fortinbras am Ende des Abends und meinem mit der Ankunft der Schauspieltruppe in der Mitte des Stücks war genügend Zeit. Wir hockten also in den Büschen, bis sich eine günstige Gelegenheit bot, und legten den Kranz an die Stele.
Nun begann das Debakel. Mit Premierenschluß, nach gewohnt langem Applaus, verließ die Masse der Zuschauer das Theater. Der Vorplatz wurde zu diesem Zeitpunkt immer von mehreren Scheinwerfern erleuchtet, ein Extrascheinwerfer war auf Max Reinhardt gerichtet. Vor der Stele bildete sich eine Menschentraube, es begannen Diskussionen. Die Leute waren sich uneinig. Ein Teil fand den ehrerbietigen Gruß an den Ahnherrn des Theaters hoch anständig; ein anderer mokierte sich und fragte, in welcher Weise denn Reinhardt Anteil an der Inszenierung gehabt hätte und wie er denn Drinda bei der Erarbeitung der Rolle hätte helfen können. Einig aber war man sich darin, daß der Nationalpreisträger dort nichts zu suchen hätte, das sei geschmacklos.
Ansammlungen von Bürgern wurden in der DDR als hochgefährlich betrachtet. Standen mehr als drei Leute beisammen, galt das als Gruppenbildung. Der Kranz wurde also schleunigst requiriert und in der Pförtnerloge verstaut. Die Premierenfeier begann. Esche und ich betraten siegessicher das Kellerrestaurant. Das Geschehnis war in aller Munde, doch sehr bald begriffen wir, welchen Skandal wir heraufbeschworen hatten. Es wurde berichtet, daß man schon eifrigst nach den Tätern fahnde, die Kriminalpolizei sei bereits eingeschaltet. Wir, die wir uns im Vorgefühl des großen Spaßes als tolle Witzbolde gefeiert wähnten, wurden leichenblaß und hielten die Klappe. Jede Aufdeckung hätte unsere fristlose Entlassung bedeutet. Und dabei hatten wir doch gerade erst am Theater angefangen.
Frühmorgens legte ein Unbekannter den Kranz vor die Tür des Intendantenbüros. Neuerliche Verwirrung. Wolfgang Heinz, dem man den Vorfall bislang verschwiegen hatte, kam wie immer pünktlich zur Arbeit, sah das Corpus delicti, meinte, mit der Aufschrift »Dank Dir! Horst Drinda, Nationalpreisträger « sei er gemeint, war erst erstaunt, dann empört und vollführte eine solch gewaltige Stimmübung, daß der Stuck von der Decke fiel.
Die kriminalistischen Untersuchungen und auch die Nachforschungen der Staatssicherheit dauerten Wochen. Im Abschlußprotokoll wurde den Mitgliedern des Hauses verkündet, es hätte sich um einen Anschlag des Gegners gehandelt. Nach umfassenden Ermittlungen habe sich eindeutig erwiesen, daß die Kranzschleife nicht im Osten hergestellt wurde, sondern in Westberlin, auf dem Territorium des Klassenfeinds.
***
Wie Wahlen in der DDR abliefen, daran wird sich noch mancher erinnern. Ein ausgeklügeltes Ritual. Man wurde aufgefordert, offen vor allen zu wählen. Das Betreten der Wahlkabine galt schon als konterrevolutionärer Akt. Oft lagen dort nicht einmal Stifte. Die Parteien standen, brüderlich vereint, auf einer gemeinsamen Liste. Sie hieß »Die Kandidaten der Nationalen Front«. Die Wahlmöglichkeiten waren so beschränkt wie das Warenangebot in den Läden. Das Ergebnis waren meist 97 oder gar 98 bis 99 Prozent Ja-Stimmen. Wahrscheinlich genau der Bevölkerungsanteil, der grundsätzlich nur Westfernsehen sah. Bewußt gesteuerte Unklarheit herrschte darüber, was man mit dem Wahlzettel anstellen mußte, damit er als Gegenstimme gewertet wurde. Fred Düren betrat das Wahllokal, nahm die Unterlagen zur Hand, studierte die Namen, faltete sorgsam seinen Zettel, hob ihn in die Höhe, steckte ihn für alle sichtbar in die Pappurne, ging betont feierlich zum Tisch des scharf beobachtenden Vorstands und sagte besorgt, indem er sich vertrauensvoll zum Wahlleiter hinabbeugte: »Hoffentlich gewinnen Unsere.«
[...]
SINN UND FORM 5/2012, S. 694-710
