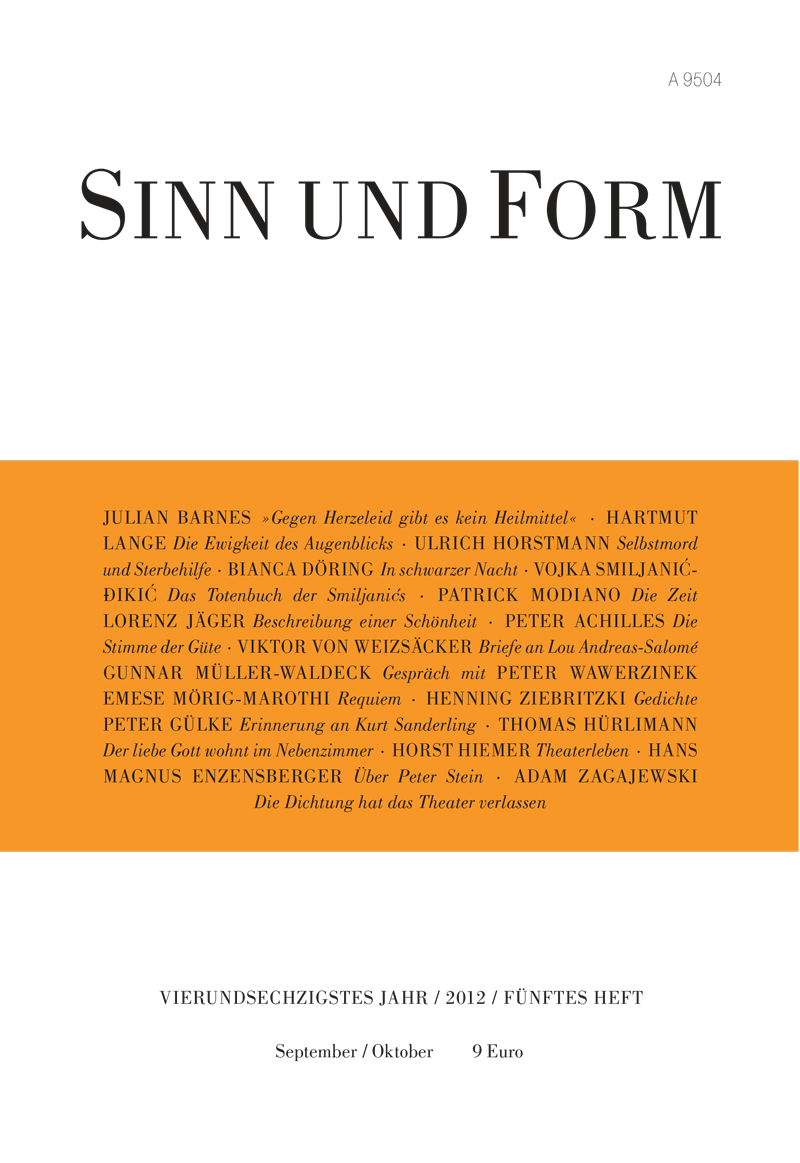
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-07-2
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 5/2012
Horstmann, Ulrich
WIDER DAS HERUMDOKTERN AN DEN NOTAUSGÄNGEN
Selbstmord und Sterbehilfe. Eine Polemik
Nach knapp zwei Jahrtausenden scheinen wir angesichts der offenbar unausrottbaren menschlichen Neigung, die biologische Aufenthaltserlaubnis vorzeitig zurückzugeben, wieder bei der stoischen Liberalität eines Seneca angekommen zu sein. Inzwischen verbietet den Advokaten des selbstbestimmten Todes niemand mehr den Mund. Sie haben uneingeschränktes Rederecht; Gebrauchsanleitungen zum Selbstmord werden im Buchhandel vertrieben oder sind per Internet abrufbar, Organisationen wie EXIT oder DGHS können medienwirksam für ihre Sache eintreten. Warum sich also die Stunde des Triumphs vergällen und noch einmal polemisch das Wort ergreifen, nachdem von einem Montaigne, Hume, Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche, einem Jean Améry, Hermann Burger und E.M. Cioran alles auf das eindrücklichste gesagt und geklärt worden ist? – Weil die Bevormunder keineswegs die Segel gestrichen haben, die Roßkuren für Lebensmüde mitnichten ad acta gelegt sind. Und weil auch Zeitlupenpendel die Eigenschaft besitzen, zurückzuschwingen.
Die Wissenschaft ist, Gott sei’s geklagt, gegenüber dem Suizid jedenfalls ebenso verständnislos, ebenso hartherzig und kaltschnäuzig wie die Theologie. Zur Veranschaulichung der in der aktuellen Forschung herrschenden Ignoranz zwei schlagende Beispiele. Wie definiert der Fachmann das Krankheitsbild, das einen Suizidversuch auslöst? Wir greifen nach dem Besten, was der Markt zu bieten hat, dem von Keith Hawton und Kees van Heeringen herausgegebenen »International Handbook of Suicide and Attempted Suicide«. Hier findet sich die Diagnose »terminal malignant alienation«. Sie macht Eindruck, weil sie offenbar in Anlehnung an onkologische Vorgaben, also den »terminal malignant tumor«, formuliert worden ist. Trotzdem tendiert der Erkenntniswert gegen Null und ist jenem der ironischen Einlassung des Berliner »Milljöh"-Zeichners Heinrich Zille, die Armut komme von der Poverté, kaum überlegen. Imponiervokabeln ersetzen auch hier die Einsicht und verschleiern das schlicht Tautologische von ›bösartiger Entfremdung im Endstadium‹ und Existenzabbruch. Zum zweiten geht in die Pseudo-Ätiologie eine Unterstellung ein, die der christlichen Behauptung, Selbstmord sei Sünde, an Dogmatik und Basta-Mentalität in nichts nachsteht, nämlich die, daß es sich beim Suizid um die Folge einer (psychischen) Erkrankung handle. Der so ganz selbstverständlich Pathologisierte sieht sich erneut seines Selbstbestimmungsrechts und seiner Rationalität beraubt und statt in das Büßergewand des Gottesfernen in die längst pharmazeutisch entstofflichte Zwangsjacke des Psychiatriepatienten gesteckt. Aus dem furor diabolicus der mittelalterlichen Seelsorge ist damit unter der Hand der furor therapeuticus ihrer säkularen Nachfolgeinstitution geworden. Alles hat sich geändert – und nichts ist anders geworden.
Einem kahlköpfigen Friseur, lautet eine scherzhaft verpackte Lebensweisheit, kann man die Wirksamkeit der von ihm angepriesenen Haarwuchsmittel nicht glauben. Er handelt bei seiner Werbekampagne offenbar weniger im Interesse der Kundschaft als in dem seines Geldbeutels. Aber nicht nur dieser Geschäftsmann hat eine Glatze; die auf Selbstmordverhütung eingeschworenen Experten laufen mit dem gleichen Makel und Handicap herum. Die Statistik zeigt unmißverständlich: Psychiater weisen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung ein um den Faktor sieben erhöhtes Selbstmordrisiko auf. Das läßt weder ihre Problemeinsicht noch ihre Behandlungskompetenz in einem sonderlich vorteilhaften Licht erscheinen. Es gibt sogar einige schwarze Schafe im Metier, die von einer Art Nullsummenspiel ausgehen, das heißt ihrer Disziplin unterstellen, sie treibe für jeden geretteten Suizidanten einen anderen Menschen in den Selbstmord, der ohne ihre Intervention nicht Hand an sich gelegt hätte. Ein entsprechender Verdacht kann sich zum Beispiel auf den irritierenden Befund berufen, daß Antidepressiva wider Erwarten keinen Beitrag zur Senkung der Suizidhäufigkeit geleistet haben. Da das medizinische Modell Depression als einen der Hauptauslöser von Selbsttötungsimpulsen identifiziert, hätte das Gegenteil eintreten müssen. Die einzig plausible Erklärung ist das Eingeständnis von ›Kollateralschäden‹, das heißt unerwünschten Nebenwirkungen des verschriebenen Heilmittels, oder drastischer, die Auslösung des fatalen Ereignisses durch den Versuch, es zu verhindern. Für die Suizidprävention durch eine geradezu paramilitärisch organisierte Überwachung von Risikogruppen oder die Zwangseinweisung nach Selbstmordversuchen – CPSP (Coercive Psychiatric Suicide Prevention) – gilt das gleiche wie für die Medikation: Trotz des hohen personellen und finanziellen Aufwands ändern alle drei Interventionsverfahren nichts an der über Jahrzehnte und Generationen erstaunlich konstanten Zahl von Todesfällen.
Mit anderen Worten, die ihn krank schreibende Disziplin ist hilflos gegenüber dem Selbsttödler – so die ironische Begriffsprägung Hermann Burgers – und richtet, nicht anders als die vorwissenschaftliche Heilslehre des Christentums, mit ihrem Aktionismus mehr Schaden an, als sie Gutes tut. »Kein Therapeut«, schreibt etwa Thomas Bronisch, »kann einen Patienten langfristig von einem Suizidversuch oder Suizid abhalten. Der Therapeut muß mit der Kränkung fertig werden, daß er nicht um jeden Preis Leben erhalten kann.« Das liegt nicht zuletzt an der diffusen Phänomenansprache. Wie der Laie, dem wir das vielleicht noch durchgehen lassen, sieht sich die Psychologie und Psychiatrie nämlich außerstande, den Selbstmörder im Vorfeld seiner Tat eindeutig zu identifizieren. Den vom nahen Ende gezeichneten Krebspatienten erkennt keineswegs nur der Onkologe auf den ersten Blick, und bei den meisten anderen Todkranken ist das genauso. Der Terminator seiner selbst aber erweist sich als bestens getarnt, er bewegt sich unter Lebensfrohen wie ein Fisch im Wasser und ist oft bis auf Stunden, bis auf Minuten, ja vielleicht sogar Sekunden vor dem Ausstieg nicht von den ›Normalen‹ zu unterscheiden. Wie erklärt sich diese psychologische ›Unschärferelation'? Durch zu grobe, gegenstandsfremde und falsch kalibrierte Beobachtungsverfahren? Nur zum Teil, denn der Vergleich mit Heisenbergs aus der Quantenmechanik abgeleitetem Theorem trägt noch weiter. Das Teilchen selbst verhält sich unberechenbar genau wie der Suizidant.
Bis zum letzten Augenblick ist er hin- und hergerissen zwischen der stärksten uns von der Evolution eingepflanzten Kraft, dem Selbsterhaltungstrieb, und dem im geheimen über Wochen, Monate, Jahre mit Negationsenergie aufgeladenen Gegenprinzip des Todeswunsches und Willens zum Ende. Gegen die biologische Urgewalt, die uns am Leben hält und ans Leben kettet, hat auch Verzweiflung nur dann eine Chance, wenn sie geballt auftritt, das heißt punktuell angreift und sich gleichsam explosionsartig an einem Tiefpunkt der Vitalitätskurve entlädt. Ob und wann der erreicht ist, entscheidet die Intuition des Aufopferungsbereiten, dessen »Jetzt!« folglich mit den behavioristischen oder anderen berechnenden Persönlichkeitsmodellen der ›Seelenkunde‹ nicht einholbar ist. Es gehört zur Definition des Selbstmörders, daß er sich außer Reichweite der Rachegelüste weltlicher und geistlicher Machthaber, der Rehabilitationsprogramme und Fitneßkuren der Medizin befindet und daß ihn die Krankheitsbilder und Definitionen, für die er und seinesgleichen die Datenbasis abgeben sollen, verfehlen. Deshalb sind die Theologen, die Juristen, die Therapeuten allesamt arm dran. Es gibt keinen, sei es mit geringem, sei es mit hohem Aufwand identifizierbaren Selbstmördertyp. Man schnüffelt, befragt, läßt berichten, man entwirft Täterprofile und schult menschliche und unmenschliche Spürhunde. Und dann ist der nächste, der sich davonmacht und ontologische Republikflucht begeht, der Kollege.
Wenn es Anzeichen für die wachsende Bereitschaft zum Geltenlassen, für die Auflösung des Engstirnigen ins Großherzige gibt, dann kommen diese Impulse nicht aus den Kernbezirken der Suizidologie und schon gar nicht aus dem psychiatrischen Alltag, sondern von Fachvertretern, die lebensgeschichtlich gleichsam Hautkontakt hatten mit dem Sog ins Nichts, weil sie selbst in suizidalen Episoden am Tod vorbeigeschrammt sind oder es in ihrer Familie oder dem engsten sozialen Umfeld einen Fall von Selbstmord gab. Während die Kollegen mit Problemen und Diagnosen befaßt sind, machen ihnen das Betroffensein und die Betroffenheit klinische Neutralität unmöglich und zwingen sie zur Parteinahme – nicht für die Objektivitätsstandards ihrer Wissenschaft, sondern für einen Patienten, der in diese Rolle womöglich gar nicht hineingehört. Stellvertretend für solche mit einem gerüttelt Maß an Spezialisten-Know-how angereicherten Innenansichten soll an dieser Stelle Thomas Joiners »Myths about Suicide« (2010) vorgestellt werden.
In seinem Buch nimmt sich Joiner, dessen Vater Hand an sich gelegt hat, die landläufigen Anschwärzungen und Diffamierungen der Reihe nach vor und hebelt sie weniger durch Appelle als durch harte Fakten aus, wie sie eine Suizidologie zur Verfügung stellt, die Nachvollziehbarkeit und Vernunft nicht mehr nur für sich reklamiert, sondern auch der anderen Seite zugesteht. Zwei der schlimmsten Vorwürfe an die Adresse der irdischen Nestflüchter sind Feigheit und Egoismus, womit die angebliche Weigerung gegeißelt werden soll, sich den Herausforderungen des Lebens und seinen unvermeidlichen Krisensituationen zu stellen und Eigeninteressen hinter der Sorge um den Nächsten zurücktreten zu lassen. Joiner widerlegt diese Anklagen. Der Selbstmörder hat es mit dem übermächtigsten Gegenspieler zu tun, der sich vorstellen läßt, dem Selbsterhaltungstrieb, und mit seinem furchteinflößenden Alliierten, der Todesangst. Angesichts dieser biologischen Allgewalt müßte ein Feigling kuschen und am Leben bleiben. Der Selbstmörder aber tut das Gegenteil und begehrt auf. Wie ist das möglich? Nach Joiner allein durch ein meist unfreiwillig absolviertes jahrelanges Training. Risikogruppen wie Alkoholiker und Anorexia-nervosa-Patientinnen werden diesem ›Aushärtungsprozeß‹ automatisch unterworfen: »Bei anorexischen Frauen ist die Sterblichkeit extrem hoch. Sie begehen so häufig Selbstmord, weil die zu ihrer Krankengeschichte gehörende Selbstaushungerung sie an Schmerzen gewöhnt und sie gegenüber der Todesfurcht abstumpft. Die Fähigkeit, einem zentralen Lebensinstinkt, dem Hunger, Paroli zu bieten, versetzt sie in die Lage, dem Leben selbst die kalte Schulter zu zeigen.«
[...]
SINN UND FORM 5/2012, S. 605-613
