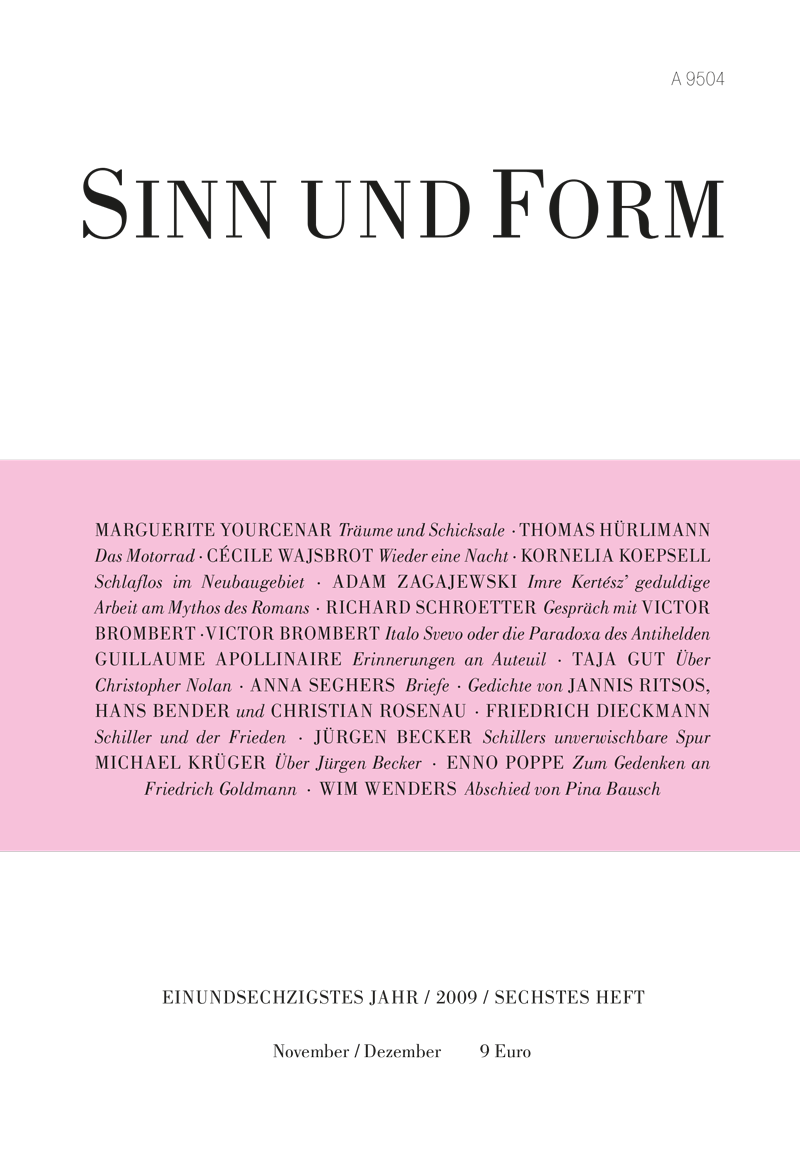Leseprobe aus Heft 6/2009
Brombert, Victor
»Wir ahnten nicht, was kommen würde«. Gespräch mit Richard Schroetter
RICHARD SCHROETTER: Man kennt Sie als einen der führenden amerikanischen Komparatisten, als Romanisten und Literaturkritiker, aber auch aus dem Film über die ›Ritchie Boys‹, jene jungen Emigranten, die im Zweiten Weltkrieg in Camp Ritchie für Spezialeinsätze ausgebildet wurden. Sie kamen1923 zur Welt und verbrachten Ihre Kindheit in Leipzig. Was hat Ihre Eltern, wohlhabende jüdische Kaufleute aus Rußland, dazu bewogen, ausgerechnet nach Deutschland zu gehen?
VICTOR BROMBERT: Bei Ausbruch der Oktoberrevolution 1917 waren sie auf der Hochzeitsreise in Dänemark und mußten sich plötzlich entscheiden, wo sie bis zur Rückkehr in die Heimat leben wollten. Damals glaubten sie noch, es handle sich um ein vorübergehendes Exil. Weil mein Vater Geschäftsbeziehungen nach London hatte, übersiedelten sie dorthin, blieben aber nur ein Jahr, denn meine Mutter fühlte sich in England nicht wohl.
SCHROETTER: Welche Erinnerungen haben Sie an Leipzig?
BROMBERT: Die Wohnung lag in der Ferdinand-Rhode-Straße, nicht weit vom Gewandhaus, hatte einen herrlichen Wintergarten und war so groß, daß ich mit dem Fahrrad durch die Flure fahren konnte. Mit der Kinderfrau sprach ich Deutsch, in der Schule natürlich auch, und ab und zu sogar mit meiner Mutter, die auf einem Mädchenpensionat in Wien gewesen war. Noch heute zähle ich manchmal auf deutsch, etwa bei der Gymnastik. Komplizierte Texte lese ich ohne Mühe, nur bei einem anspruchsvollen intellektuellen Gespräch hätte ich Schwierigkeiten. Hin und wieder ging ich mit meinem Vater odermeiner Großmutter im Rosentaler Wäldchen spazieren. Die Wintertage warengrau, jedenfalls im Vergleich zu Frankreich, das ich schon vor der Emigration kennenlernte. Das hing mit dem Tod meiner Schwester zusammen. Sie starb mit fünf in Breslau auf dem OP-Tisch. Man hatte noch erwogen, sie wegen des Gehirntumors zu einem Spezialisten in die USA zu bringen. Nach diesem Schlag reiste meine Mutter nach Nizza und nahm mich mit. Ich entdeckte den Süden, das blaue Meer, die Kaps, und auf einmal kam mir Leipzig noch grauer vor.
SCHROETTER: Das war 1931. Nahmen Sie damals auch Politisches im Alltag, auf der Straße wahr?
BROMBERT: Einmal erlebte ich, wie zwei Demonstrationszüge aufeinander zumarschierten, Kommunisten gegen Nazis, beide mit Transparenten, Knüppeln und Marschliedern. Nach ein paar Minuten war die Straße übersät mit Verwundeten, und überall war Blut. Das hat mich geprägt, seitdem verabscheue ich Kundgebungen und Menschenmassen. Andere Erinnerungen an Leipzig habe ich wohl einfach ausgeblendet. Im nachhinein wird mir klar, daß das nicht nur am Frankreich-Erlebnis lag, das alles überstrahlte. Ich habe diese Zeit als bedrohlich erlebt und auf meine Weise darauf reagiert. Mit der Sprache machte ich es ein paar Jahre später ähnlich: Ich tat so, als könne ich kein Deutsch, oder machte den französischen Akzent nach.
SCHROETTER: Agitation und politische Gewalt kannten Ihre Eltern doch schon aus Rußland.
BROMBERT: Sie gehörten dort zu den assimilierten Juden, ihre ökonomische Situation verschaffte ihnen das Privileg, in St. Petersburg oder in Moskau zu wohnen und nicht im Schtetl. Sie waren Kosmopoliten, beherrschten drei oder vier Sprachen und hatten an der Universität studiert. Mein Vater hörte in Paris Reden von Jean Jaurès und Anatole France, ehe er in Rußland seinen Jura-Abschluß machte. Meine Eltern kannten schon einiges, was den deutschen Juden noch erspart geblieben war. Sie wußten, wie leicht Antisemitismus in Gewalt umschlagen kann. Ich wuchs auf in einer Atmosphäre bürgerlichen Komforts, aber mit dem Bewußtsein, daß wir nicht so recht dazugehörten. Wir waren keine Deutschen, aber auch keine Russen mehr, wir waren Staatenlose.
SCHROETTER: Was für Pässe hatten denn Ihre Eltern?
BROMBERT: Sie hatten die russische Staatsbürgerschaft mit der Revolution verloren und lebten als geduldete Ausländer in Deutschland. Sie hatten sogenannte Nansen-Pässe, nach dem Völkerbundkommissar für Flüchtlingsfragen Fridtjof Nansen. Diese Pässe stellte das Land aus, wo sich der staatenlose Emigrant aufhielt. Immerhin konnten meine Eltern Grundbesitz erwerben, ihre Firma lief sehr gut, die Geschäftsbeziehungen reichten bis nach China. Es war ein Import-Export-Großhandel, hauptsächlich mit Pelzen. Mein Vater reiste zu Auktionen nach London, doch eigentlich war er eine poetische Seele und ein Liebhaber der Dichtung, kein Geschäftsmann. Zum Jurastudium war er bloß gekommen, weil man doch irgendwas studieren mußte.
SCHROETTER: Als Sie neun waren, verließ die Familie Deutschland. Das war sicher ein riskanter Augenblick.
BROMBERT: Wir flüchteten 1933 mit einem Nachtzug in die Schweiz, mein Onkel und seine Familie waren im selben Zug. Die Eltern hatten mir streng verboten, ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis die Tür des Schlafwagenabteils zu öffnen. Wir hörten, wie zwei, vielleicht auch drei Polizisten einstiegen und den Schaffner fragten, ob Juden im Zug seien. Er sagte nein, obwohl er es besser wußte. Das hat uns gerettet. Man hätte uns sonst wohl aus dem Zug geholt und wegen »Devisenschieberei« angeklagt, da meine Eltern einiges an Bargeld bei sich hatten. Ich habe oft an diesen Schaffner denken müssen. Vielleicht war er ein aufrechter Sozialdemokrat. Seinetwegen habe ich mich immer geweigert, alle Deutschen für schuldig zu halten.
SCHROETTER: Also stimmen Sie nicht überein mit Daniel Jonah Goldhagens These vom latenten Antisemitismus der Deutschen?
BROMBERT: Überhaupt nicht, ich bin schockiert von seiner historischen Unkenntnis. Die Situation der deutschen Juden vor dem Nationalsozialismus war vergleichsweise beneidenswert. Für die russischen Juden war Deutschland ein Hort der Aufklärung, wo die staatliche Ordnung Schutz gewährte. Wer es sich leisten konnte, machte dort Urlaub und genoß den Respekt, der ihm entgegengebracht wurde. Gegen Frankreich hatte man Vorurteile wegen der Dreyfus-Affäre – ein Mißverständnis der französischen Geschichte. Goldhagens Buch ist parteiisch und historisch teilweise unzutreffend. Mich ärgern seine These eines eingeborenen und gleichsam vererbten Antisemitismus und die Schlüsse, die er daraus zieht. Es gibt keine von Antisemitismus freie Gesellschaft, nicht einmal bei den Juden. Natürlich ist der Holocaust etwas historisch Einmaliges wegen des systematischen Vorgehens und der Blindheit, der vorsätzlichen oder partiellen Blindheit vieler Menschen. Aber wir sind alle blind gegen bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft. Wir hören ab und zu, oder wissen oder erraten, was in Polizeistationen und Gefängnissen vor sich geht. Doch wir vergessen es lieber und freuen uns, wenn die Polizei uns hilft. Wir sind alle dazu fähig, die unerfreulichen Seiten unserer Gesellschaft auszublenden. Das ist natürlich keine Entschuldigung für das Geschehene. Zudem legen einige Gesellschaften größeren Wert auf Gehorsam als andere. In Italien hat ein Befehl nicht viel zu bedeuten, man kümmert sich nicht darum oder macht das glatte Gegenteil. In Deutschland befolgt man die Gesetze, im guten wie im schlechten.
SCHROETTER: Ihre Eltern glaubten damals offensichtlich, in Frankreich vor den Deutschen sicher zu sein. Nach einem Umweg über die Schweiz ließen sie sich im Spätherbst 1933 in Paris nieder. Der Kontrast zwischen Leipzig und der französischen Metropole muß doch sehr groß gewesen sein.
BROMBERT: Paris war eine Offenbarung. Wir wohnten zuerst bei meiner Tante, ehe wir eine schöne möblierte Wohnung bezogen. Ich entdeckte das Alltagsleben, die Straßenmärkte, die Farben und Gerüche, und als ich älter wurde und zur Schule ging oder sie schwänzte, machte ich auf eigene Faust Entdeckungen.
SCHROETTER: Warum schwänzten Sie die Schule?
BROMBERT: Mit zwölf, dreizehn war ich noch ein fleißiger Schüler und gewann mehrere Preise, doch dann änderten sich meine Interessen. Ich hatte dauernd Frühlingsgefühle und sah auf der Straße den Frauen nach. Die meisten meiner Freunde waren sitzengeblieben, teilweise sogar mehrmals, und daher älter als ich. Auch ich sah älter aus: mit dreizehn wirkte ich wie fünfzehn, mit vierzehn wie siebzehn. Ich wurde faul, las aber viel. Meine Streifzüge durch Paris machten mir Appetit auf Literatur und Kunst. Ich war dreisprachig, ohne eigentlich eine Muttersprache zu haben, Französisch wurde zum Medium meiner Weltwahrnehmung. Ich brauchte die Atmosphäre und Kultur dieser offenen, liberalen, vergnügungssüchtigen Gesellschaft. Vom Gären im Untergrund und von den heraufziehenden Bedrohungen merkte ich nicht viel. Paris war für mich eine Art Wiedergeburt. Tatsächlich bin ich ja in Berlin zur Welt gekommen, wo meine Mutter von einem berühmten Arzt behandelt wurde. Aber ich lernte die Stadt erst kennen, als ich 1945 mit der US-Armee zurückkehrte.
SCHROETTER: Dann begann Ihr Leben also da, wo Ihre Autobiographie »Trains of Thought« endet.
BROMBERT: Ich weiß nicht, ob ich meinen Geburtsort in dem Buch überhaupt erwähne. Ich wollte lange nicht darüber sprechen und habe ihn verleugnet. Heute sehe ich, daß das albern war, aber ich habe viele Jahre gebraucht, um diese innere Freiheit wiederzuerlangen.
SCHROETTER: In Paris fühlten Sie sich endlich frei, freier jedenfalls als in Leipzig. Ihre Autobiographie beginnt mit einem Schlüsselerlebnis, einer Szene wie aus einem Truffaut-Film. Sie erzählen von einer Busfahrt durch das sechzehnte Arrondissement, Passy, Auteuil, eine »Oase der Normalität«, wie Sie schreiben. Doch der vierzehnjährige Brombert und sein Freund sind unterwegs zu einem Bordell in der Innenstadt, wo es zu einer keuschen Begegnung mit einer jungen Prostituierten kommt. War das nicht ein gewagtes Unterfangen für einen Jungen Ihres Alters?
BROMBERT: Das hing von der sozialen Klasse ab. In den proletarischen Vierteln war die Promiskuität wohl größer, doch im blasierten und bourgeoisen sechzehnten Arrondissement beschränkte sich das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen meines Alters auf ein bißchen Flirten. Es gab getrennte Schulen, nur im Kino konnte man sich küssen oder Händchen halten, aber das war noch keine sexuelle Initiation. Die erlebten Jungen wie ich meist mit einer Hausangestellten oder einer Professionellen. Ich hatte Glück: Der Vater eines Freundes gab uns Geld und nannte eine Adresse. Mein Vater wäre nie auf so etwas gekommen. Es war das beste Etablissement in Paris und ziemlich bekannt, wie ich später merkte. Ich fand es nicht nur luxuriös und ästhetisch, ich erlebte auch Zärtlichkeit und habe den Besuch in dankbarer Erinnerung. Überhaupt übte Paris auf mich eine erotische Faszination aus.
SCHROETTER: Wie war Ihr Verhältnis zu den Mitschülern?
BROMBERT: Wir wußten natürlich, daß es auch in Frankreich Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus gab, wie überall. In jedem Land zeigen sie sich in anderer Gestalt. Es gibt provinziellen, städtischen, rechten, linken, religiösen, ja sogar sozialistischen Antisemitismus. Mein Vater konnte mir viele Dinge gut erklären, die Dreyfus-Affäre zum Beispiel. Er sah alles in einem größeren Kontext und nicht nur in bezug auf die jüdische Frage. Damals regierte die Volksfront unter Léon Blum, der übrigens auch Jude war. So oft er irgendwo auf der Leinwand erschien, gab es einen Aufruhr. Man sagte »sale juif«, Drecks-jude, ohne sich viel dabei zu denken. Von all dem wußte ich, aber im sechzehnten Arrondissement spielte man höchstens ironisch darauf an. Gewalt spielte keine Rolle, nur einmal wurde ich in eine Schlägerei mit einem anderen Jungenverwickelt.
SCHROETTER: Wie kam es dazu?
BROMBERT: Wir schubsten uns vor dem Klassenzimmer, er sagte wie üblich Drecksjude, das kam fast automatisch, und alle um uns herum wiederholten es. Ich wollte nicht kämpfen, er wohl auch nicht, aber der Gruppenzwang ließ uns keine Wahl. Er kam mir sozusagen vor die Fäuste, ich könnte nicht einmal sagen, daß ich zielte. Am Ende blutete er. Ich will nichts beschönigen: Die Sache hatte einen ernsten Hintergrund, doch wir nahmen sie nicht ernst. Die Gesellschaft war damals wie ein Club, dessen Mitglieder entweder Juden oder Antisemiten waren. Wir spielten gemeinsam Tennis und waren freundlich zueinander. Wir ahnten nicht, was kommen würde.
SCHROETTER: Konnte man das überhaupt?
BROMBERT: Man muß sich immer fragen, was man damals empfand, und von dem absehen, was später die Erfahrung lehrte. Die Versuchung ist groß, rückwirkend zu deuten. Als nach der Niederlage Marschall Pétain an die Macht kam, war mein Vater wie viele Juden froh darüber. Nicht weil er ihn mochte: Man wußte, daß er ein Ultrakonservativer und ein Feind des parlamentarischen Systems war. Daß er ein Antisemit war, wußte man noch nicht, aber man konnte es sich denken. Doch wenigstens blieb Frankreich das Schicksal Polens erspart. Es bekam keinen »Gauleiter«, sondern ein Staatsoberhaupt, das die Deutschen als Gesprächspartner respektierten, jedenfalls eine Zeitlang. Es war das einzige besiegte Land, dem Waffenstillstandsverhandlungen und sogar eine Art Friedensvertrag angeboten wurden. Man glaubte, Pétain werde das Land und die Juden schützen. Doch der Schutz galt nicht für alle. Schon bald wurden Unterschiede gemacht, erst zwischen französischen und ausländischen Juden, dann zwischen französischen und »neuen« französischen Juden, dann zwischen jenen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, und den anderen. Schließlich war selbst das vorbei. Das Beschämende am Waffenstillstand war eine Klausel, wonach jede Person ausgeliefert werden mußte, die die Deutschen haben wollten. Das betraf zwar nicht die Franzosen selbst, aber alle, die auf französischem Boden Zuflucht gefunden hatten, und das waren ja vor allem Nazigegner, viele davon Juden. Wir wußten von dieser Klausel, glaubten aber anfangs, sie beträfe uns nicht. Die französischen Juden hielten Antisemitismus für ein Problem der deutschen Emigranten. Ähnliches hatten meine Eltern schon in Deutschland erlebt, wo die Juden auch geglaubt hatten, sie wären gesellschaftlich respektiert. Sie hörten damals Leute sagen: »Ich war in der Wehrmacht, ich habe das Eiserne Kreuz. Das Problem sind die Ostjuden, die sollten wir nicht ins Land lassen.« Es gab also einen regelrechten jüdischen Antisemitismus. Selbst in den USA weigerten sich einige jüdische Mitglieder der Regierung Roosevelt, ihre Stimme zu erheben und Unterstützungs- oder Rettungsmaßnahmen zu veranlassen. Sie wollten keinen Ärger machen. Meine Eltern waren sensibilisiert für dieses Denken, sie hatten das Beispiel Rußlands und Deutschlands noch vor Augen. Wir hatten keine großen Illusionen und wußten, daß uns eine neuerliche Flucht bevorstand. Zum Glück hatten wir die Mittel dazu.
SCHROETTER: Diese Flucht begann in einem mondänen Badeort in der Normandie vor einer geradezu Proustschen Kulisse.
BROMBERT: Den Sommerurlaub verbrachten wir meist am Meer, ein- oder zweimal auch in Marienbad. Wir fuhren nach Cabourg, Deauville oder Trouville. Beim Überfall auf Polen waren wir gerade in Deauville, und meine Eltern beschlossen, sicherheitshalber nicht nach Paris zurückzukehren. Zwar hatte mein Vater dort Geschäfte zu erledigen, doch wir blieben bis Mai 1940. Dann kam der Blitzkrieg, und es wurde klar, daß Frankreich bald zusammenbrechen würde. Nun hieß es rennen, wollten wir nicht in der Falle sitzen. Wir fuhren kurz nach Paris und reisten von dort nach Bordeaux, wo ich das Abitur machte. Die Deutschen rückten immer weiter vor, und das Vichy-Regime übernahm die Macht. Wir versuchten, mit einem Schiff zu fliehen, umsonst. Auch die Flucht nach Spanien glückte uns nicht. Eine Zeitlang hielten wir uns in den Bergen versteckt, wie übrigens auch andere Familien aus Paris, darunter viele Juden. Schließlich gingen wir nach Nizza, wahrscheinlich wegen der Nähe zum großen Hafen von Marseille und zu Italien, das trotz Mussolini einen vergleichsweise humanen Eindruck machte. Die Stimmung war gespannt, doch die Menschen verhielten sich leichtsinnig, fast hedonistisch. Vater bemühte sich ununterbrochen, uns Visa zu besorgen, letztlich mit Erfolg.
SCHROETTER: Im Sommer 1941 konnten Sie über Sevilla ausreisen und gelangten mit dem Bananenfrachter »Navemar« nach New York. Selbst auf Frachtern kostete die Überfahrt damals ein Vermögen.
BROMBERT: Soweit ich mich erinnere, mußten wir tausend Dollar pro Person bezahlen, das entspräche heute mindestens dem Zehn-, wenn nicht dem Fünfzehnfachen. Wir hatten ein US-Einreisevisum, das schwer zu kriegen war, weil es für jedes Herkunftsland Quoten gab. Polen hatten nur geringe Chancen, für Italiener oder Deutsche war es sicher leichter. Zudem bauten die Amerikaner weitere Hürden auf, um den Einwandererstrom zu begrenzen. Man brauchte ein Transitvisum für Spanien sowie ein Ausreisevisum für Frankreich, das für militär- oder arbeitsdiensttaugliche Männer schwer zu kriegen war. Doch das Schwierigste war, all diese Papiere und die Fahrkarten gleichzeitig zu bekommen. Das Schiff wartete ja nicht! An Bord gab es Kabinenplätze für fünfzehn Passagiere, aber man hatte nicht weniger als 1200 Tickets verkauft. Wir waren also gleichsam die Bananenfracht. Wegen der U-Boot-Gefahr fuhren wir auf Zickzackkursen und waren volle sechs Wochen unterwegs. Es gab nicht viel zu essen und keine medizinische Versorgung, etliche Passagiere starben unterwegs. Eine Vergnügungsreise war das wahrlich nicht, aber sie rettete uns.
SCHROETTER: Die Ankunft in den USA muß doch ein großer Einschnitt gewesen sein. Wie haben Sie das erlebt?
BROMBERT: Die größte Herausforderung bestand in der Begegnung mit mir selbst. Ich war verhätschelt worden, und selbst Krieg und Flucht verstärkten bis zu einem gewissen Grad meine Passivität: Man brauchte keine Entscheidungen zu treffen, es gab keine Zukunft, die Frage der Berufswahl stellte sich nicht. Als mir bewußt wurde, daß nun alles anders würde, entschied ich mich, auf eine amerikanische Schule zu gehen, weit weg von den Eltern. Sie verstanden das sehr gut, und so wurde ich mit achtzehn in ein Vorbereitungscollege in Pennsylvania aufgenommen. Das war kurz vor Pearl Harbour. Uns war klar, daß wir in den USA bleiben würden, und doch träumte ich davon, zurückzukehren. Ich hing an meinen Erinnerungen und Freunden und fühlte mich als Franzose. Ich wunderte mich über die amerikanischen Jungen und Mädchen meines Alters. Sie waren sehr nett, aber in jeder Hinsicht naiv: intellektuell, erotisch, sexuell. Mir schienen sie fünf Jahre jünger. Ich hatte Heimweh, sah mich als Patrioten und wollte von den Eltern unabhängig sein. Ich träumte von der Armee und hoffte auf den Kriegseintritt der USA, der wenig später auch erfolgte. Zum Glück wurde ich nicht in den Pazifik geschickt, sondern nach Europa. Die zweite Panzerdivision, der ich angehörte, trug den Spitznamen »Hell on Wheels« und hatte unter General Pattons Befehl gestanden. Bei der Invasion in der Normandie im Juni 1944 ging sie gleich nach den Pionieren an Omaha Beach an Land. Damals entdeckte ich, daß ich kein Held war, obwohl ich gern einer gewesen wäre.
SCHROETTER: Wie fühlten Sie sich als Sproß aus wohlhabendem, behütetem Hause in der Armee?
BROMBERT: Das war ein Schock für mich. Nach der Grundausbildung kam ich erst zum medizinischen Corps und dann zu einem Aufräumkommando, vermutlich weil ich die amerikanische Staatsbürgerschaft noch nicht hatte und Ausländer nicht in Kampfeinheiten durften. Schließlich bemerkte man meine Mehrsprachigkeit und steckte mich in ein Ausbildungszentrum des militärischen Geheimdienstes, Camp Ritchie in der Nähe von Washington, D. C.
SCHROETTER: Was war Ihre Aufgabe, wie wurden Sie eingesetzt?
BROMBERT: Ich gehörte zu einem sechsköpfigen Aufklärungs- und Verhörteam, das an vorderster Front agierte. Wir versuchten von französischen Zivilisten Informationen über die deutschen Truppen und ihre Stellungen zubekommen. Wir machten auch Radiosendungen in der Hoffnung, deutsche Soldaten zum Aufgeben zu bewegen, allerdings ohne großen Erfolg. Später diente ich als Übersetzer und Befrager von Kriegsgefangenen und kam in den Hürtgenwald und die Ardennen.
SCHROETTER: Darüber haben Sie in Ihrer Autobiographie »Trains of Thought« geschrieben. Können Sie etwas über Ihre Erlebnisse dort berichten?
BROMBERT: Die Schlachten in den Ardennen und im Hürtgenwald waren in vielerlei Hinsicht blutiger als die Invasion in der Normandie. Bei der Landung an Omaha Beach dauerte die Todesangst ein paar Stunden oder Tage, die deutschen Armeen zogen sich zurück, wir rückten nach, zeitweise herrschte beinahe Euphorie. Wir befreiten Paris und stießen bis zur belgischen Grenze vor. Es sah so aus, als wäre der Krieg bald vorbei. Doch weit gefehlt: Als wir den Albert-Kanal erreichten, der Antwerpen und Lüttich verbindet, trafen wir auf erbitterten Widerstand. Desgleichen bei Aachen, wo die Deutschen eigenen Boden verteidigten. Die amerikanischen Generäle waren wild entschlossen, durch den Hürtgenwald vorzustoßen, obwohl nicht die geringste Notwendigkeit dazu bestand, es war dabei nichts zu gewinnen. Das Ergebnis waren die fürchterlichsten, blutigsten, demoralisierendsten Kämpfe, die ich erlebt habe, ein zähes Ringen um jeden Zentimeter Boden, mit all den Schrecken einer Kriegführung im Wald, wofür die amerikanische Armee überhaupt nicht ausgerüstet war. Die Deutschen hatten damit Erfahrung, sie kannten das aus Rußland. Ich gehörte damals zur 28. Infanteriedivision, die schrecklich dezimiert wurde. Ganze Regimenter wurden aufgerieben. Danach verlegte man uns zur Erholung in eine vermeintlich ruhigere Gegend in Luxemburg. Doch gerade dort, in der Nähe von Wiltz, griffen die Deutschen erneut an. Sie hatten hervorragende Einheiten, einige waren dafür ausgebildet, in amerikanischen Uniformen Chaos und Panik zu verbreiten. Die Ardennenschlacht war ein Debakel für die Amerikaner und Engländer. Unser einziger Vorteil war, daß den Deutschen der Treibstoff ausging, während wir Reserven hatten. Dafür hatten sie den Angriff genau geplant und auf die Wetterlage abgestimmt, sodaß wir keine Luftunterstützung bekommen konnten. Die Landschaft war tiefverschneit, und es war bitter kalt. Die wichtigste Erfahrung bestand darin, daß ich ein paar Wahrheiten über mich herausfand. Meine romantischen Jugendlektüren über Krieg und Krieger hatten mich darauf gebracht, daß auch ich ein Held sein könnte. Doch als ich zum ersten Mal unter Beschuß geriet, lernte ich Angst und Panik kennen. Wohl auch deshalb schrieb ich später das Buch »In Praise of Antiheroes« (Lob der Antihelden). Ich wollte mich mit dieser Erfahrung auseinandersetzen, und ich glaube, ich habe sie ehrlich beschrieben. Ich entdeckte damals auch, daß körperlicher Mut nicht die größte Tugend ist: Man kann ein mutiger Gangster, ein mutiger Faschist sein. Moralischer Mut ist etwas anderes. Ironischerweise können bittere geschichtliche Erfahrungen sich für Überlebende positiv auswirken. Wer weiß, ob ich ein guter Student und schließlich Gelehrter geworden wäre, wenn Hitlers Armeen Frankreich nicht angegriffen hätten. Vielleicht hätte ich mich auf die Stellung und das Vermögen meines Vaters verlassen und wäre ein verwöhnter Sohn geworden. Ich hatte nicht viel Ehrgeiz. In Frankreich, in Europa überhaupt mußte man damals früh wissen, was man wollte, sonst war der Zug abgefahren. In Amerika dagegen konnte man fünf oder sogar fünfzehn Jahre später kommen und noch etwas Neues ausprobieren. Davon habe ich profitiert.
SCHROETTER: Wie ging es weiter nach der Ardennenschlacht?
BROMBERT: Ich wurde ins Elsaß verlegt und nahm an der Befreiung von Colmar teil. Später überquerten wir bei Remagen den Rhein, und ich wurde einer großen Einrichtung des Alliierten Kontrollrats in der Nähe von Frankfurt zugeteilt. Der Krieg ging nun rasch zu Ende. Vorübergehend setzte man mich bei der Entnazifizierung des Saargebiets ein. Wir suchten nach Kreisleitern, Gauleitern, später auch nach kleineren Fischen. Doch die amerikanische Militärregierung setzte einige der Festgenommenen schon am nächsten Tag wieder in ihre Ämter ein, weil man sie für unentbehrlich und verläßlich hielt: Es ging gar nicht um Strafverfolgung, sondern bloß darum, die Dinge am Laufen zu halten. Das dämpfte meinen Enthusiasmus. Auch beim Kontrollrat war ich unzufrieden. Es war das alte Problem, die Unmöglichkeit eines Dialogs zwischen Soldaten mit Fronterfahrung und Bürokraten. Schließlich bat ich um Versetzung nach Berlin. Zu meinen Aufgaben dort gehörten die Betreuung von Vertriebenen und Kontakte mit den Sowjets. Da ich Russisch sprach, nahm ich an Verhandlungen und Sitzungen teil. Es war nicht sehr erbaulich, das Verhalten der Sowjets im besetzten Berlin aus der Nähe mitzukriegen. Auch unsere Leute waren keine Engel, doch sie betrieben eher Schwarzmarktgeschäfte. Ich hatte zwei bewegende Erlebnisse in Berlin, die ich in »Trains of Thought« beschreibe. Inmitten der Zerstörung kam es zu einer Opernaufführung, ohne Dekor, ohne Kostüme, aber herrlich gesungen und gespielt. Es war »Fidelio«, ein Stück über Gefangenschaft und Freiheit, die Opfer der Tyrannenherrschaft und Erlösung durch die Liebe. Selbst den Kerkermeister Rocco fand ichbewundernswert. Sein Gehorsam geht nur bis zu einem gewissen Punkt, dann hat er die großartige Zeile: »Das Leben nehmen ist nicht meine Pflicht.« Er weigert sich, den Gefangenen zu töten. Das ist ein Akt des Widerstands, zwar kein großer, aber ein bedeutungsvoller. Und der machte seinen Part zum Mittelpunkt der Oper. Das andere Erlebnis hatte ich in einer unzerstört gebliebenen Villa in der Nähe von Onkel Toms Hütte. Dort im Garten wurde eines Abends Shakespeares »Sommernachtstraum« in einer wundervollen deutschen Übersetzung aufgeführt. Es war ein märchenhaftes, zauberisch suggestives, irreales, poesiedurchtränktes, ein verspieltes Schauspiel in der trostlosen Umgebung dieser Stadt. Diese beiden Aufführungen verkörperten für mich die Erfahrung des Überlebens, des Weiterlebens, und daß der Krieg endlich zu Ende war. Ich freute mich darauf, etwas Neues anzufangen, denn in der Zwischenzeit hatte ich meine eigentliche Leidenschaft entdeckt: über Literatur zu forschen und zu lehren. So hatte ich nun auch ein Ziel vor Augen, ich wollte Universitätsprofessor werden.
SCHROETTER: Mit welchen Gefühlen kehrten Sie in das zerstörte Deutschland zurück?
BROMBERT: Mit ganz gemischten. Eines hatte gar nicht direkt mit Deutschland zu tun: Ich war entsetzt über den Jubel, mit dem die amerikanische Presse und das Militär den Einsatz der Atombombe begrüßten. Das fand ich obszön. Man kann darüber streiten, ob er nötig war, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Doch als ich von der Zerstörungskraft der Bombe las, von den Leichen, die so sehr verbrannt waren, daß man Frauen und Männer nicht mehr unterscheiden konnte, empfand ich das als furchtbare Bedrohung für die Zukunft. Außerdem merkte ich die Heuchelei, denn die gleichen Zeitungen hatten sich über die deutschen V2-Raketenangriffe auf London und vieles andere empört. Und dann ärgerte mich noch, daß die Amerikaner sich in Deutschland durchweg wohler zu fühlen schienen als in Frankreich. Vielleicht lag es daran, daß viele Soldaten deutsche Vorfahren hatten, vielleicht spielte das gemeinsame protestantische Ethos eine Rolle, oder daß die Dörfer in Deutschland ein bißchen wie in Amerika aussahen, jedenfalls mehr als die französischen. Es gab zwar ein striktes Fraternisierungsverbot, doch es wurde kaum beachtet. Wenn ich bei Deutschen eingeladen war, legte ich großen Wert auf Abstand und machte nur Konversation – meist mit den Frauen, denn Männer waren kaum da, und die Frauen hielten mit großem Mut alles am Laufen. Ein Unterschied zu Frankreich fiel ins Auge: Dort nahm das Denunziantentum nach Kriegsende epidemische Ausmaße an: Jeder wollte ein Widerstandskämpfer gewesen sein, alle anderen waren Kollaborateure. In Deutschland dagegen konnte ich niemanden zum Sprechen bringen. Keiner wollte andere belasten. Ich fragte mich, warum das so war: Es hatte wohl mit Angst zu tun, aber auch mit Stolz und einem gewissen Sinn für Würde, den ich gegen meine Überzeugung gut fand.
SCHROETTER: Haben Sie sich im Krieg jemals etwas geschworen, falls Sie das alles überleben würden?
BROMBERT: Nur für den Fall, daß ich diesen oder jenen Moment überlebe. Beten konnte ich nicht, aber ich schwor zum Beispiel, daß ich mich nie beklagen würde, falls ich überlebe. Natürlich habe ich nicht Wort gehalten.
Aus dem Englischen von Gernot Krämer
SINN UND FORM 6/2009, S. 757-767