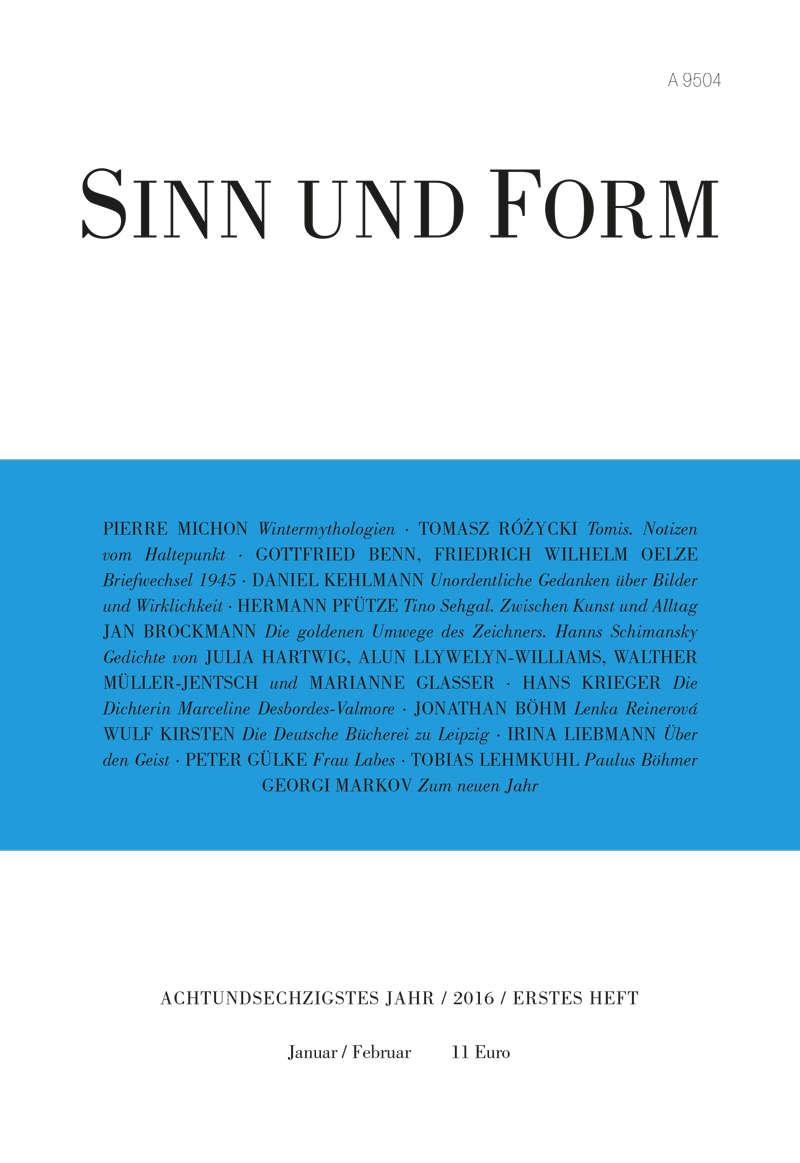
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-27-0
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 1/2016
Oelze, Friedrich Wilhelm
Gottfried Benn, Friedrich Wilhelm Oelze. »Alles, was ich zu wünschen vermag, gilt Ihnen«. Aus dem Briefwechsel 1945. Mit einer Vorbemerkung von Matthias Weichelt
Widerhall ohne Widerspruch. Eine Vorbemerkung
Nach der Feier seines fünfundsechzigsten Geburtstags, zu der sein Verlag im Mai 1951 nach Wiesbaden eingeladen hatte, schrieb Gottfried Benn seinem Brieffreund Friedrich Wilhelm Oelze: »Der Eindruck, den Sie gemacht haben, war allgemein groß. Wollen Sie wissen, was meine Tochter, deren Gedanken sich viel mit Ihnen beschäftigen, unter Anderem sagte? ›Eine unheimliche Erscheinung! Man muß damit rechnen (!), daß er nachts ein schwarzes Trikot anzieht u. auf Einbruch geht‹. Nun? Wenn das kein Effekt ist!«
Wenn der Bremer Großkaufmann und Jurist (1891–1978) eines vermeiden wollte, dann Effekte und Auffälligkeiten. Entsprechend verstört fiel die Antwort aus. In einer seinem Brief angefügten Notiz mit dem Titel »Das schwarze Trikot« sieht Oelze sich als »Hochstapler- oder Verbrechertyp« bloßgestellt: »das also steht in meinem habitus geschrieben für den, der zu sehen und zu lesen versteht? Das scheint mir unheimlich, und zwingt mich zu sehr schwierigen und peinlichen Selbstkorrekturen.« Daß Benn, der die labile Konstitution, die existentielle Unsicherheit des Freundes kannte und ihn zuweilen damit quälte, daraufhin die von seiner Tochter vermuteten Motive der obskuren Aktivitäten nachreichte (»aus Sensationsbedürfnis, aus Abwegigkeit, aus Perversion«), dürfte wenig zu Oelzes Beruhigung beigetragen haben. Er ging darauf nicht mehr ein. Dabei hatte das Bild des nächtlichen Phantoms die Sache nicht schlecht getroffen. Der 1891 geborene Oelze stammte aus einer alten Kaufmannsfamilie, hatte u. a. in London Jura studiert und war nach der Promotion Teilhaber einer Handelsfirma geworden, die vor allem Kolonialwaren importierte. Schon sein Großvater hatte auf Jamaika Zuckerrohrplantagen erworben, seine Mutter war dort zur Welt gekommen, und auch Oelze selbst reiste immer wieder in die Karibik – von wo aus Ansichtskarten mit exotischen Motiven auf Benns schlichtem Schreibtisch in der Bozener Straße 20 in Berlin-Schöneberg landeten. Auch dank der Heirat mit einer vermögenden Bürgertochter verfügte Oelze, dessen einziger Sohn im Zweiten Weltkrieg fiel, über die Mittel, repräsentative Wohnsitze zu unterhalten und bedeutende Möbel-, Kunst- und Büchersammlungen zusammenzutragen (darunter fast alle Veröffentlichungen Goethes in Erstausgaben). Denn die Bilanzen seiner internationalen Handelsaktivitäten waren ihm Pflicht und Aufgabe, boten aber keinerlei Befriedigung. Oelzes eigentliche Leidenschaft galt dem Geist, der Kunst, dem Schöpferischen. Ohne selbst künstlerisch begabt zu sein (die »Gedichte sind nicht gut«, schrieb ihm Benn auf übersandte Verse), wollte er teilhaben an der Sphäre der Dichter und Denker, am besten durch direkten Austausch mit Schriftstellern, Gelehrten, Philosophen wie Maximilian Harden, Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt, Martin Heidegger, später auch Hans Mayer. Die Bedingungslosigkeit, mit der er sich Benns absolutem Kunstanspruch und nihilistischer Weltsicht unterwarf, bedrohte immer wieder die Fassade seines bürgerlichen Lebens und verlangte nach Camouflage und Verstellung. Wie auch seine homoerotischen Neigungen, denen er allenfalls auf Geschäftsreisen und im Schutz der Anonymität nachgehen konnte. Hinzu kam ein fast zwanghaftes Bedürfnis nach Selbstverkleinerung, ein Gefühl der Unwichtigkeit und Bedeutungslosigkeit, das durch den Austausch mit den als Genies empfundenen Gesprächs- und Briefpartnern nicht gemindert wurde (und auf eigentümliche Weise mit seinem großbürgerlichen, fast dandyhaften Auftreten, den von Benn als aristokratisch empfundenen Umgangsformen und Manieren kontrastierte): »Seit dem Abitur feierte er keinen seiner Geburtstage, verbrannte 1947 sämtliche Fotos von sich und vernichtete fast alle in seinem Besitz befindlichen privaten Dokumente bis hin zum ›Westindischen Tagebuch‹ von 1939 mit dem Ziel, ›sich selbst zu löschen‹, um keine ›Restbestände‹ zu hinterlassen, wie Benn in ›Chopin‹ formuliert hatte.« (Hans Dieter Schäfer, Herr Oelze aus Bremen. Göttingen 2001)
Auch als Oelze 1977 die an ihn gerichteten Briefe Benns zur Veröffentlichung freigab, ließ er die eigenen weg. Viele seiner Schreiben seien verlorengegangen oder in der Nazizeit auf seinen Wunsch hin vernichtet worden, notierte er im Vorwort der Ausgabe: »Aber meinen Briefen kommt nicht mehr zu als die Bedeutung von Anregungen, Stichworten, Fragestellungen; alles Wesentliche enthalten die Antworten des Dichters.« Ob dem tatsächlich so ist, kann man anhand der nun im Wallstein Verlag erscheinenden Edition erstmals überprüfen. In jedem Fall wird man die vierundzwanzig Jahre währende Korrespondenz endlich wieder als das lesen, was sie ursprünglich war: als intensives, forderndes, mit kaum nachlassender Energie geführtes Gespräch zweier in Temperament und Herkunft grundverschiedener, einander aber bald unentbehrlich werdender Geister. Für Oelze sind Benns Nachrichten »eine immer neu sich erschliessende, immer sich mehrende Offenbarung«, deren Auslöser zu sein er immerhin für sich in Anspruch nimmt: »Ich dachte an die Briefe grosser Männer, die ich kannte; mir fiel auf, daß selbst da wo die Empfänger unbedeutende Personen waren, oft Tieferes in den Briefen stand als in den Werken, das Abgründigste, Persönlichste, nur auszudrücken wenn einer zuhörte, aber dieser musste noch den Hauch einer Schwingung empfangen können.« So am 3. Oktober 1937 an Benn. Dieser wiederum hatte das Glück, in Oelze seinen idealen Leser gefunden zu haben, mit einem feinen Gespür für jede Schwingung seiner Texte, mit der Fähigkeit, auf Fragen und Anspielungen einzugehen, und einer Aufnahmebereitschaft, die bis zur Selbstaufgabe ging. Benn erfuhr hier, anders als bei Schriftstellerkollegen und Kritikern, Widerhall ohne Widerspruch. Durch Oelzes nie nachlassendes Interesse an allem, was Benn schrieb und dachte, durch seine unverminderte Aufmerksamkeit und Anteilnahme hielt er dessen Spannung und Produktivität aufrecht und ersetzte ihm das Publikum, das es nach dem Veröffentlichungsverbot 1938 nicht mehr gab. Vor allem nach dem Krieg wird Oelze dann zum publizistischen Berater, ist einbezogen in die Zusammenstellung von Gedicht- und Auswahlbänden, läßt Journalisten und Wissenschaftler Einsicht nehmen in seine Sammlung. Denn sein größter Schatz sind jene Briefe und Aufzeichnungen Benns, deren Sicherung ihm in der Kriegs- und Nachkriegszeit zur Hauptaufgabe wird: »Das Wichtigste zunächst: Die Manuskripte sind bei mir, unbeschädigt, von keiner fremden Hand berührt.«
Begonnen hatte das alle Umbrüche und Einschnitte überdauernde Verhältnis mit einem nicht erhaltenen Brief Oelzes, den Benn am 21. Dezember 1932 mit routinierter Distanziertheit quittierte: »Mir eine große Freude, wenn Ihnen meine Aufsätze gefallen haben. Eine mündliche Unterhaltung würde Sie enttäuschen. Ich sage nicht mehr, als was in meinen Büchern steht.« Oelze hatte Benns kurz zuvor in der Neuen Rundschau erschienenen Aufsatz »Goethe und die Naturwissenschaften« gelesen und als entscheidendes Bildungserlebnis empfunden: »Bei der Lektüre dieser knappen, kaum sechzig Seiten umfassenden Darstellung erfuhr ich das spontane Betroffensein, wie es nur die Kunst zu bewirken vermag, wenn die Stunde der Bereitschaft da ist.« Und wem solches widerfährt, der läßt sich nicht so leicht abschrecken. In einem weiteren verlorenen Brief muß Oelze dann den rechten Ton getroffen haben, um Benns Interesse zu wecken und ihn zu einer ausführlichen Antwort zu bewegen. Er habe mit seiner »Frage ins Schwarze« getroffen, schreibt Benn ihm am 27. Januar 1933: »wie kann man einerseits die Wissenschaft u. ihre Resultate skeptisch ansehn, ja verächtlich betrachten u. doch sie dann für wahr setzen u. zu eigenen Ideen verwerten. Scheinbar widerspruchsvoll. Aber nur scheinbar. Anstelle des Begriffs der Wahrheit u. der Realität, einst theologisches, dann wissenschaftliches Requisit, tritt ja jetzt der Begriff der Perspective.« In diesem ersten längeren Brief, in dem Benn seine Unterscheidung von Wissenschaft und Kunst erläutert (»Sie ist Erkenntniss; während Wissenschaft ja nur Sammelsurium, charakterloses Weitermachen, entscheidungs- u. verantwortungsloses Entpersönlichen der Welt ist. … Das wahre Denken aber ist immer gefährdet u gefährlich.«), klingt schon vieles von dem an, was den Briefwechsel für beide Korrespondenten in den kommenden Jahren zum unersetzlichen Dialog – und noch heute zum großen Leseerlebnis macht: rückhaltlose Offenheit, scharfe Argumentation, das Spiel mit Ideen und Gedanken, das Aufnehmen von Anregungen und Fragen, die Lust an Zuspitzung und Provokation, auch eine gewisse Freude an Klatsch und Häme. Die Ungeduld und Neugier, mit der die Gegenbriefe zumeist erwartet wurden, ist auch nach Jahrzehnten noch spürbar.
Im Verlauf der Brieffreundschaft, nach ersten persönlichen Begegnungen (die Benn allerdings genau zu dosieren versteht, man blieb zeitlebens beim »Sie«) und regelmäßigen Kaffee-, Rum- und Blumensendungen Oelzes, nimmt auch das Private und Privateste immer mehr Platz ein, häufen sich Fragen nach Lebensumständen und Krankheitsverläufen, nach Reisen, Begegnungen, Familienverbindungen. Gerade Benn interessiert sich lebhaft für Oelzes großbürgerliches Milieu, für Kleidervorlieben und Eßgewohnheiten, die sich so deutlich von seinem eigenen Dasein unterscheiden – die in Hannover gemietete Wohnung sei »mehr eine Höhle für Molche u. Menschenfeinde als ein Renaissancebau «, läßt er den Bremer Villenbesitzer am 9. Dezember 1935 wissen. Als dieser ihn in seiner Garnison besucht, erhält die Geliebte Tilly Wedekind am 11. Juni 1936 ein genaues Porträt: »Oe. sah extravagant elegant aus. Wirklich ein merkwürdiger ungewöhnlicher Typ, gänzlich undeutsch. Sieht älter aus, als er ist (45 J.), Haar fast weiß, sehr schlank, schmales spitzes Gesicht, Gesichtsfarbe rötlich wie bei Lungenkranken, unwahrscheinlich gut angezogen. Er sieht eigentlich aus wie aus einer Revue, Hoffmanns Erzählungen, am Rand von Wirklichkeit und Halluzination.« Die daran anschließende Überlegung, ob Oelze »im Unterbewußtsein doch homo« sei, hindert Benn jedenfalls nicht, in seine Briefe an den Freund gelegentliche Berichte über Liebschaften und Amouren einzustreuen und diesen zu ermuntern, es ihm gleichzutun: »Noch sind Sie nicht 50. Der Abend des Lebens hat noch nicht sein Zwischenreich begonnen. Noch ist es etwa zwischen 4 u. 5, Theestunde, u. die charmanten Achtzehnjährigen bezaubern noch u. gefährden und beglücken. Erhalten Sie sich das! Erhalten Sie es mir!« (1. Januar 1939) Oelze geht über dergleichen meist diskret hinweg. Und lenkt das Gespräch wieder auf das, was ihm das Wichtigste geworden ist: Benns Werk.
Für solch emphatischen Zuspruch dürfte Benn gerade zu Beginn ihrer Bekanntschaft besonders empfänglich gewesen sein. Seit Anfang der dreißiger Jahre hatten die politischen Auseinandersetzungen unter Schriftstellern und Künstlern noch einmal an Schärfe gewonnen, prallten die weltanschaulichen Gegensätze mit zunehmender Wucht aufeinander. Thea Sternheim, Exfrau Carl Sternheims und Freundin Benns, notiert am 28. November 1931 in ihrem Tagebuch nach einem Besuch Franz Pfemferts und Heinrich Schaefers, wie schwer es sei, den »Jargon der Klassenwahnsinnigen aller Kategorien zu ertragen. Ob sie nun über Benn herziehen oder mit nicht misszudeutender Befriedigung für die kommenden Monate die Diktatur des Proletariats ankündigen – was kann man in dieser mit Bluträuschen aller Art durchzogenen Welt anders tun als sich auf sein Martyrium vorbereiten.« (Gottfried Benn / Thea Sternheim, Briefwechsel und Aufzeichnungen. Göttingen 2004) Wie groß die Enttäuschung unter vielen von Benns Freunden über seine Versuche war, die politischen Umwälzungen nach 1933 als geschichtliche Notwendigkeit zu deuten und mit Reden wie »Der neue Staat und die Intellektuellen«, »Zucht und Zukunft « oder der berüchtigten »Antwort an die literarischen Emigranten« zu verteidigen, läßt sich in Thea Sternheims Tagebüchern in erbitterten Eintragungen nachlesen (»Welch ein Jammer ein ganzes Volk sich dem Veitstanz der absoluten Entmenschung einreihen zu sehen. Und zu diesem Reigen erniedrigt sich ausgerechnet Gottfried Benn aufzuspielen! «). Mit dieser Begleitmusik hatte es allerdings bald wieder ein Ende. Die Akademie der Künste (»eine glanzvolle Angelegenheit«), in die er 1932 gewählt worden war und für die er, im Glauben, so deren Souveränität sichern zu können, noch im März 1933 eine Loyalitätserklärung zum neuen Regime mitverfaßt hatte (woraufhin Thomas Mann, Alfred Döblin, Jakob Wassermann, Ricarda Huch und etliche weitere Mitglieder austraten oder ausgeschlossen wurden, nachdem zuvor schon Käthe Kollwitz und Heinrich Mann hinausgedrängt worden waren), betrat er von 1934 bis zum Ende des Krieges nicht mehr. Was von dort komme, schreibt er Oelze am 5. September 1935, zeige einen »Tiefstand an Moral, innerer Makellosigkeit, aber auch rein gesellschaftlichem Schliff, dafür Überfluss an formellem Knotentum, läppischer Gesinnung, auch Unverschämtheit, dass ich ganz bestürzt bin. ›Auslese nach unten‹, Darwinismus rückwärts – das wäre die Formel, die über allem schwebt.« Viele der alten Bekannten und Kollegen waren emigriert, ein offener Austausch nicht mehr möglich. Am 1. September 1935 antwortete Benn auf eine von Oelzes Ergebenheitsadressen: »Bitte schreiben Sie doch nicht davon, dass ich Sie geistig entwickelt habe u. s. w. Ich bedarf Ihrer ja viel mehr. Sie machen sich nicht klar, wie völlig isoliert ich bin, ohne jede Beziehung geistiger Art zu meiner Umwelt. Meine Umwelt ist z. Z. nicht in diesem Land.« Schon nach Hitlers Juni-Morden hatte er am 27. August 1934 an Ina Seidel geschrieben: »Ich lebe mit vollkommen zusammengekniffenen Lippen, innerlich u. äußerlich. Ich kann nicht mehr mit. Gewisse Dinge haben mir den letzten Stoß gegeben. Schauerliche Tragödie! Wie groß fing das an, wie dreckig sieht es heute aus. Aber es ist noch lange nicht zu Ende.« Benn gibt 1935 seine Praxis auf und wird, als »aristokratische Form der Emigrierung« (an Oelze am 18. November 1934), Oberstabsarzt der Wehrmacht in Hannover. 1936 erscheint ein Angriff gegen ihn in der SS-Wochenzeitung »Das schwarze Korps«, 1938 wird Benn aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und erhält damit Veröffentlichungsverbot. Schon 1937 hatte er sich als Gutachter in Fürsorge- und Rentenfragen nach Berlin ins Oberkommando der Wehrmacht versetzen lassen; 1943 wird die Dienststelle nach Landsberg an der Warthe verlegt, von wo aus Benn 1945 nach Berlin flieht. Seine zweite Frau Herta schickt er am 5. April vor der heranrückenden Front nach Neuhaus an der Elbe, wo sie sich am 2. Juli das Leben nimmt.
Mit der von Oberst Fritz Ohmke nach Kriegsende auf Benns Bitte versandten Nachricht setzt der hier abgedruckte Ausschnitt des Briefwechsels ein. Nach der im Chaos der Nachkriegstage unterbrochenen Verbindung stehen zunächst die Schilderung des Überlebens, das Resümee der Verluste im Vordergrund. Doch schon bald geht es darum, geistig Bilanz zu ziehen, erste Ausblicke auf das Kommende zu wagen. Die drängenden Fragen der Zeit spielen in diesen auf ein vertrautes Gespräch gestimmten, um ein Werk und seinen Schöpfer kreisenden Briefwechsel, der zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts gehört, immer wieder hinein, wie die durch Walter von Molos offenen Brief an Thomas Mann ausgelöste Kontroverse zwischen Exil-Schriftstellern und Autoren der sogenannten Inneren Emigration, wer über die Nazijahre und Deutschlands Niederlage überhaupt zu reden berechtigt sei. Doch Politik und Moral, schreibt Oelze am 12. Dezember, böten längst keine Hilfe mehr: »Die alten Schemen wollen nicht mehr passen, die politischen nicht mehr, und die moralischen nicht mehr; die Ideologien aller Parteien sind von der Wirklichkeit längst überholt, aus ihnen ist kein revolutionärer Auftrieb mehr möglich.« Die Zukunft, davon ist er überzeugt, liegt allein im Geistigen, in der Kunst. Und Kunst, hatte er von Benn gelernt, ist »Herstellung von Wirklichkeit« (22. Dezember 1943). Die dafür notwendigen Gründungsurkunden und Geheimpapiere befinden sich ohnehin in seinem Besitz, nun geht es darum, sie an die Öffentlichkeit zu bringen und ihre Wirkung tun zu lassen. Er glaube, schreibt Oelze am 16. November 1945 an Benn, »daß die grosse Periode Ihrer öffentlichen Anerkennung und Ihrer Wirkung ins Weite etwa um 1950 herum beginnen wird«. Eine allen persönlichen Wunschgedanken zum Trotz sehr hellsichtige Prophezeiung. 1949 erscheinen vier Bücher Benns, 1951 erhält er den Büchner-Preis, 1953 das Bundesverdienstkreuz. Am wiedererwachten öffentlichen Interesse hatte auch »Bennpartner« Oelze großen Anteil, als Berater, Freund, Mäzen. Doch der Mann im schwarzen Trikot scheute zu Lebzeiten das Licht der Öffentlichkeit. Mit dem Abdruck seiner Briefe hat er die Tarnkleidung endlich abgelegt.
Matthias Weichelt
SINN UND FORM 1/2016, S. 33-37
