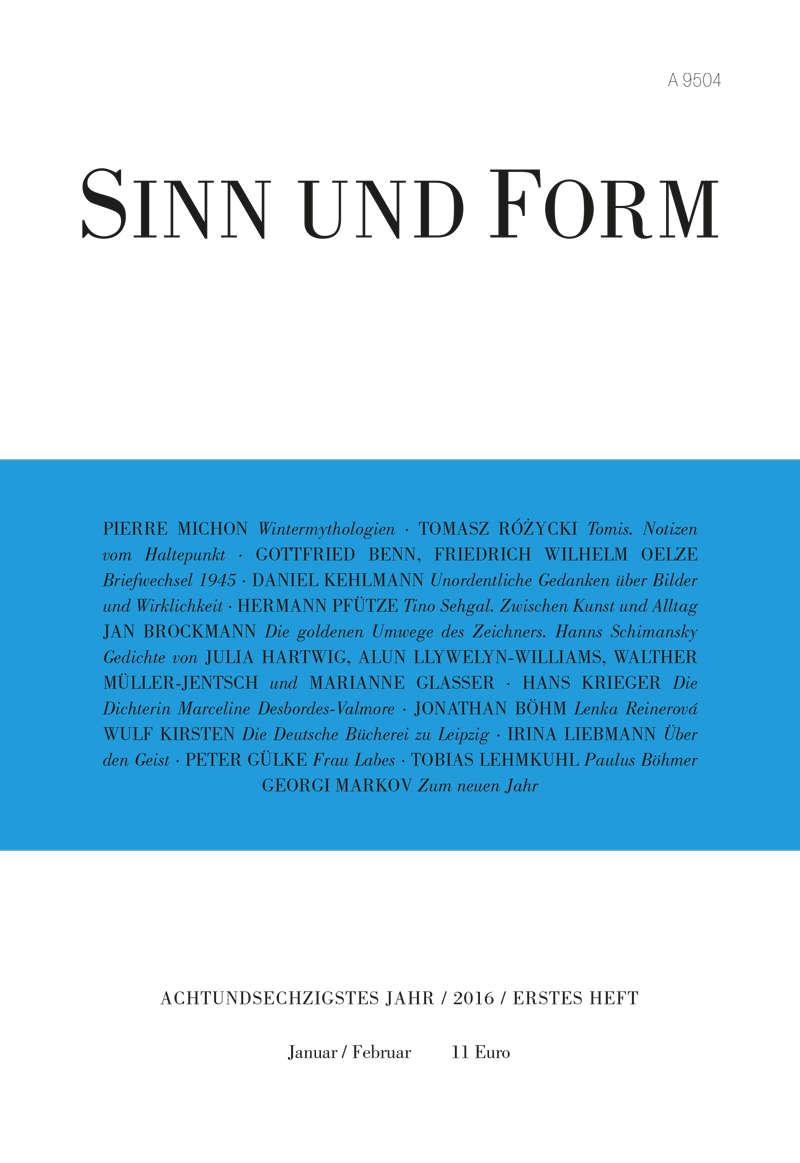Leseprobe aus Heft 1/2016
Kehlmann, Daniel
Der Apfel, den es nicht gibt.
Unordentliche Gedanken über Bilder und Wirklichkeit
I
Wer in diesen Tagen eine Ausstellung schöner Dinge eröffnet, muß auch von den häßlichen reden. Wer laut über Schönheit nachdenkt, muß im Verdacht der Gefühllosigkeit stehen, als wollte er sie mit Gewalt nicht sehen, die Fliehenden, die überfüllten Boote, die in Lastwagen Erstickten, die Menschen hinter Stacheldrähten und die Mordbanden, die im Namen der Religion Köpfe abschneiden. Das Schlimmste passiert gerade jetzt, und natürlich ist es nahezu blamabel, so zivilisiert hier zu stehen, als passierte es nicht. Wie also den Übergang finden, wie sich hinüberretten zur Schönheit?
II
Wer durch diese Räume geht, wird wohl auch vor Willem van Haechts »Apelles malt Kampaspe« stehenbleiben. Das Bild verdoppelt die Realität: in einem Raum voller Gemälde ein Gemälde, das einen Raum voller Gemälde darstellt. Van Haechts Gestalten des Malers, des Modells, des mächtigen Herrschers und der Umstehenden sind letztlich weniger interessant als ihr wundervoll reicher Hintergrund: ein heller Museumsraum, an dessen Rückwand sich ein Torbogen auf einen weiteren Raum voller Bilder und Statuen öffnet, an dessen Rückwand sich als traumartige Versprechung ein weiteres Tor zu einem weiteren Raum befindet. Es könnte einen die Lust anwandeln, statt durch die echte durch die imaginäre Ausstellung zu gehen und statt des Städels bloß van Haechts Bild zu besuchen. So imaginär sein Museum ist, so echt ist doch die Ausstellung darin: Vorlage war die vom Künstler selbst als Kurator betreute Sammlung des Antwerpener Gewürzhändlers Cornelis van der Geest. Da sind Rubens’ »Amazonenschlacht« und Renis »Kleopatra«, da sind Tizian, van Dyck und Domenichino, und da sind viele Bilder, die heute nicht mehr identifizierbar und nirgendwo sonst erhalten sind als auf diesem Bild, das ein schlechthin vollkommenes Museum ohne Anmaßung und falsche Sakralität zeigt, eine scheinbar unordentliche, aber innerlich wunderbar geordnete Heimstätte der Kunst.
Van Haecht malte sie im Jahr 1630. Er malte sie als Bürger eines Landes, das seit zweiundsechzig Jahren in einen Krieg mit Spanien, der führenden Großmacht der Welt, verwickelt und außerdem seit zwölf Jahren vom blutigsten Schlachten der europäischen Geschichte umgeben war, das man damals naturgemäß noch nicht das Dreißigjährige nennen konnte und das den Norden des Kontinents in einer Weise verwüstete, wie wir es uns unter Aufbietung unserer ganzen Phantasie nicht vorstellen können. Wir beschweren uns über die Wespenplage dieses heißen Sommers, aber in jenen Jahren gab es eine Wolfsplage, und dieses Wort bedeutet genau das, was wir uns darunter vorstellen und wovon heute noch unsere Märchen erzählen, und dazu war die lange Pestepidemie noch immer nicht vorbei, und auf den Scheiterhaufen brannten in katholischen wie protestantischen Landen Menschen unter der Anklage der Hexerei, insgesamt über hunderttausend. All das ist keine schwarze Folklore. Willem van Haecht malte diesen hellen und friedlichen Dialog der Meisterwerke in einem der schlimmsten Momente der Geschichte. Das Bild selbst scheint das nicht zu wissen, einzig die auftrumpfende Figur des Monarchen vorne bringt eine Ahnung von der Anmaßung der Mächtigen herein.
Was ist wirklich geblieben aus dieser Zeit – geblieben in dem Sinn, daß es uns noch vertraut und nahe ist? Dieses Bild und viele der Bilder, die es zeigt, und andere Bilder und einige Gedichte und große Musik. Ich meine das nicht im Sinn einer Phrase wie »Die hehre Kunst überdauert alles«. Erstens überdauert auch die hehre Kunst meist nicht, und zweitens bin ich nicht sicher, ob das Vergehen, Verwehen, Verschwinden und Vergessen des millionenfachen Menschenleids so eine erfreuliche Sache ist. Die großen Verbrechen werden, ist genug Zeit vergangen, zu spannenden Schauergeschichten, und die Schmerzen, die sie verursachten, bestenfalls zum Detail im Geschichtsbuch. Die Kunst ist für die Wahrheit da, aber diese findet ihren Ausdruck im Schein – ein Wort, das schon Hegel im Bewußtsein seines Doppelsinnes von Glanz und Illusion verwendet hat, oder stärker ausgedrückt: von Licht und Lüge.
III
Nun muß ich doch meine Kunstlehrerin erwähnen. Ich wollte es nicht, aber es läßt sich nicht vermeiden. Sie hat sich wohl nicht träumen lassen, daß einmal im Städel von ihr die Rede sein könnte. Aber ich verdanke ihr viel. Hat sie mein Interesse für Malerei geweckt? Das kann man beim besten Willen nicht behaupten. Ich hatte ein paar großartige Lehrer. Sie gehörte nicht dazu.
Ihr Hauptanliegen bestand darin, von uns Schülern in Ruhe gelassen zu werden, damit sie Zeitung lesen konnte. Also stellte sie irgendeinen per se schon wenig einnehmenden Gegenstand vor uns hin – eine Blumenvase, eine Lampe, eine unglücklich blickende Puppe –, forderte uns auf, ihn abzuzeichnen, und verstummte. An einem besonders tristen Vormittag bestand die Aufgabe darin, unseren Ärmel zu zeichnen. »Schaut darauf, schaut, wie der Stoff Falten wirft, und dann zeichnet das!«
Es verging eine quälende Stunde, in der ich Stifte kratzen hörte und sah, wie andere rechts und links von mir das hinbekamen, manche gut, manche weniger gut, viele, so wie ich, überhaupt nicht. Ich wurde immer verzweifelter, weil dieser schreckliche Stoff meines Ärmels, den ich doch so deutlich sah, sich weigerte, den Weg aufs Papier zu nehmen. Ich versuchte es immer wieder, aber jedesmal entstand nur ein unförmiger Fleck mit ein paar hellen und ein paar dunkleren Stellen, der wirklich nicht meinem Ärmel ähnlich sah. Wenn jemand nachfragte, wurde die Lehrerin ungeduldig. »Schau doch einfach hin!« Und ihr Gesicht verschwand wieder hinter den Schlagzeilen.
Also schaute ich hin. Und das half nichts! Wie konnte das sein? Denn es klang ja so überzeugend, was sollte man denn noch tun als einfach hinschauen! Und doch ging es nicht.
Damals, mit zehn Jahren, begriff ich, was es heißt, begabt zu sein. Ich begriff es, weil mir klar wurde, daß ich unbegabt war. Daß es eine Verwandlung gab, zu der andere imstande waren, ich aber nicht. Und noch etwas verstand ich: daß das Hinschauen allein niemals nützt. Nicht beim Zeichnen, nicht beim Geschichtenerzählen. Daß es eine Technik gibt, daß jemand dir erklären muß, wie man es macht, denn auch das einfachste Abbilden ist ein Vorgang der Transformation. Vor kurzem fand ich eine ähnliche Kunstunterrichtsituation im Roman »Der Scheiterhaufen« des ungarischen Schriftstellers György Dragomán wieder, da allerdings geschildert aus der Sicht eines im Unterschied zu mir begabten Mädchens. Ihr Lehrer fordert sie auf, einen Baum abzuzeichnen:
»Der Kohlestift sitzt auf dem Blatt, die Bewegung in meiner Hand, ich weiß schon, daß es gut wird, diese Linie wird gut, so wie es sein muß, und ich weiß, man darf das nicht denken, ich darf mich nicht darum kümmern, ob es gut wird, sicher, wenn es schlecht wäre, müßte ich mich darum kümmern, doch wenn es gut ist, spielt es keine Rolle, es bedeutet nur, daß man nicht aufhören muß. Das Papier ist weiß, die Kohle schwarz, der Zeichenlehrer hat nicht erklärt, was das bedeutet, ich führe den Kohlestift, und wie sich die Knorren des Baumstammes aus der Linie herausbilden, begreife ich es. Es bedeutet, daß man dumm sein muß, beim Zeichnen muß man dumm sein, nicht blind und nicht eingebildet, sondern einfach nur dumm genug, um zu akzeptieren, daß die Linie nur eine Linie ist, auch dann, wenn sie sich für mehr ausgeben will.«
Denn die Außenwelt kommt nicht in runder und bunter Vollständigkeit zu uns, die man nur passiv betrachten muß, wir setzen sie kontinuierlich und unter erheblichem Aufwand zusammen. Strecken Sie den Arm aus und blicken Sie auf Ihren Daumennagel, so klein ist der Fleck, den Sie scharf und farbig sehen können, größer nicht. Alles darum herum glauben Sie nur zu sehen, aber Sie sehen es nicht, sondern erinnern sich nur daran, daß Sie es soeben oder vorhin oder irgendwann gesehen haben oder meinen es gesehen zu haben, und setzen es aus vagen und oft nicht korrekten Erinnerungen zusammen, und das, was dabei herauskommt, ist löchriger, als wir meinen. Da ist natürlich der blinde Fleck in der Mitte unseres Blickfeldes, den unser Bewußtsein einfach ausblendet, und da ist der noch viel größere blinde Fleck des Raumes hinter uns, den wir nicht sehen, ohne uns überhaupt darüber zu wundern, daß diese große Dunkelheit nicht in irgendeiner Form in unserem Gesichtsfeld auftaucht – warum ist da keine schwarze Leere, sondern buchstäblich nichts, also auch keine Abwesenheit? Weil unser Bewußtsein sogar das Nichts eskamotieren kann. Unsere Augen bewegen sich unablässig, unser Gehirn ist dauernd damit beschäftigt, aus dem Nacheinander der Eindrücke ein Nebeneinander zu machen, ein stabiles Modell von Dingen in einem in drei Dimensionen ausgespannten Raum. Die Welt, wie sie uns wirklich entgegentritt, sieht einem Braque ähnlicher als einem Watteau. Die Verwandlung eines aufwendig konstruierten Objekts in dessen zweidimensionale Abbildung ist ein komplizierter Vorgang: Man braucht Technik, Können und Erfahrung, man darf die Dinge nicht als Dinge sehen – eben das meint Dragománs Heldin damit, daß man dumm werden müsse. »I am a camera« heißt Christopher Isherwoods berühmter Reportagenband; ein schöner Titel, aber die Wahrheit ist, daß kein Mensch eine Kamera ist, und sogar eine Kamera braucht eine Menge Linsen und komplizierte Manipulationen des Lichtwegs, damit eine scheinbar simple Abbildung entsteht und wir meinen können, die Realität wäre etwas, das sich fangen läßt wie ein Fisch im ausgeworfenen Netz.
(...)
SINN UND FORM 1/2016, S. 64-75, hier S. 64-