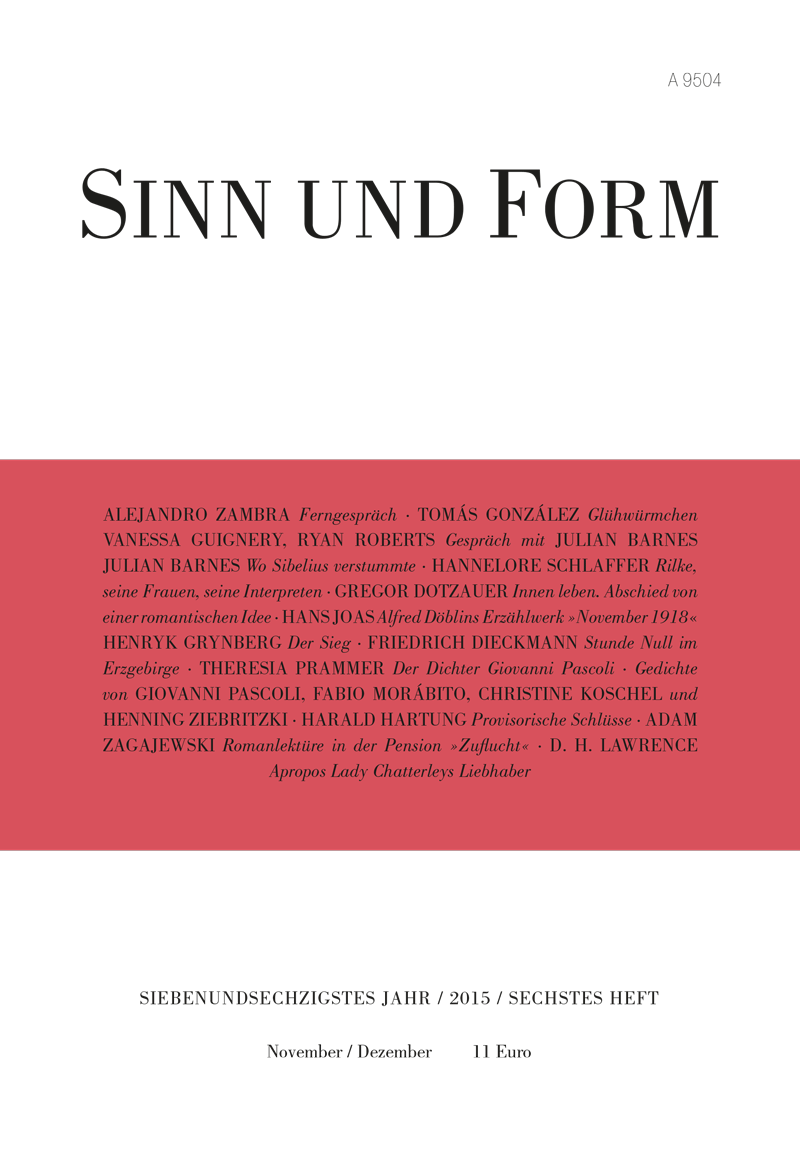
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-26-3
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 6/2015
Prammer, Theresia
MÖNCHSGRASMÜCKEN, TAMARISKEN, BEKASSINEN
Der Dichter Giovanni Pascoli
oci oci oci oci oci oci,
fi fideli fideli fideli fi,
ci cieriri ci ci cieriri,
ci ri ciwigk cidiwigk fici fici.
Oswald von Wolkenstein
chioccola il merlo, fischia il beccacino;
anch’io torno a cantare in mio latino.
es flötet die Amsel, die Schnepfe schlägt ein;
auch ich singe weiter in meinem Latein.
Giovanni Pascoli
Obwohl im deutschen Sprachraum bis heute kaum bekannt, war Giovanni Pascoli (1855 –1912) einer der großen Dichter des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Für Pier Paolo Pasolini, der ihm bereits in jungen Jahren ein Buch gewidmet hatte, stellte sein poetisches Denken und Wirken sogar die Grundlage der italienischen Gegenwartslyrik dar. Wie sein Lehrer, der Bologneser Universitätsprofessor Giosuè Carducci, verband Pascoli die Universitätslaufbahn mit der Berufung des Dichters. Sein Werk umfaßt Oden und Hymnen ebenso wie spirituell gefärbte Verse; die exaltierten Züge des Fin de siècle spiegeln sich darin und lassen doch Raum für das Privat-Alltägliche, Erlebte, »Nicht-zu-Erfindende« (Pascoli). Dem aulisch-rhetorischen Gestus D’Annunzios stand Pascoli trotz gegenseitiger Wertschätzung eher distanziert gegenüber; seine besten Dichtungen bleiben symbol- und bildverhaftet, mit suggestiven Ausrufen und fragmentarischen Einsprengseln direkter Rede.
Der Gegensatz zwischen urbaner, gesellschaftlicher Realität und ländlich-bäuerlicher Intimität bildet den Hintergrund seiner wichtigsten Gedichtbände »Myricae « und »Canti di Castelvecchio«. In ihnen verknüpft sich das Heimweh nach dem »Nest«, dem Hort vertrauter Räume und familiärer Zuneigungen, mit einer obsessiven und groß artigen Präzision im Hinblick auf Orte und Schauplätze, botanische und zoologische Kategorien und Begriffe.
Einen Gutteil seines Werks hat Pascoli seinem unbestrittenen Lebensthema, nämlich der individuellen und überindividuellen Erfahrungsdimension des Kindseins gewidmet. In dem vielbeachteten Essay »Das Knäblein. Poetik und Poesie« (»Il Fanciullino«) wendet er sich gegen alles Proklamatorische (das ihm in seinen patriotisch-politischen Gedichten allerdings selbst nicht fremd ist) und plädiert für die Aufwertung elementarer kindlicher Mythen und Erinnerungen. Diese erscheinen ihm universell und vermittelbar, sofern der Dichter sich nicht auf die Rolle des »Redners oder Predigers«, des Philosophen, »Historikers, Lehrers, Volkstribuns oder Demagogen, Staatsmanns oder Höflings« beschränkt, sondern seine Berufung zur Erziehung der Gefühle erkennt. Dabei steigern sich reale Erlebnisse mitunter zu wachtraumartigen Visionen. Die Ermordung des Vaters, die Pascoli mit knapp zwölf Jahren verwinden mußte, ist eines davon und findet in zahlreichen Gedichten ihren Niederschlag: Ruggero Pascoli, Verwalter des Landguts »La Torre«, fiel 1867 auf dem Heimweg von der nahen Stadt Cesena einem brutalen Anschlag zum Opfer. Die Hintergründe, ob politisches Komplott oder Begehrlichkeiten um den Posten des Vaters, wurden nie geklärt. Der Täter jedenfalls entging der Strafe; kollektives Schweigen, Banditentum und Verschleierung von Fakten hielten die Ermittlungen über Jahre auf. Die Familie mußte das Wohnhaus aufgeben und aufs Anwesen der Mutter nach San Mauro übersiedeln. Caterina Pascoli überlebte ihren Mann nur um wenige Monate, danach wurde, der Not gehorchend, auch ihr Elternhaus veräußert. Aufgrund eines Verdachts stellten die Brüder eigene Nachforschungen zur Identität des Mörders an; Morddrohungen und Repressalien waren die Folge. Weitere Todesfälle ereilten die Familie: Pascoli verlor kurz nacheinander zwei seiner Geschwister.
Die Wege der Hinterbliebenen trennten sich: Die Schwestern Ida und Maria wurden im Kloster von Sogliano am Rubikon ausgebildet, Pascoli begann seine Universitätslaufbahn und schloß sich der sozialistischen Bewegung seines Heimatlandes an. Von Schuldgefühlen geplagt, holte er die Schwestern später wieder zu sich, denen er bis zu seinem Lebensende in einer Art Schmerzensgemeinschaft verbunden blieb. Idas Heirat empfand Pascoli, der zum Wohl der Familie auf eine eigene Ehe verzichtet hatte, als Verrat. Dennoch unterstützte er sie und ihren Mann wie auch den unsteten Bruder Giacomo noch jahrelang.
Die überaus enge, einer Liebesbeziehung nicht unähnliche Bindung an die Schwestern hat Pascolis späte Jahre mehr als alles andere bestimmt und seine Exegeten zu ebenso wunderbaren wie wildwüchsigen Mutmaßungen beflügelt. (Cesare Garboli etwa prägte das merkwürdige Wort vom »lesbischen Pascoli«.) Dieser selbst interessierte sich mehr und mehr für das Unbewußte und brachte es zu beachtlichem psychologischen Tiefblick.
»Mögen sie um das alte Grab meiner jungen Mutter herum wachsen und blühen, diese herbstlichen myricae«, schreibt Pascoli im gleichnamigen, an Vergils »Bukolika« angelehnten Band. Die fein verästelten Tamarisken also werden aufgerufen, um dem Trauernden Trost zu spenden, erneuern aber auch die Trauer, indem sie symbolisch auf die Vergänglichkeit verweisen. Die wichtigsten poetischen Repräsentanten seiner Kindheitsorte sind in den »Myricae« wie den »Gesängen aus Castelvecchio« die Vögel des Apennin. Die Rufe der Nachtigallen und Buchfinken, Zeisige und Eichelhäher, Bekassinen und Mönchsgrasmücken haben es Pascoli angetan, nebst ihren Brutgewohnheiten, Flugstrecken und dem Farbenspiel ihres Gefieders. (Tierlaut und Vers sind im Italienischen übrigens ein und dasselbe Wort: verso.) Seine volksetymologischen Erkundungsgänge und Wechselgesänge von Mensch und Tier bringen eine Naturverbundenheit zum Ausdruck, die weit über eine bloße Evokation von Naturerscheinungen hinausgeht. Eine nicht selten pathetische und metaphorisch überhöhte Identifikation mit anderen Lebewesen kommt hier zum Tragen. Das belegen wiederkehrende Motive wie der Vergleich der verwaisten Familie mit einem verlassenen Schwalbennest oder das sentimentale Porträt der »grauen Stute«, die die Kutsche des Vaters zog und nach seiner Ermordung in den Zeugenstand berufen wurde, wo sie wiehernd sogar den Namen des Täters angedeutet haben soll. Eine solche Identifikation liegt schließlich auch der Analogie von dichterischer Sprache und Vogeljagd zugrunde: »In der Tat«, schreibt Pascoli, »gleicht der Schriftsteller oder Redner, der zwei Wörter für eine Idee verschwendet, dem Vogeljäger, der zwei Patronen auf ein Rotkehlchen verschießt und es dennoch nicht erwischt.« (»Anmerkung« zu den »Gesängen aus Castelvecchio«)
Wohl um frühere Versäumnisse zu kompensieren, kam es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter italienischen Kritikern zu einem regelrechten Wettstreit in der Pascoli-Auslegung. Cesare Garboli faszinierte die Mischung aus kosmischem Schwärmen und intimer Zartheit, Gian Luigi Beccaria interessierte vor allem Pascolis weitgehend auf Klangfarben, Tonwerte, Lautmalereien und Anagrammstrukturen gründende Poetik, die das Terrain der »bekannten Sprache« und die »verbindliche Tradition hoher und ›nachahmenswürdiger‹ Beispiele« hinter sich lasse – zugunsten einer noch unbekannten oder untergegangenen Sprache, »die auf dem Grunde der bekannten gesucht« werden müsse.
Auch als Verfasser neulateinischer Gedichte erlangte Pascoli eine außergewöhnliche Meisterschaft: dreizehnmal gewann er den Amsterdamer Preis für lateinische Poesie. In seinen »Gedanken zum Schulwesen« polemisiert er gegen den Vorschlag, den Griechischunterricht abzuschaffen, und kommt zu dem Schluß: »Die Sprache der Dichter ist immer eine tote Sprache«. Doch fügt er gleich hinzu: »Sonderbare Aussage: eine tote Sprache, verwendet, um dem Denken größere Lebendigkeit zu verleihen.« Hier spricht Pascoli in eigener Sache; die Werke der Klassiker sind für ihn »kleine Lämpchen, die auch im Grab weiter zu leuchten vermögen«. In der Spannung zwischen individuellem Erinnern und emotionalem Gehalt überlieferter Begriffe bereichern und erneuern sie die Sprache und ermöglichen es dem Dichter, der an sie anknüpft, in andere Rollen zu schlüpfen. So wählt Pascoli seinen Standpunkt in der Vergangenheit, um Gegenwart und Zukunft träumerisch Gestalt zu geben – eine bewährte Strategie im Umgang mit Verlusterfahrungen (Traum steht gegen Trauma).
SINN UND FORM 6/2015, S. 830-840, hier S. 830-833
