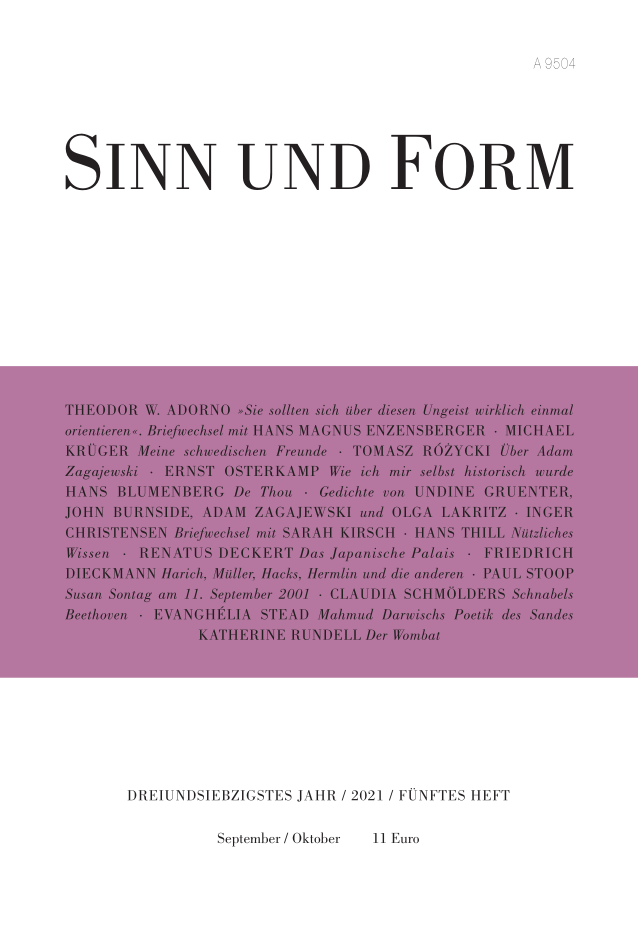
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-61-4
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2021
Stoop, Paul
Der Schmerz der anderen, Susan Sontag am 11. September 2001
»Und wo warst du, als …?« Es gibt weltpolitische Ereignisse, die den mit Radio und Fernsehen aufgewachsenen Generationen dauerhaft in Erinnerung geblieben und auch Jahrzehnte später noch Gesprächsthema sind: »Ich war gerade in XY, als die Nachricht kam …« Der Tag des Mauerbaus, der Tag, an dem John F. Kennedy erschossen wurde, der Tag des Mauerfalls. Und zuletzt vor genau zwanzig Jahren die Terrorangriffe auf das World Trade Center und das Pentagon.
Am 11. September 2001 schaute die ganze Welt zu, wie in einer Metropole zwei Wolkenkratzer, in denen Tausende Menschen arbeiteten, nach dem Angriff mit zwei gekaperten Passagierflugzeugen in Brand gerieten und einstürzten. Wer konnte, floh aus dem Gebäude, Hilfskräfte gingen unter Lebensgefahr hinein, verzweifelte Menschen sprangen aus höheren Stockwerken in den Tod – vor den Augen der Öffentlichkeit.
Eine hellsichtige New Yorkerin, die Verwandte, Freunde und Bekannte in der Stadt wußte, erlebte die Anschläge aus großer Entfernung. Für Susan Sontag manifestierte sich das Geschehen nicht direkt durch Lärm, Gestank oder den Staub, der sich über große Teile Manhattans legte, sondern in Fernsehbildern. Bilder waren für sie schon immer von größter Bedeutung. Nichts in ihrem Leben, schrieb sie in ihrer Essay-Sammlung »Über Fotografie« (1977), habe einen so »einschneidenden, tiefen, unmittelbaren« Eindruck auf sie gemacht wie die dokumentarischen Fotos vom Mord an den europäischen Juden, die sie als Zwölfjährige in einer Buchhandlung betrachtete.
Jahrzehntelang widmete Sontag der spezifisch modernen Wahrnehmung von Tod und Leiden, die uns durch dieses Medium vermittelt wird, besondere Aufmerksamkeit. Anfang 2001 hielt sie in Oxford einen Vortrag über den Schmerz der anderen, den wir aus räumlicher und zeitlicher Distanz wahrnehmen, vor allem durch Fotos von Kriegsreportern. Diese Überlegungen bildeten die Grundlage für ihr letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Buch, »Das Leiden anderer betrachten« (2003), in dem sie ihre frühere Auffassung revidierte, die Fülle von Abbildungen ferner Kriegsgreuel führe zu Abstumpfung.
Eine eigene zeitliche Distanz zum 11. September 2001 konnte Susan Sontag nicht mehr herstellen. Sie starb Ende 2004. Ihre unmittelbare Einordnung der Ereignisse löste aber eine heftige Kontroverse aus. In einem kurzen Text brachte sie nicht ihr Entsetzen über den Massenmord zum Ausdruck, sondern attackierte die Rhetorik der amerikanischen Regierung und der vermeintlich angepaßten Medien. Besonders ihr Satz über die Attentäter, »Feiglinge waren sie nicht«, empörte viele Kommentatoren. Sontag bestätigte nicht nur die vielen, die sie schon immer kritisiert hatten, sondern schockierte auch manche treuen Wegbegleiter.
Über ihre persönliche Situation in jenen Tagen ist bisher wenig bekannt. In der preisgekrönten Biographie von Benjamin Moser bleiben sie merkwürdig unterbelichtet. Moser beschreibt die Bilder, die damals live um die Welt gingen: »Unter den Millionen Zuschauern war Susan Sontag, die in Berlins Mitte im Hotel Adlon wohnte.« Dann läßt er seine Protagonistin für die 48 Stunden allein, die für die Weltöffentlichkeit die eindrücklichsten seit dem Mauerfall gewesen sein dürften. »Zwei Tage nach den Angriffen, als Susan in ihrer Adlon-Suite noch am Bildschirm klebte, bat ihre alte Freundin Sharon DeLano vom ›New Yorker‹ sie, etwas Kurzes für das Magazin zu schreiben.«
Die knappen Sätze suggerieren eine Entrücktheit dieser stets nervös-alerten Beobachterin des Zeitgeschehens: Sontag sitzt einsam im Hotel und schaut tagelang TV, allein, ohne sozialen Kontext, im Dialog nur mit sich selbst, eine Amerikanerin fern von daheim, die wohl auch deshalb zu einem unerhörten Urteil gelangt.
Wo war Sontag am 11. September? Sie war nicht »in ihrer Suite im Adlon«, als die Welt gebannt auf den Fernsehschirm sah. Sie war nicht allein, war nicht von der Möglichkeit des Austauschs abgeschnitten. Sie hatte am Abend sogar einen öffentlichen Auftritt, von dem Moser wohl ebensowenig wußte wie Daniel Schreiber, der 2007 die Sontag-Biographie »Geist und Glamour« veröffentlichte.
Im September 2001 war Sontag zehn Tage als »Distinguished Visitor« zu Gast in der American Academy in Berlin. Was wie eine große Ehre für die eingeladene Person aussieht, war in Wirklichkeit eine Ehre für die einladende Institution. Herausragende Literaten, Komponisten, Politikberater und Wissenschaftler aus den USA ihren Gast nennen zu dürfen, erforderte viel Geduld, wohlformulierte Bittbriefe und die diskrete Nutzung persönlicher Verbindungen zu potentiellen Gästen oder ihren Agenten. Die Korrespondenz zog sich manchmal über Jahre hin. Es galt, den Wunschgästen einen unvergeßlichen Aufenthalt zu versprechen und dann auch zu bereiten. Immer wieder gelang das. Die Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, Paul Krugman und Robert Shiller lebten für ein paar Tage in der Academy, der öffentlichkeitsscheue Filmemacher Terrence Malick und die Philosophin Judith Butler. Nun also Susan Sontag.
Die regulären Fellows der Academy, die seit 1998 in der Regel ein ganzes Semester in der Villa am Wannsee verbringen, werden schon umsorgt, betreut, bedient – sie sollen sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und sich mit Fachkollegen oder Vertretern aus der Politik austauschen können. Erst recht gilt das für die Distinguished Visitors, die während ihres Aufenthalts die ungeteilte Aufmerksamkeit des Academy-Teams erfahren und Vorträge halten.
So auch Sontag, der man die Zusage für zwei Abendveranstaltungen abgerungen hatte. Am 11. September stand ein Dialog mit György Konrád, dem Präsidenten der Akademie der Künste, auf dem Programm, am 13. September sollte sie aus ihrem Roman »In America« lesen. Mehr war für die Academy nicht drin, denn der Gast wollte in Berlin vor allem eines: möglichst viele Abende für Philharmonie und Oper freihaben. Das war der Kern ihres persönlichen Programms, dafür wurde alles getan. Selbst wenn ein Konzertabend seit Monaten ausverkauft war, mußte ihr der Besuch ermöglicht werden.
Einige Tage vor dem 11. September kam Sontag mit einem Jetlag in Tegel an. Etwas mürrisch stieg sie ins Auto und ließ sich zur Academy fahren. Worüber redet man in so einem Moment? Willkommen! Wie war Ihre Reise? Wann waren Sie zum letzten Mal in Berlin? Ah, vor fünf Jahren, da werden Sie viel Neues sehen können, in der Stadt hat sich seitdem viel getan. Aber nein, das interessiere sie überhaupt nicht, erwiderte die große amerikanische Intellektuelle, die als »europäischste« ihrer Art bewundert wurde. Sie wolle nur zum Savignyplatz, dem Zentrum des alten Westberlin, das sie noch aus Mauerzeiten kenne. Das Neue, der Osten, das Zusammenwachsen der lange geteilten Stadt, all das interessiere sie nicht. Nicht also im Adlon, sondern am Wannsee wohnte Sontag für diese zehn Tage. Und sie war nicht isoliert, sondern Teil einer wissenschaftlich-kulturellen Wohngemeinschaft auf Zeit, wo man sich gewöhnlich schon beim Frühstück traf, um über Gott und die Welt zu diskutieren oder auch zu schweigen.
Bei einem Empfang am 9. September stellten sich die Gäste einem illustren Kreis von Vertretern des Berliner Kunst-, Wissenschafts- und Politikbetriebs vor. Richard Holbrooke, sieben Jahre zuvor Initiator der Academy-Gründung, und der ehrenamtliche Academy-Präsident Bob Mundheim hatten es sich nicht nehmen lassen, für den außergewöhnlichen Semesterauftakt einzufliegen. Susan Sontag war der Stargast. Auch ein erstes Konzert besuchte sie an diesem Wochenende, in Begleitung unter anderem von Jane Kramer, der legendären Europa-Reporterin des »New Yorker «, die für ein Semester an den Wannsee gekommen war.
Am 11. September befaßten sich die Mitarbeiter der Academy gerade mit der Vorbereitung des ersten Susan-Sontag-Abends (Erinnerungsanrufe, finale Gästeliste, Tischordnung für das Dinner), als die ersten Anrufe und Mails kamen: Schaltet das Fernsehen an! In dem Moment begann eine neue Zeitrechnung. Fellows versuchten verzweifelt, Nachbarn, Verwandte und Freunde in New York zu erreichen, suchten nach alternativen Kommunikationswegen, hofften und bangten. Jedes TV-Gerät in der Academy-Villa war angeschaltet, von einem Apartment zum anderen tauschten sich die Gäste aus, manche sahen in der Bibliothek gemeinsam fern.
Am Nachmittag breitete sich die Gewißheit aus, daß ein ungeheures Ereignis die Normalität des Academy-Lebens zum Stillstand gebracht hatte. Die Leitung des Hauses beschloß, die Abendveranstaltung abzusagen, man befand sich im Ausnahmezustand, an einen geregelten Ablauf war nicht zu denken. Sofort fingen Mitarbeiter an, die angemeldeten Gäste anzurufen. Als Susan Sontag mitgeteilt wurde, daß der Dialog mit György Konrád ausfallen sollte, war sie außer sich. Das sei inakzeptabel, es gebe keinen Grund, wegen der Ereignisse in New York vom Plan abzuweichen, sagte sie und verschwand wütend in ihrem Apartment. Nach diesem Veto wurde neu beraten. Die Einigkeit über die Absage war dahin, doch der Präsident ließ dem Direktor Gary Smith den Vortritt. Der solle als Hausherr entscheiden. Das tat er – und gab dem Druck der Diva nach. Nun sollte Sontag doch wie geplant mit Konrád über die Rolle des Intellektuellen in der Gesellschaft diskutieren. Überschrieben war der Abend: »The Conscience of Words« (Das Gewissen der Worte).
Das übliche festliche Abendessen erforderte diesmal keine fein austarierte Sitzordnung. Die meisten der Angemeldeten kamen erst gar nicht an den Wannsee, entweder wegen der telefonischen Absage oder wegen ihrer natürlichen Intuition, daß es in diesem Moment nichts zu diskutieren gab. Viele Fellows saßen weiter vor den Fernsehgeräten, während die Academy Züge einer Festung annahm. Daß die Presseabteilung es ablehnte, den Fellows Stellungnahmen abzunötigen, wollte mancher Journalist nicht akzeptieren. Das Team eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders kletterte kurzerhand über den hohen Zaun. Mitarbeiter mußten die Eindringlinge hinausgeleiten.
Es wurde ein bizarrer Abend. Zwei Dutzend Zuschauer verteilten sich im Raum, der sonst bis zu hundert Menschen Platz bot. Der begrüßende Direktor erwähnte die »Katastrophe« von New York, was aber die beiden Protagonisten nicht veranlaßte, näher auf das Thema einzugehen. Konrád plädierte lediglich dafür, »nicht wortlos« zu bleiben, und Sontag stellte fest, man wisse noch zu wenig, und Ereignisse wie dieses gehörten wohl »zu einer Art Normalität«. Daher wollten sie und ihr Gesprächspartner nicht vom Programm abweichen.
Was folgte, war der Dialog eines müde wirkenden, nachdenklichen György Konrád mit einer hellwachen Susan Sontag, die sich mit dem Etikett einer »public intellectual « abzufinden vorgab (»aber nur, wenn Sie mich in erster Linie als Schriftstellerin bezeichnen«) und Konrád rasch die Rolle des Moderators abnahm. Inhaltlich war es eine Plauderei mit ein paar Höflichkeiten, Erinnerungen an frühere Treffen und Platitüden über die Rolle von Intellektuellen im allgemeinen.
Starke Worte kamen Sontag durchaus über die Lippen: »Das war die unanständigste, unverfrorenste, schrecklichste, obszönste, vulgärste und barbarischste Idee, die ich je gehört hatte.« Aber das bezog sich nicht auf die Katastrophe des Tages, sondern auf den Vorschlag, den ein sechzehnjähriger Freund der vierzehnjährigen Sontag gemacht hatte, nämlich gemeinsam Thomas Mann in Pacific Palisades zu besuchen und mit ihm über den »Zauberberg« zu reden. Natürlich habe sie dann trotzdem mitgehen müssen, nicht etwa, weil der »Zauberberg« ja doch ihr Lieblingsbuch war, sondern um den verehrten Thomas Mann »vor diesem Jungen zu schützen«. So vergingen die ersten Stunden nach dem Anschlag, der Sontag so wenig außergewöhnlich vorkam. Sie hatte die Ruhe, über ihr Leben als Intellektuelle zu plaudern.
Am 12. September sah sie wie geplant die vertraute Westberliner Gegend um den Savignyplatz wieder. In der Paris Bar, einem legendären Treffpunkt lokaler und internationaler Kulturmenschen, gab es einen Lunch mit Academy-Mitarbeitern. Am Abend des 13. September war der Academy- Saal gut gefüllt, und Sontag las ihre Suada gegen die Bush-Regierung und die Kommentare der Medien vor, die sie in den Stunden zuvor für den »New Yorker« verfaßt hatte. Auf dem Programm stand eigentlich eine Lesung aus ihrem neuen Roman, doch sie trug zunächst den aktuellen Text ohne weiteren Kommentar vor, bevor sie sich als die Literatin, als die sie wahrgenommen werden wollte, präsentierte. Die kühle Reaktion in der Academy war noch nichts verglichen mit der Abscheu, die ihr nach der Veröffentlichung im »New Yorker« entgegenschlug.
In Sontags Rückblick »Ein paar Wochen später«, den sie Anfang Oktober für die italienische Zeitschrift »Il Manifesto« schrieb (deutsch in der FAZ vom 15. Oktober 2001), ist ein gewisser Rechtfertigungsdruck zu spüren. Sie habe sich an jenem Nachmittag »in einem stillen Zimmer in einem Außenbezirk von Berlin« befunden. Aus dieser Stille hätten sie zwei Anrufe gerissen, sie sei zum Fernseher gestürzt und habe die nächsten 48 Stunden fast ausschließlich vor dem Bildschirm verbracht, bevor sie an den Laptop zurückkehrte und in aller Eile eine wütende Attacke gegen die hirnlose, irreführende Demagogie amerikanischer Regierungs- und Medienleute schrieb.
Trotzig hielt sie daran fest, das, was sie für den »New Yorker« geschrieben habe, sei ein »erster, aber leider nur allzu präziser Eindruck« gewesen. Und ihre Trauer über die Toten, die sie nach ihrer Rückkehr nach Manhattan beim Anblick der Verwüstung zu empfinden behauptete, erwies sich als selektiv. Sie galt Hausmeistern, Schreibkräften, Küchenhilfen in den Trümmern des World Trade Center sowie Feuerwehrleuten. Explizit ausgeschlossen blieben »die gutbezahlten, ehrgeizigen Angestellten der Finanzunternehmen, die dort ihre Räume hatten«.
Mit diesen nachgeschobenen Erklärungen konnte Sontag die Empörung über ihre Haltung nicht eindämmen. Es ist ihr aber gelungen, die Grundlage zu schaffen für die nun allgemein akzeptierte Darstellung der isolierten Beobachterin in einem Berliner Hotel, die vom Terror aus der Stille gerissen und vom ungewohnten TV-Konsum überwältigt wurde.
SINN UND FORM 5/2021, S. 702-706
