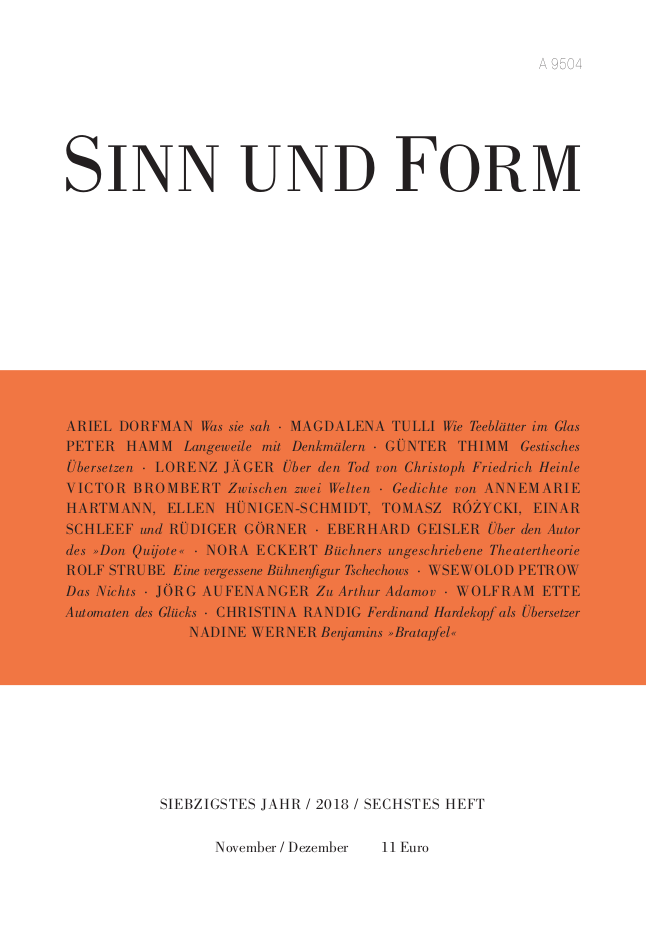Leseprobe aus Heft 6/2018
Ette, Wolfram
Automaten des Glücks
I.
Es gab in der Kindheit diese Kaugummiautomaten. Sie waren auf unserer Augenhöhe angebracht, dort, wo die Erwachsenen selten hinsahen, weil sich dort nichts für sie Wichtiges befand. Wie Schwalbennester klebten sie an den Häuserwänden, ein rotes oder blaues Metallgehäuse umgab eine Dose aus meist milchig gewordenem Plastik, die die begehrte, schlecht sichtbare Ware enthielt. Die Automaten funktionierten mit Hilfe eines Drehmechanismus. Man legte zehn Pfennig quer in eine dafür vorgesehene Öffnung. Dann ließ sich der Griff nach rechts drehen – schon das Knacken, mit dem die Münze die Sperrmechanismen löste, deren Widerstand sich der Hand mitteilte, bereitete Lust –, und unten, aus einer Art Maul, rollte das blaßfarbene Kaugummi heraus. Der Vorgang war risikobehaftet. Der Drehgriff war so angelegt, daß er manchmal zurückschnappte. Deswegen mußte die linke Hand helfen und den eher zu kleinen Griff festhalten. Die rechte Hand konnte dann umgreifen und die Runde vollenden. Wenn es mißlang, hatte man meistens Glück und die Münze war noch am Ort. In seltenen Fällen war sie durchgefallen. Dann hatte man verloren. Allerdings entsprach diesem Verlustrisiko eine komplementäre Chance. Ganz selten rutschten zwei Kaugummis durch. Unzählige Male versuchte ich, diesem Vorgang durch sachtes Hin- und Herbewegen des Griffs an der richtigen Stelle nachzuhelfen. Vergeblich: Die zufällige Lage der Kaugummis ließ sich nicht beeinflussen; das Glück mußte auf meiner Seite sein. Notwendig war es außerdem, die freie Hand unter das Maul zu halten, dessen Metallklappe oft ausgebrochen war. Sonst bestand die Gefahr, daß die Kaugummis aufs Pflaster fielen, in den Rinnstein rollten. Aber dann durchströmte mich die Süße – schoß mir verstörend ins Hirn, zog den Mund schmerzhaft in die Breite. Man mußte sich durcharbeiten. Das Äußere war hart und vertrocknet von der wer weiß wie langen Lagerung bei jedem Wetter. Erst nachdem man eine Weile gierig-verzweifelt auf der sonderbaren Masse herumgebissen hatte, wurde sie weich. Irgendwann aber war die Süße verschwunden. Was blieb, war die Erinnerung an diesen unerhörten ersten Zugriff, diesen mystischen und qualvollen Moment. Es gibt diese Automaten immer noch, meist mit Rostblüten und kleinen Aufklebern bedeckt. Verlottert wie in den sechziger und siebziger Jahren. Ein übersehenes Stück Wirklichkeit wie die Bordsteine und Gullis, an denen wir spielten, und die zugewachsenen Weltkriegsbrachen, auf denen wir uns herumtrieben, ohne daß uns jemand bemerkte. Aber sie führen mir vor Augen, daß ich selbst erwachsen geworden bin. Denn suche ich sie jetzt, diese mythischen Objekte an den Wänden, so übersehe ich sie häufig, und es ist meine Tochter, die mich auf sie hinweist. All das, was an sentimentaler Erinnerung daran noch vorhanden ist, ist jetzt überdeckt von Ekel und ungläubigem Staunen darüber, daß diese Automaten vom dichten Netz der deutschen Hygienevorschriften nicht erfaßt wurden. Wie alt mögen die Kaugummis sein, die man ihnen entnimmt – zwanzig Jahre? Und wieviel Chemie steckt in ihnen, damit sie überhaupt eßbar sind? Diesen Ekel gab es früher nicht. Was uns beschäftigte, war das Gefühl, in diesen Automaten etwas Entlegenes und Übersehenes, einen Schatz, ein überaus kostbares Fundstück entdeckt zu haben, das den Zugang zu einer anderen Welt versprach. Es ist erstaunlich, daß Joanne K. Rowling mit ihrer nachtwandlerischen Sicherheit für Stellen, an denen die Welt der Kinder an die Welt der Magie grenzt, dieses Requisit übersehen hat. Ist es von drei Automaten stets der mittlere, der einem den Zugang zur Parallelwelt eröffnet? Sind zwei Automaten synchron zu bedienen (so wie in »Jim Knopf und die Wilde 13« die dreizehn Türen im selben Augenblick geöffnet werden müssen, um das »Land, das nicht sein darf« untergehen zu lassen) und von wem? Kommt es darauf an, bestimmte Münzen einzulegen? Eignen sich dafür nur unbenutzbar gewordene Automaten, die aus dem Produktionskreislauf herausgefallen sind? Die Automaten mit den Kaugummis für zehn Pfennig waren der Standard. Es gab aber auch solche, in denen doppelt so große Kaugummis für zwanzig Pfennig verkauft wurden. Der Mechanismus sah genauso aus, war aber viel komplizierter. Denn es bedurfte zweier voller Umdrehungen, um den Fall des Kaugummis auszulösen. Die erste Münze mußte also irgendwo zwischengelagert werden. Wie ging das zu? Daran schlossen sich weitere Fragen: War das Doppel-Kaugummi wirklich genau doppelt so groß wie das einfache? Oder gar etwas größer? Oder womöglich kleiner? All dies beschäftigte mich und verhieß einiges. Um so größer war dann die Enttäuschung. Diese Kaugummis waren eigentlich zu groß. Es war schwer, sich durch ihre Schale zu beißen, und wenn es gelang, war der Mund mit einer erstickend großen Menge der zähen, immer geschmackloser werdenden Masse angefüllt, so daß nach kurzer Zeit der Kiefer höllisch schmerzte. Es war eine Versuchung, sich darauf einzulassen. Aber ihr nachzugeben wurde nicht belohnt. Ähnlich verhielt es sich mit der dritten Automatensorte, die für etwas mehr Geld – ich glaube, es waren fünfzig Pfennig – den Zauberspittel enthielt, nach dem die Kinder gieren. Ringe und Flummis; kleine Uhren mit fest aufgeprägtem Zifferblatt, die auf fünf vor eins eingestellt waren und also wenigstens zweimal am Tag richtig gingen; Anhänger für Halsketten und Armreifen und Miniaturtaschenmesser mit Blechklingen. Billigprodukte aus China, Vorläufer der Überraschungseier, Talmi und Straß, die das Leben im Kapitalismus erst schön machen. Dennoch stand auch hier der Glanz des Fernen und Geheimnisvollen, der sie umgab, im Mißverhältnis zu dem, was man bekam. Was sollte ich mit einem Plastikring, dessen metallische Oberfläche nach einem Tag schartig und durchscheinend wurde? Daß der Zauber der Ware faul sein konnte, wurde mir hier zum ersten Mal klar. Dennoch: Über die Jahre lohnte sich der Einsatz. Einmal gewann ich den Jackpot: ein kleines, messingfarbenes Feuerzeug, das mit Haushaltsbenzin zu befüllen war. Ich hatte es hinter der zerkratzten, in diesem Fall auch noch vergitterten Scheibe erspäht. Darauf richtete sich meine Sehnsucht, und der Moment, in dem ich es nach vielen Versuchen in Empfang nahm, war durchdrungen von Unglauben. Jahrelang habe ich es mit mir herumgetragen, gehegt und gepflegt und die innenliegende Watte erneuert. Mit dem Beginn der Pubertät ging es verloren – wie so vieles. Die Kaugummis für zehn Pfennig blieben sich aber immer gleich, bis heute. Es sind die Elementarteilchen einer Welt, die aus Zucker und süßem Saft besteht: No-name-Produkte, die sich keiner Marke zuordnen lassen. Ich kannte niemanden, der sie nicht begehrt und nicht von Zeit zu Zeit einen Teil des Taschengelds dafür geopfert hätte. Es waren klassenlose Süßigkeiten. Das scheint sich geändert zu haben. In den bürgerlichen Vierteln sind die Kaugummiautomaten kaum noch zu finden. Sie wurden offenbar abmontiert. Sind sie zum Vergnügen der Ausgeschlossenen geworden, der kleinen kahlrasierten türkischen und arabischen Jungen, die alleine oder allenfalls von ihren großen Schwestern begleitet auf der Straße herumlungern? Ist es das Brot der Armen, das letzte Versprechen für ein übergewichtig gewordenes Proletariat? Aber ich sehe niemanden mehr an diesen Automaten, auch keine Kinder. In der DDR, so höre ich, konnte man diese Automaten nicht finden. Typisch. Was uns auffiel an unserem häßlichen sozialistischen Geschwister, war genau das: das Pragmatische, Überrationale, Graue und Nüchterne; das Fehlen des magischen Zaubers der Ware, der für uns von solchen Automaten ausging. Dabei war es nicht der Zauber der Marke, es war nicht der Nimbus, mit dem insbesondere die Fernsehwerbung einzelne Produkte umgab, die deswegen im Osten fast noch größere Verehrung genossen als bei uns. Nein, es war das Rätsel der automatischen Produktion, der Zauber, mit dem der Kapitalismus sich selbst umgab, das fast religiöse Versprechen der Rationalisierung. Wir kannten das aus dem Märchen vom Tischleindeckdich. Irgendwann, so ahnten wir, würden die Maschinen alles selbst produzieren, inklusive ihrer selbst und des für sie notwendigen Geldes. Uns erwartete die Wiederkehr des Paradieses, in dem wir nicht arbeiten und kein Geld verdienen mußten, sondern einfach nur die Hand unter die immer gefüllten Automaten zu halten brauchten. Vielleicht ist die DDR in Wirklichkeit daran zerbrochen, daß sie mit diesem Zauber nicht aufwarten konnte, daß sie aus der Sicht von uns West-Kindern nichts versprach und nichts verhieß. Bei uns dagegen stellten die Automaten eine Art Vorgeschmack aufs Schlaraffenland dar, von dem wir freilich ahnten, daß es nicht kommen würde. Wir sahen ja unsere Eltern, sahen sie arbeiten, empfanden ihre schlechte Laune oder doch zumindest ihre Zeitnot. Die Automaten des Glücks konnten sie nicht sehen. Den fernsten, sich in der Unwirklichkeit einer nachträglichen Phantasie verlierenden Horizont dieser Erinnerungen bildet ein Automat, der sich im mittlerweile abgerissenen Freibad meiner Kindheit befand. Dieser Automat enthielt Pommes frites. Die meisten, denen ich davon erzähle, glauben mir nicht, meine Kindheitsfreunde können sich nicht erinnern, eine längere Recherche im Internet ergab nur wenig. Aber es hat offenbar solche Automaten gegeben, aus denen man sich für fünfzig Pfennig oder eine Mark, ausgelaugt und hungrig vom ständigen Wechsel zwischen dem Spiel an der Sonne und im überchlorten Wasser, die nahrhafte und fettige Ware zog. Das waren keine Süßigkeiten, sondern richtiges Essen, das von einer Maschine auf magische Weise zubereitet wurde. Eine Stadt, in der an jeder Ecke diese und ähnliche Automaten aufgestellt worden wären, das war die Stadt der Träume, das war die Stadt der Zukunft.
II.
Man kann wohl sagen, daß diese Phantasien sich nicht erfüllt haben. Was jetzt das Straßenbild der Städte dominiert, sind kaum die Vollautomaten mit ihrer illusionären Verheißung einer ohne den Menschen auskommenden Produktion. Es sind die ubiquitären Freßbuden und Schnellrestaurants: all die Tempelstätten des expandierten Dienstleistungssektors, in denen das Proletariat von heute kaputtgemacht wird. Ganz offensichtlich sind diese fleißigen, nach Möglichkeit jungen und attraktiven Menschen, von denen wir uns bedienen lassen, die Automaten, die noch weniger Pflege und Unterhaltung bedürfen als die von früher. Das Glück, das mir aus der Erinnerung an die Automaten der Kindheit zuströmt, speist sich aus der Utopie der von Menschen gemachten, sich selbst verschenkenden Natur – etwas, das es nicht gibt, das Perpetuum mobile. Die Wirklichkeit von uns Erwachsenen sieht anders aus. Wir sind Automaten des Unglücks – reduziert auf eine Funktion. Und wenn die Kosten des Unterhalts zu hoch werden, ersetzbar durch Hundertausende, die dasselbe besser und billiger machen, bis sie ihrerseits ausgetauscht werden. Die Verwandlung des Menschen in einen Automaten ist Grund und geheimes Ziel unserer Epoche, wieviel an Eigensinn sich auch dagegen regen mag, wieviel Kreativität und Erfindungsreichtum in der Anpassungsleistung frei wird, ja sie in gewisser Weise sogar ermöglicht: Der von Marx unter dem Titel der Entfremdung analysierte Subjekttausch von Mensch und Maschine ist die Dominante des gesamten Prozesses. Die Maschine, so heißt es in den »Ökonomischphilosophischen Manuskripten«, wendet den Menschen an, er wird zum Anhängsel der Maschine, zu Zahnrad, Baustein, Platine, wird zur Unterroutine eines von selbst laufenden Programms. Dabei ist es unerheblich, ob es sich wortwörtlich um einen maschinellen Produktionsprozeß oder um ein Geflecht von Normen oder Verwaltungsvorschriften handelt, die die einzelnen auf ihre Teilleistung für das Ganze reduzieren. Aus dieser Sicht ist es einerlei, ob ich am Band stehe, reduziert auf einen einzigen Bewegungskomplex, ob ich hungere, um meinen Körper den Erwartungen meines Vorgesetzten und des zahlenden Publikums anzupassen, oder ob ich als Journalist, Schriftsteller oder Wissenschaftler meine Sätze so mit Textbausteinen fülle, daß sie, vor allem Inhaltlichem, meine Zugehörigkeit zur Gruppe derer, die in meiner Branche das Sagen haben, bekunden. Sicherlich bietet das Dienstleistungsgewerbe besonders unangenehmes Anschauungsmaterial. In einer gesellschaftlich vollständig akzeptierten Weise sind die Körper derjenigen, die in den Handyshops, den internationalen Freßbuden, teilweise sogar schon an Tankstellen und Spätshops arbeiten, zur Ware geworden. Wer nicht gut aussieht, kommt gar nicht erst rein; wer zu alt wird, fliegt raus. Aber »Dienstleister« sind wir alle. Das Phänomen hat weite Teile der totalitär werdenden Gesellschaft erfaßt, die Arbeit – weniger als Produktion denn als »Dienst« begreift. Mit schwindelerregender Dynamik hat sie das widerständig-produktive Wechselverhältnis von Mensch und Welt, Subjekt und Objekt umgeformt in Hingabe, blindes Funktionieren, rituellen Vollzug. Der ökonomische Erfolg der einzelnen hängt davon ab, wie sehr sie sich damit zu identifizieren in der Lage sind; wenn es darüber hinaus gelingt, etwas für sich selbst abzuzweigen, um so besser. Wem das nicht möglich ist, der hat es schwer. Diese Transformation vollzieht sich mit Wissen und Willen der meisten Beteiligten, und sie wird abgestützt vom ideologischen Mainstream. Seele, Geschlecht, Individualität, Sprache und Hautfarbe – das sind alles vorkapitalistische Rückstände, ein Erdenrest, zu tragen peinlich und hoffentlich bald beseitigt. Gleich sind wir nur als Automaten, als Roboter in Markenkleidung, trainierte Körper, die sich dem computergenerierten Idealmaß annähern, Niemand und Jedermann, am neuen Smartphone die Summe unserer Funktionen: Einkommen, soziale Verknüpfungen und Dinge, denen wir anhängen, die die anderen haben oder nicht. Die Automaten des Glücks waren den Menschen nicht ähnlich, und im Zwischenraum dieser Differenz lagerten die Phantasien, die uns beglückten. Sie waren kleine, unansehnliche Ausschnitte aus einer Welt, die zu der unsrigen ergänzend, bereichernd, luxurierend hinzutrat. Wenn Menschen zu Maschinen werden und Maschinen zu Menschen, droht der Zwischenraum sich so zu verengen, daß für die Träume vom Glück, die zu einem Teil schon das Glück selbst sind, kein Platz mehr bleibt.
SINN und FORM 6/2018, S. 846-849