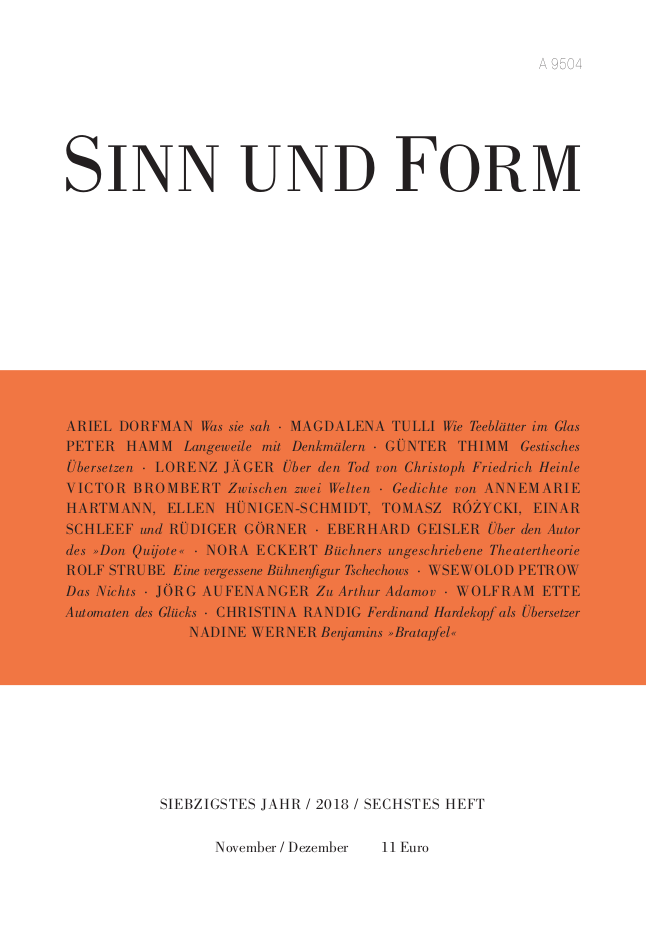Leseprobe aus Heft 6/2018
Tulli, Magdalena
Wie Blätter im Teeglas
Ihre Krankheit war wie das Ende eines Imperiums. Die Armee zog sich zurück und verließ die in Zeiten vergangener Herrlichkeit besetzten Brückenköpfe, die Statuen bröselten, die Säulengänge wurden von Unkraut überwuchert. Die Beamten des Kaiserreichs dachten nicht mehr an die Macht, sondern nur noch ans Überleben, an das Irdische, das heißt an das, was dem Körper am nächsten war, und durch die verlassenen Grenzposten drangen Fremde – Viren, Bakterien – und übernahmen die Herrschaft. Gegen Ende gab ich ihr jeden Vormittag eine Spritze. »Und wer bezahlt Sie?« fragte sie interessiert. »Meine Familie?« Sie war noch so geistesgegenwärtig anzunehmen, daß jemand bezahlen müsse, und hatte genug Überblick, um zu wissen, daß sie es nicht war. Außer ihrer Familie hatte sie noch eine Tochter, aber die hatte sie seit Jahren nicht gesehen. Ich nickte, ja, die Familie bezahlt. Ich wollte sie nicht mit Sensationen überraschen, die sie hätten beunruhigen können. Zum Beispiel damit, daß ich ihre Familie war. Außer mir kümmerten sich abwechselnd zwei Pflegerinnen um sie. Ich hatte möglichst zuverlässige Frauen ausgesucht, aber sie mochte sie nicht. Die ältere war ihres Erachtens zu apodiktisch, die jüngere machte immer ein Gesicht, als müßte sie sich beeilen. Von uns dreien mochte meine Mutter mich am liebsten. Aber für die Oberschwester hielt sie die Älteste. Als eine Tasse kaputtging, war sie besorgt, die Oberschwester könnte mich hinauswerfen. »Wir sagen ihr nichts«, entschied sie. So sah das Ende aus. Spritzen, Tabletten. Die Hoffnung nahm davon nicht mehr zu. Und der Anfang? Man könnte annehmen, daß am Anfang, bevor die Dinge kompliziert wurden – denn auf die eine oder andere Weise mußten sie kompliziert werden –, wenigstens für kurze Zeit eine ursprüngliche, unbefleckte Reinheit geherrscht habe, nach der man sich später das ganze Leben sehnen würde. Doch das Leben besteht aus lauter Fortsetzungen ohne jeglichen Anfang, aus alten, verknoteten Handlungsfäden, die wer weiß woher kommen und wer weiß wohin führen. Der Anfang ist dort, wo wir das Fähnchen hineinstecken – bis jemand es herausnimmt und anderswo hineinsteckt. Daß der Anfang eine Frage der Vereinbarung ist, kommt uns entgegen. Wir stecken das Fähnchen an den Ort, an den meine Mutter nach dem Krieg zurückgekehrt ist. Sie kehrte zurück ohne die geringste Idee, was sie mit dem plötzlich geretteten Leben anfangen sollte; erst später, nach Jahrzehnten, sollte sich herausstellen, daß das Leben nicht gerettet werden kann. Wir sprechen von einer Großstadt, weniger zerstört als andere, einer Stadt, die einst von morgens bis abends unermüdlich dem Geld hinterherjagte, das sie für atemberaubenden Flitter brauchte, für den Kauf von Wechseln, für Marmelade aufs Brot. Sagen wir – es sei Lodz. Viel weiß ich nicht von Lodz. Jedenfalls sollte nach dem Krieg die Vergangenheit – anders als die alten Mauern, die schwer zu bewegen sind – auch aus dieser Stadt entfernt werden. Nirgends in unserem Land sollte sie sich verstecken können, sie sollte verschwinden, ohne Fortsetzung. In jener Zeit wurde überall das alte, ausgebrannte Bühnenbild auseinandergenommen und eilig ein neues aufgestellt, das täuschende Ähnlichkeit mit Häusern, Brücken und Fabriken hatte. Die Illusion der Wirklichkeit war nicht von der Hand zu weisen. Man lebte recht ruhig vor diesem Hintergrund, vor allem wenn man die Ruhe mit dem Chaos verglich, das vor kurzem erst zu Ende gegangen war. Aber dieses Bühnenbild hatte nicht das richtige spezifische Gewicht. Es wog so viel wie Pappe. Schon ein stärkerer Windstoß brachte seine Existenz in Gefahr. Die Tageszeitungen schreckten mit der Stoßwelle einer Atombombe, die fähig wäre, uns zusammen mit den frisch errichteten Konstruktionen innerhalb von Sekunden von der Erdoberfläche zu fegen. Während man bei uns Pläne von Häusern und Brücken zeichne, so meldeten sie, arbeiteten andere schon an den Plänen ihrer Zerstörung. Aber warum hätten sie das tun sollen, und wozu? Weil das Zerstören in ihrer Natur lag und weil sie das letzte Wort haben mußten. Angeblich wollten sie an der Zerstörung auch noch verdienen, wie an allem, was sie in Angriff nahmen. Dort, weit weg von uns, zählte nämlich nur das Geld. Die Rollen waren verteilt: auf der einen Seite Herz und Verstand, auf der anderen lediglich Gier. Die anderen hatten drei Viertel der Welt und halb Europa unterworfen. Unser Land, nicht nach seiner Meinung gefragt, fand sich in der zweiten Hälfte wieder, die Tür war zugefallen und es gab kein Entrinnen. Jeder, der zu hoffen wagte, daß sich noch etwas ändern könnte, wurde verfolgt. Hoffnung war – natürlich – zu empfehlen, aber nicht diese Hoffnung. Wir sollten hoffen, daß sich nichts mehr ändern, daß es nur immer mehr Häuser, Brücken und Fabriken geben werde, immer besser im Boden verankert. Sie sollten unser gemeinsamer Stolz sein, das, wofür wir zu gegebener Zeit unser Leben opfern würden. Vorläufig mußten wir uns vorsichtig bewegen, um nichts umzuwerfen. Zuviel durfte man nicht erwarten. Der keinen Widerspruch duldende Ausdruck »man muß« dominierte in der Schule, beim Militär und im Kreißsaal. Der Zwang war unpersönlich und kam sozusagen von oben, woher genau, wußte keiner: Die Grammatik legte nicht offen, von wem die Forderung kam. Meine Mutter hatte ihre eigenen Gründe, sich von der Vergangenheit fernzuhalten, und sei es nur, daß die Vergangenheit sie nachts weckte und nicht mehr schlafen ließ. Um so besser, daß es keinen Platz für die Vergangenheit gibt, dachte sie wohl. An der Straßenecke war ein Postamt. Mutter sah an der Tür ein Schild – Mitarbeiter gesucht. Das Postamt stellte Mutter in der Sortierstelle ein, wo jedes Paar Hände gebraucht wurde. Nach dem Krieg flutete eine hohe Woge von Briefen durch unser Land. Vom Hauptstrom zweigten kleinere Flüsse ab, die nicht existierende, tote Adressaten suchten. Sie fahndeten nach denjenigen, die ihren Aufenthaltsort geändert hatten, die – aus freiem Willen oder auch nicht – in andere Städte oder sogar in den fernen Osten, womöglich nach Sibirien gezogen waren; in solch extremen Fällen gab sich der Brief allerdings schnell geschlagen. Man hielt sich an eine vertrauliche Liste von verdächtigen Empfängern und Absendern und fischte die gefährlichsten heraus. Die mußte man zur Seite legen und einem Mann im Ledermantel übergeben. Außer dieser Namensliste existierte jedoch auch eine Regel höherer Ordnung, eine, die Mutter vor dem Krieg zu Hause gelernt hatte. Wie durch ein Wunder hatte diese Regel überlebt, offenbar war sie feuerbeständig. Zu ihr gehörte das strikte Verbot, fremde Briefe zu öffnen, was im Dienst die Vertraulichkeit privater Post bedeutete. Mutter kam durcheinander. Sie wollte arbeiten, aber die widersprüchlichen Regeln verwirrten sie. Im Herbst flüchtete sie von der Sortierstelle auf die Universität, wo die Regeln noch nicht geändert worden waren. Sie hatte kein Abitur, obwohl sie es sicher geschafft hätte, wenn dort, wo sie die vergangenen Jahre verbracht hatte, Prüfungen stattgefunden hätten. Sie hatte Glück. Das Feuer hatte die wichtigsten Dokumente verzehrt, und nach den weniger wichtigen fragte niemand. Man mußte nur einen entsprechenden Antrag im Dekanat stellen und sich dann eine Bibliothekskarte, ein Heft und Bleistifte besorgen. Man mußte zwei hübsche Kleider besitzen, ein Kostüm, einen Wintermantel und Schuhe. Die Blusen mußten frisch gewaschen und ordentlich gebügelt sein. Man mußte die Fasson wahren. Abgesehen von anderen Gründen – Vernachlässigung hätte zu viel enthüllt.
Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall
SINN UND FORM 6/2018, S. 737-748, hier S. 737-739