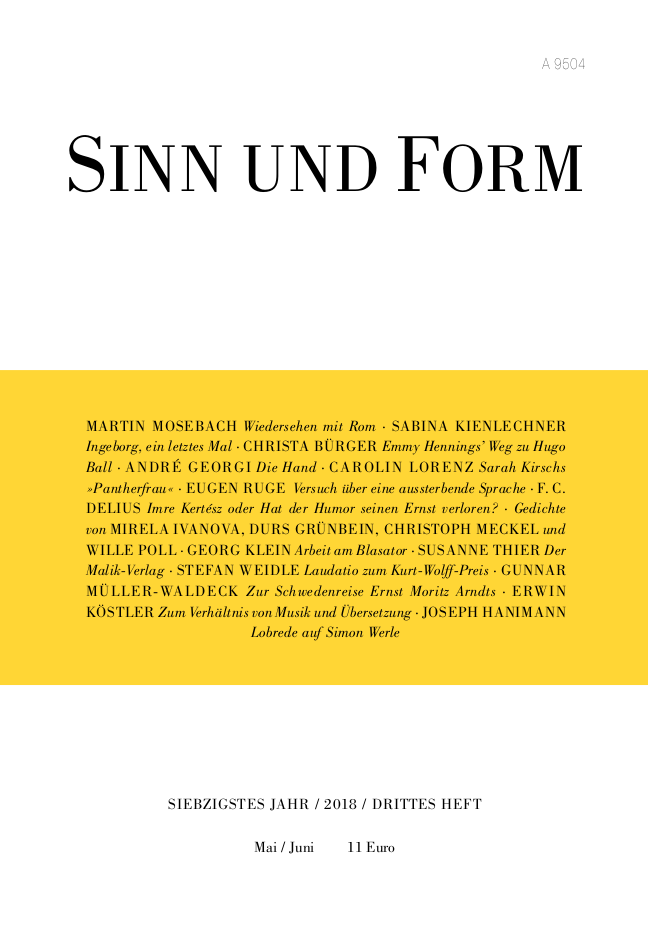
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-41-6
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 3/2018
Kienlechner, Sabina
Ingeborg, ein letztes Mal
I
Drei- oder sogar viermal in ihrem Leben kam Ingeborg Bachmann nach Rom, um hier eine Weile zu leben. Wir waren immer schon da: in den fünfziger Jahren, als sie Rom zu ihrer »Wahlheimat« machte (in Wahrheit aber kam und ging wie ein Zugvogel), dann 1960, als sie und Max Frisch sich hier als Paar niederließen (für etwa zwei Jahre), und schließlich von 1965 bis zu ihrem Tod 1973, als sie nicht mehr nur sporadisch, sondern »fest«, wie wir, als Ausländerin und Exterritoriale in Rom lebte.
In allen Perioden ihres römischen Lebens kam sie uns besuchen. Wir wohnten in einer etwas verblichenen Jugendstil-Villa am Rande der Stadt, umgeben von einem großen, verwilderten Garten mit Gipsstatuen darin: Wenn man um die hochgeschossenen Buchsbaumhecken bog, stand man plötzlich vor Paulina Borghese, Cäsar, den Dioskuren. Viele deutsche Schriftsteller und Dichter kamen zu uns, früher oder später waren fast alle mal in Rom oder lebten sogar eine Weile hier. Manche besuchten uns nur einmal, andere kamen häufig, oder man traf sich zu Spaziergängen in der Campagna. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, daß Jahrzehnte später jemand fragen würde: »Wer war Ingeborg Bachmann?«, wie Ina Hartwig in ihrer »Biographie in Bruchstücken« von 2017. Für uns war sie einfach Ingeborg, oder manchmal auch: die Bachmann. Ich möchte noch ein paar Bruchstücke hinzufügen und bei dieser Gelegenheit einige Passagen aus einem Brief wiedergeben, den meine Mutter Toni Kienlechner an Ingrid Bachér schrieb, nachdem Ingeborg Bachmann gestorben war. Und vielleicht gelingt es mir am Ende zu erklären, warum man in Rom so viel leichter leben – und auch leichter sterben konnte als zum Beispiel in Wien, Berlin oder Zürich.
II
Ich war damals, als Ingeborg uns die ersten Male besuchte, noch ein Kind, dann eine Jugendliche, und meine Erinnerung ist entsprechend anders und dürftiger als die der Erwachsenen, die mit ihr über wichtige Dinge sprachen. Aber ich hatte, weil ich nichts zu sagen hatte, viel Zeit, sie zu beobachten, und ihr Eindruck auf mich war nicht minder stark als der auf die Erwachsenen. Ich habe ihre Verwandlung im Laufe der Jahre genau registriert: daß sie erst akkurat so aussah, wie wir uns eine »deutsche Dichterin« vorstellten, mit schlichtem, braunfransigem Bubikopf, daß sie dann, während wir Kinder heranwuchsen, immer schicker, blonder und »italienischer« wurde, à la mode, zuweilen bunt wie ein Papagei, andere Male schwarzschillernd wie Patty Pravo. Ich habe bemerkt, daß sie ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch in vollkommener Aufmachung ihre Wohnung verließ, und immer seltener. Bei sich zu Hause, wo sie nur noch vertraute Personen und solche, die nichts zu sagen hatten, einließ, traf man sie nachlässig an, ungeschminkt, oft im Bett und immer verstört, fast panisch, aber hingebungsvoll freundlich und buchstäblich suchend nach Worten der Freundlichkeit. Mehrmals habe ich beobachtet, wie sie heiterer wurde, während meine Mutter an ihrem Bett saß und mit ihr sprach, wie sie nach einer Weile heraussprang, wegen eines kleinen »Whiskerl« für sich und den Besuch, Zigaretten lagen ohnehin auf dem Nachttisch. Dann, als sie wieder zu Leben gezogen war, wurde das Zusammensitzen aufgehoben. Die Ängste, die sie geplagt hatten, waren für diesmal vorüber.
Wenn sie uns besuchte, kam sie stets allein; auch in ihrer Zeit mit Max Frisch. Auch er besuchte uns gelegentlich, aber nie zusammen mit Ingeborg. Er kam, wenn sie verreist war, was häufig der Fall war. Ingeborg achtete sehr darauf, ihre Freunde und Bekannten zu separieren und sich nach Möglichkeit jedem gesondert zuzuwenden. Meine Schwester und ich beobachteten sie einmal unbemerkt, als wir sie zufällig über die Piazza di Spagna laufen sahen. Sie hatte eine auffällig schillernde, enge Hose an und schritt zielstrebig aus, die Haare waren streng nach hinten gekämmt zu einem hochsitzenden langen Zopf, der nicht ihrer war, und auch das Gesicht war merkwürdig verändert durch ein Paar künstlicher Wimpern, die ihr dickschwarz an den Augen klebten. Wir staunten. Das dort war unzweifelhaft Ingeborg, aber zugleich eine ganz andere Person als die, die wir kannten, bis hinein in ihre Bewegungen: Sonst bewegte sie sich eher zögerlich, mit kurzsichtiger Behutsamkeit, nichts Forsches oder Zielstrebiges schien ihr eigen. Es berührte uns merkwürdig, sie so verändert zu sehen, sie war offensichtlich eine Rollenspielerin, und in unserem noch halbkindlichen Alter kam uns das vor wie eine Unehrlichkeit, eine Art Betrug. Vielleicht stellten auch wir uns damals, ohne es recht zu begreifen, die Frage: Wer war Ingeborg Bachmann, wer war sie wirklich?
Wie naiv, ja töricht diese Frage tatsächlich war, zeigte sich in den Wochen, als sie im Sterben lag und ihre Freunde und Bekannten im Vorraum des Krankenhauszimmers unversehens zusammentrafen, etliche zum ersten Mal. Hier stellte sich heraus, daß sie für jeden eine andere war, und eine große Verwirrung erfaßte die besorgte Besucherschar. Es muß ihnen zumute gewesen sein wie nach einer Blendung, wenn die Augen sich langsam wieder an die Dunkelheit gewöhnen: dunkel war es, weil Ingeborg über jeden ihrer Schritte einen Schatten der Diskretion und Verschwiegenheit gelegt hatte; geblendet waren sie, weil sie jedem gegenübergetreten war, als sei er der einzige, Wichtigste, tatsächlich die einzig wichtige Begegnung in ihrer Welt. Das hat sie »hingekriegt«, und in dieser Antinomie der Beziehungen irrten ihre Freunde, Verwandten und Gefährten nach ihrem Tod herum, trafen sich, merkten, daß sie zu wenig und nur Widersprüchliches von ihr wußten, verstritten und verloren sich, teils für immer.
[…]
SINN UND FORM 3/2018, S. 308-319, hier S. 308-310
