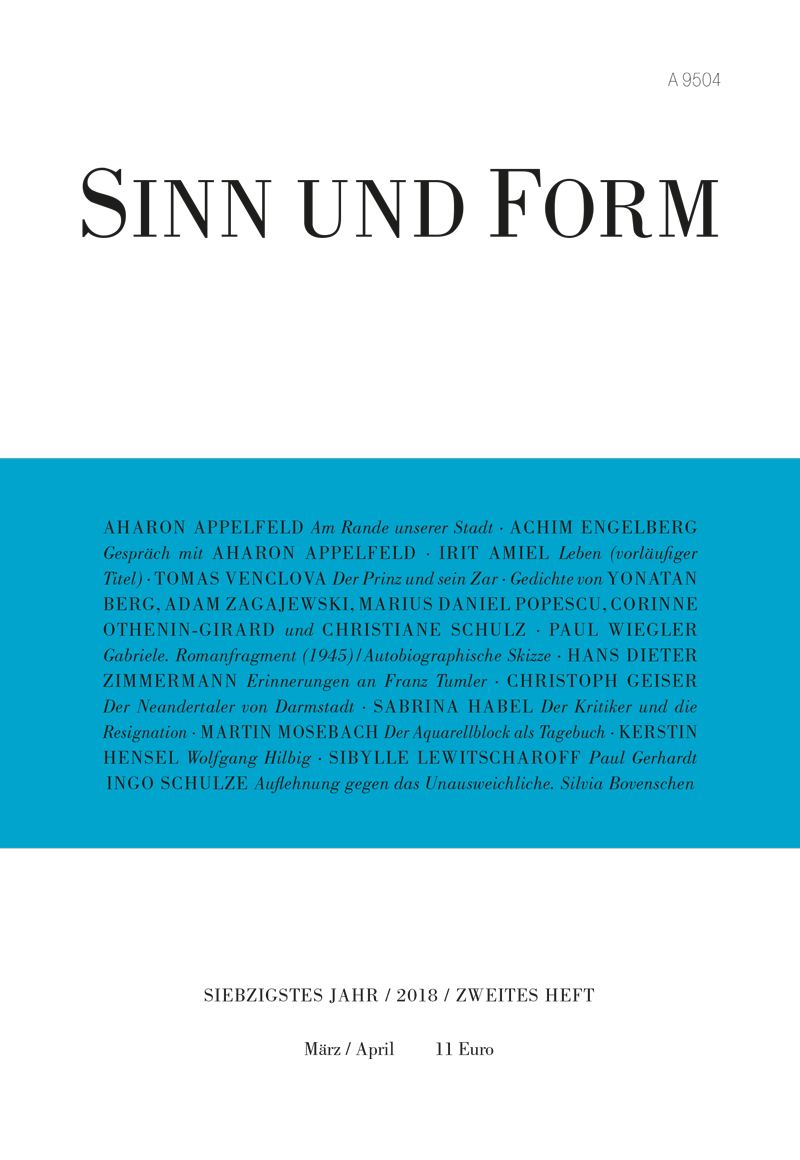
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-40-9
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 2/2018
Geiser, Christoph
Der Neandertaler von Darmstadt
Das Auge Gottes, übrigens, war auch noch nicht im Bus. Ja, vielleicht war das säumige Auge Gottes überhaupt der Grund, warum der Bus, der sich nach und nach mit immer mehr saumseligen Fruchtbringenden füllte, noch immer nicht losfahren konnte, weil das Auge Gottes, die Treppe des Staatstheaters beherrschend, noch immer jedes einzelne Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft auf seine Linse bannen wollte und damit den Abstieg all der Fruchtbringenden über die Treppe behinderte und verzögerte – während wir dasaßen, auf unserem Bänkchen am Fenster zur Nacht, eingezwängt zwischen den Stehenden, die Panische mir gegenüber und die Verhärmte. Sukzessive immer mehr eingezwängt, unaufhaltsam. Den Ehernen sah ich erst, als es schon zu spät war. So stolperte ich, bereits panisch, über die Füße der Linguistik … Panik, ja. Urplötzlich. Und nicht der Panischen halber, die ganz unpanisch da sitzenblieb, wo sie saß, und auch nicht der Verhärmten wegen. Die verhärmt so sitzenblieb, wie sie war. Ich muß da raus, und zwar sofort, war das einzige, was man von mir noch vernahm, heißt, einzig die Linguistik im grellen Kunstlicht, über deren Füße ich stolperte, vernahm’s mutmaßlich, stereotyp lächelnd, ehern und stoisch.
Aus dem hellen Licht des Fahrzeuginneren in die Nacht der Schatten da draußen stolperte ich, aus dem Licht der Fruchtbringenden in die Finsternis umherhuschender Schatten. Die Schatten wollten mich zurückhalten! Sie vermochten es nicht. Die Vorstellung plötzlich, der Bus fülle sich immer mehr, immer mehr Fruchtbringende drängten hinein, die Fruchtbringenden nähmen quasi überhand und der Bus kippe; die Handbremse löse sich und der Bus finge ganz sachte an, die abschüssige Straße herunterzurollen … Fahrer konnte ich keinen sehen; so gäbe es gar keinen Fahrer, der Fahrer stünde, seine Zigarette rauchend, neben dem Bus und würde zu spät bemerken, daß sich sein Fahrzeug voller Fruchtbringender unaufhaltsam in Bewegung setzt – nicht aufzuhalten, nein, bis ins Erdinnere womöglich – oder der Bus finge plötzlich an zu brennen. Explodiere! Von der Zigarette des Fahrers. Und wir säßen da, eingezwängt zwischen der Panischen und der Verhärmten, dem Ehernen und dem Aufrechten, dem Zwingenden und dem Nährenden, dem Ordnenden und dem Vielgekrönten, der Unterhaltenden und der Eifrigen, den Stehenden und den Sitzenden, den Übersetzern und den Übersetzten, den Preisträgern und ihren Lobrednern, den Spektabilitäten und den Magnifizenzen, dem Semantikdiskurs und dem Semiotikdiskurs, dem Strukturalismusdiskurs und dem Dekonstruktivismusdiskurs, und nirgends ein Hammer, das Fenster zur rettenden Nacht einzuschlagen … Die Nacht als Rettung, solange ich noch eine kleine Tür sehe, die offensteht … und kein Auge Gottes, nirgends.
Wie käme ich jetzt zum Staatsempfang in die Orangerie? Was soll ich in der Orangerie … ja, wo wäre die denn? Wo bin ich?
Diese Stadt, mit rätselhaftem Namen ungeklärter Herkunft (nach der aber ein chemisches Teilchen benannt ist), die ich seit drei Jahrzehnten kenne, ist nicht nur nachts leer. Von den Bomben zerstört, nach dem Krieg in der Annahme wieder aufgebaut, sie bräuchte ein System von Hauptstraßenzügen als Organismus, als bräuchte es Platz für vierspurige Autobahnen, ging die Mitte verloren; das Zentrum: eine Fiktion. Der Luisenplatz. Nichts als ein Name und eine Säule, als müßte sie das Zentrum markieren, umgeben von Warenhäusern, die nachts zu sind. Dingversammlungen hinter erloschenen Fenstern.
Wo bin ich? Heißt: Wo geht’s denn vom Staatstheater, dieser architektonisch zusammenhanglosen Betonstruktur aus Treppen, Rampen und Balken, frage ich, mausallein plötzlich nachts zurückgeblieben, zum Luisenplatz, dieser fiktionalen Mitte, oder, besser noch, wichtiger eigentlich, zum Welcome Hotel, respektive zum Hessischen Landesmuseum, gleich gegenüber unserem Hotel? Noch haben wir ja nichts gegessen nach zweistündiger Preisverleihung, und der Hunger ist doch immer der elementarste Antrieb. Zum Staatsbankett in der Orangerie aber würden wir niemals zu Fuß gelangen, wir würden sie – auch ein für sich isoliertes Zentrum in einem Park an den unscharfen Rändern dieser Stadt – niemals wiederfinden, und: kein Taxi, nirgends.
Auch wir wären geladen, zu den Fruchtbringenden gehörig auch wir. Wir?!
Mausallein. Gottverlassen. Dem Auge Gottes, dem löwenmähnigen, aus dem Blick geraten. Wollten wir’s nicht? Was sollen wir uns denn mit all den Geladenen am Buffet um die Happen und Häppchen und, an den langen Tischen, um den fruchtbringendsten Platz quasi balgen, den mindesten Anstand & Abstand wahrend? Was soll ich hier? Loslaufen zunächst, in die Nacht, notgedrungen richtungslos, aber nicht ziellos.
Eine Gaststätte wäre der Vernunft gemäß das erste Ziel; ein Gaststätten-Signal ausfindig zu machen, eine Leuchtschrift, die auf eine Gaststätte hinweisen würde, eine Bierreklame, eine stattliche Eingangstür, wie für Gaststätten gewöhnlich, erleuchtete Fenster, Butzenscheiben womöglich … nichts zunächst. Betonstrukturen im diffusen Licht, eher lichtlos eigentlich, kein Flutlicht von Neon oder Kandelabern, keine erkennbaren Straßenbeleuchtungen, eine lichtlose Nacht. Zum Glück regnete es nicht, windete nicht, nicht kalt, nein, Ende Oktober noch mild, man konnte ohne Mantel gehn. Merkwürdig fühllos dünkten wir uns – keine Erinnerung mehr an ein Körpergefühl. Nicht einmal wirklich Hunger hatten wir. Nur das Bewußtsein, daß wir jetzt – sieben vorüber – etwas zu Abend essen müßten. Eine schwere Holztür, die offenstand, lud uns ein, hellbeleuchtet der Eingang. Der Anschrift nach ein türkisches Lokal, kein Imbiß, nein, ein Restaurant, auf der anderen Straßenseite, in einem stattlichen Haus. Wir traten ein, ein Flur mit Garderobe, der sich auf das hellerleuchtete Lokal hin öffnete, das überfüllt war; vollbesetzt; Kellner eilten vorüber, Tabletts auf den Armen, Geschirr, Speisen – man schien uns weder zu sehen noch zu hören. Höchster Lärmpegel, Gaststättenlärm. Wir standen eine Weile da, im Flur, perplex, irritiert – so plötzlich unsichtbar geworden. Wie hinter einer Schallmauer.
Verärgert wandten wir uns ab; zu rasch ungeduldig geworden. Ein Fehler.
Lichtlose Nacht. Straßenkreuzungen, kein nennenswerter Verkehr. Bürogebäude. Geschäftshäuser. Ein Reisebüro, »Vom Reisewunsch zur Wunschreise« auf der erloschenen Schaufensterscheibe. Oder: »Vom Reisetraum zur Traumreise«.
Wonach fragen? Käme uns denn wer entgegen … Nach dem Neandertaler können wir nicht fragen. So plötzlich unsichtbar geworden wie wir sind. Nach dem Museum natürlich müßten wir fragen. Ein stattlicher Bau, soeben nach umfassender Sanierung wiedereröffnet, von nationaler Bedeutung, erbaut ursprünglich vom ersten Warenhaus-Architekten Deutschlands, der in Berlin das Wertheim und das Pergamon baute, bedeutende Dingversammlungen beide. Ursprünglich übrigens an der Zeughausstraße 1 gelegen, heute Friedensplatz 1, eine politisch motivierte Umbenennung mutmaßlich. Ein Zeughaus! Das Museum, das Warenhaus. Aber das Zeug in dem Museum ist nun mal eher unser Ding … denn wir müssen’s nicht haben, nein, die Dinge müssen nur dasein. Vorhanden, nicht zwingend zuhanden. Wo ist das Museum? Wir wären gerettet. Beim Neandertaler. Keine Chance beim ersten jungen Mann, dem wir begegnen, Schemen im Dunkel einer lichtlosen Passage: verstöpselte Ohren! Man hört uns nicht. Er nimmt wenigstens den einen Stöpsel aus dem Ohr, hat aber noch nie etwas vom Museum gehört und weiß nicht, wo der Luisenplatz liegt. Einzig das Teilchen, nach dem jetzt ein Kongreßzentrum benannt ist, scheint ihm vom Hörensagen bekannt – Darmstadion, sagt er unsicher, als müßt’s ein Stadion sein, und deutet vage mit der Hand in die Nacht: in dieser Richtung ungefähr … immerhin dies. So gehe ich nicht in die entgegengesetzte Richtung – doch so oder so: Gehen, lesen wir im nachhinein, bedeutet den Ort zu verfehlen. Wir sind an einem Unort, einem Nicht-Ort eher. Nirgends sind wir! Unser Museum aber kann durchaus geortet werden. Wir waren ja drin! Und haben’s nicht bloß erträumt. Der kleinen Ausstellung zur Geschichte der Fruchtbringenden halber waren wir drin, einen ganzen Morgen lang und anderntags wieder, verließen aber unsere Fruchtbringenden und ihre Geschichte bald und verloren uns in dem labyrinthischen Bau.
Im frisch renovierten Bau verloren wir uns, auf seinen mindestens fünf Stockwerken, Rampen und Treppen, in den Räumen zwischen den schweren Türen, die mit menschlicher Kraft kaum zu öffnen sind (dafür sind eben diese schwarzen Knöpfe da! zeigte man uns), aber auch in den Diskursen, könnte man sagen, verloren wir uns. In den historischen Diskursen, den kunsthistorischen, den ethnologischen, paläontologischen, anthropologischen, erdgeschichtlichen, vor allem aber in den Diskursen der Menschheitsgeschichte, also vornehmlich im Diskurs der Paläoanthropologie verloren wir uns und, überdies! bei der Frage, wie groß die Schnittmenge des kunsthistorischen Diskurses mit dem erdgeschichtlichen denn wäre: angesichts dieser wunderschön schillernden und liebevoll präparierten fossilen Reptilien & Insekten aus der Grube Messel. Aber nicht der Grube Messel wegen waren wir da. Die doch weltberühmtes Natur- und/oder UNESCOKulturerbe der Menschheit ist. Sondern der Fruchtbringenden Gesellschaft halber. Aus dem Bus der Fruchtbringenden Gesellschaft haben wir uns panisch in die Darmstädter Nacht geflüchtet und vorerst darin verloren, verirrt.
[…]
SINN UND FORM 2/2018, S. 258-268, hier S. 258-261
