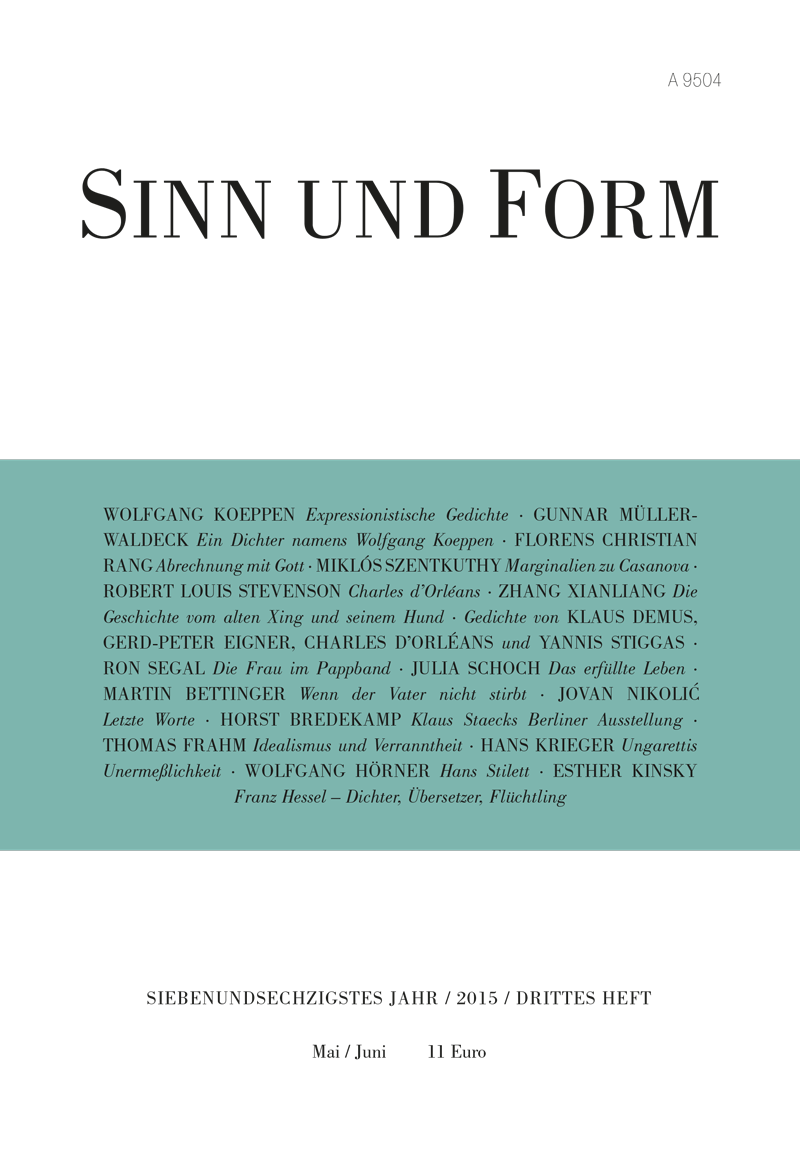
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-23-2
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 3/2015
Müller-Waldeck, Gunnar
EIN EXPRESSIONISTISCHER DICHTER NAMENS WOLFGANG KOEPPEN
Die Antwort des Bertolt Brecht – befragt nach dem Einfluß des Expressionismus auf seine frühe Dichtung – ist berühmt. Sie war verächtlich und lautete: »Gab’s damals in Augsburg nicht«. (Daß es diesen Einfluß gleichwohl gab, steht auf einem anderen Blatt!) Sein acht Jahre jüngerer Bewunderer Wolfgang Koeppen hätte nicht so lakonisch über sich und seine Geburtsstadt sprechen können. Zum einen war der literarische Expressionismus für ihn die Eintrittspforte in die Literatur, zum andern gab es ihn in Greifswald durchaus. Genauer: Es hatte ihn gegeben, wenn auch nicht im Sinne einer Gruppe oder Schule.
Der Jurist und elegante Kabarettdichter Walter Serner erwarb hier den Doktortitel, Oskar Kanehl, der Linksexpressionist, erregte 1913 als Germanistik-Doktorand mit seiner Zeitschrift »Der Wiecker Bote« Anstoß. Richard Huelsenbeck, der Dadaist, studierte an der pommerschen Universität Medizin, Werner Schendell Philosophie; Gustav Sack, der dem Expressionismus nahestehende Skandalautor, und auch Paul Meyer, der Dichter und spätere Rowohlt-Lektor, hatten als Greifswalder Studenten begonnen. Das alles geschah freilich in Koeppens frühen Kinderjahren. Zudem ging es den meisten angehenden Autoren mehr um die Erlangung eines Brotberufs als um den Ausritt ihres Pegasus. Mit Ausnahme der Kanehlschen Zeitschrift dürften in Koeppens Jugendzeit kaum noch Spuren all der schriftstellerischen Ambitionen vorhanden gewesen sein. Aber als er »Mädchen für alles« am Greifswalder Theater wurde, war zumindest noch ein Nachhall spürbar. Der enthusiastische Expressionismusjünger mußte an der städtischen Bühne jedoch bald ernüchternde Erfahrungen machen: Er hatte dem Intendanten Emanuel Voß vorgeschlagen, »Gas« von Georg Kaiser zu inszenieren. Der konservative Theatermann und Wagner-Sänger konterte die kühnen Pläne des schüchternen Vorpommern mit dem Gegenangebot einer Art Hilfsassistenz. Ausschlagen konnte dieser die Stelle nicht: Wer Geld braucht, greift nach jedem Strohhalm. Aber natürlich wurde der jugendliche Träumer nicht um visionäre Menschheitsentwürfe gebeten, sondern gefragt: »Wo stand der Tisch bei der letzten Probe?«
Der geborene Leser Wolfgang Koeppen hatte sich früh dem Expressionismus angenähert, angeregt vielleicht durch seinen Ortelsburger »Onkel« Theodor Wille (zur Eheschließung mit Koeppens Tante Olga war es nicht gekommen, Wille hatte die Schwestern Maria und Olga als Baumeister der Greifswalder Klinik kennengelernt) oder zumindest durch dessen umfangreiche Bibliothek. Hinzu kam das, was Koeppen später sein »Leben gegen die Norm nannte«. Er, der als Neunjähriger zu Kaisers Geburtstag auf der Schulfeier patriotische Verse rezitieren mußte, rächte sich später durch die Lektüre einer für kaisertreu Empfindende völlig unbrauchbaren Lyrik, eben der expressionistischen. Das frühe Faible für diese Dichtung war freilich noch Spiel, betrieben von einem wohlversorgten Bürgersohn. Koeppens Biographie glich der vieler expressionistischer Dichter: Aus besserem Hause stammend (der Nenn-Onkel war Leiter des königlich-preußischen Hochbauamtes, und den Makel von Koeppens unehelicher Geburt dürfte die Anstellung der Mutter beim Fast-Schwager weitgehend vergessen gemacht haben), versehen mit einer soliden Gymnasialbildung. »Das fing alles so gut und anständig an«, sagte er später nicht ohne Ironie über sich und seine Dichterkollegen.
Aus dieser sicheren Höhe stürzte der junge Mann hinab in die harte Greifswalder Realität: Hierhin ging die Mutter 1919 zurück, vermutlich wegen Spannungen in der »Kleinfamilie«. Das Gymnasium mußte aus Kostengründen gegen die ärmliche Bürgerschule eingetauscht werden, die gediegenen Ortelsburger Wohnverhältnisse gegen ein enges Dachstübchen, die Zugehörigkeit zu »besseren Schichten« gegen den Ruch der Unterprivilegierten. Koeppen kehrte in den Ferien wiederholt zurück, heuerte 1923 für kurze Zeit auf einem Finnlanddampfer an und setzte zwischendurch auch den Schulbesuch in Ortelsburg fort.
In diesem räumlichen Hin und Her entsteht in Greifswald 1924 an zwei Apriltagen die Szenenfolge »Gleichnis«, die Koeppen als eine Art Auftragswerk der Ortelsburger Freunde bezeichnet und offenbar im Sommer in diesem Kreis zur Aufführung bringt. Es handelt sich um ein Verkündigungsdrama über den standhaften Christus und den satanischen Verführer, der ihm die Macht über die Welt anbietet, und bezieht sich auf Matthäus 4/ 1–11: »Nochmals nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm: ›Dies alles will ich Dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest.‹ Da antwortete ihm Jesus ›Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: Den Herren, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen‹«. Koeppens Teufel will Christus verführen, Macht über andere Menschen auszuüben, doch dieser bekennt sich, anders als der biblische Gottessohn, weniger zu seinem Vater als eben zu den Menschen, für die er den Opfertod auf sich nimmt. Der Einfluß von Franz Werfels religiösem Verkündigungspathos auf diese Verse liegt nahe. »Ich sah die Not der Menschen, sah ihre Angst, ihr suchend Irren – und fühlte und ahnte! – In die Einsamkeit ging ich und fand – Licht! In mir! Strahlend, brennendes Licht! Allerkenntnis – riesiger höchster Schatz mein! Die Erkenntnis trieb, unwiderstehlicher Ruf: Hilf – Gib – Zeige! Da ging ich lehren. Von Güte, sprach ich zu Menschen, von großer Liebe, von allem was rein und edel war …"
Der Duktus ist spröde, ein Gemisch aus feierlich-bildreicher Prosa und ebensolchen Versen, die Reime holpernd und scheinbar naiv, an großen Gefühlen, sprachlichen Kostbarkeiten und bedenklichen Bildern ("Rausch in Blut und Rosen«) herrscht kein Mangel. Das Vorbild der Mysterienspiele schimmert durch, wobei wohl einem sentimentalen Eindruck vorgebeugt werden sollte, der durch den im Nebentext verfügten Einsatz einer »entfernte(n) Geige – traurig und schwer« aufkommen konnte. Denn ein expressionistischer Gag taucht die Szenerie gleichzeitig in ein verfremdendes Licht: Taschenlampen und Fahrradlaternen, mit denen die Darsteller ihr Gesicht aus dem Halbdunkel herausmodellieren sollen, sind vorgeschrieben. Rasch wird deutlich, daß es nicht um eine religiöse Botschaft geht, sondern um einen Aufschrei gegen die alles beherrschende Macht des Geldes. Mögliche Alternativen gibt es allerdings nur im Sinne des Hasencleverschen »Christus"-Gedichts von 1913: »Sei, Mensch, zur Hilfe der Menschen bereit.«
Den ganzen Text durchzieht eine reiche expressionistische Farbsymbolik: Weiß ist die Farbe Christi, weiß sind die Hände der Maria, weiß die Rosen der Liebe, rot hingegen ist das Märtyrerblut, aber auch das Teufelsgesicht ("grell rot und sehr beweglich«). Schwarz steht offenbar für die Kirche, die der Autor als zweifelhafte Institution ins Bild setzt: Christus wirft schon zu Beginn das dunkle Übergewand ab und erstrahlt in weißem Licht, der Teufel »trägt einen schwarzen Talar und sieht wie ein Pfarrer aus«.
Zum Schluß, als der stark an Goethes Mephisto erinnernde Teufel seine Niederlage eingestehen muß, wartet Koeppen mit einer gewitzten Pointe auf: Der Böse entwickelt umgehend eine neue Geschäftsidee: »Die Lehre muß in starre Form und Angst muß sein …«, sagt er abgehend und gewissermaßen die weltliche Macht der Kirche begründend, während Christus das Schlußwort hat, in welchem er dem fortdauernden Dualismus von Gut und Böse seine Botschaft der Liebe entgegenhält: »Ewig wird Böses sein und kreisen. Aber ich bin flammend Mal und Ziel. Aufruf – Gleichnis.« Keine Frage, daß aus dieser Christusgestalt auch der junge Autor selbst spricht. Das im trüben Greifswalder April entstandene Stück für seine Freunde ist auch eines des Heimwehs nach dem verlorenen Paradies Ortelsburg und der Auflehnung gegen den Materialismus der Welt. Aber immer noch handelt es sich um literarische Spiegelfechtereien, um bloßes Spiel, denn seine Verhältnisse sind zwar nicht glänzend, aber doch gesichert, und Christi Opfertod bleibt ein gesucht heroisches Bild – jenseits persönlicher
Erfahrungen.
Das ändert sich im November 1925. Ein Tumorleiden löscht das Leben der Mutter aus, und die Not greift nun unvermittelt nach dem neunzehnjährigen Osram-Hilfsarbeiter Wolfgang Koeppen, der inzwischen in Berlin lebt. Im Winter 1925/26 versucht er sich in der Hauptstadt durchzuhungern und die große Erschütterung zu verarbeiten. Die komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse zu »Onkel« und Tante verbieten ihm Bettelbriefe. Er ist auf eigene Erfolge aus. So entstehen zwischen November 1925 und Frühjahr 1926, vermutlich in Berlin, eine Reihe expressionistischer Gedichte, in einer Mischung aus lateinischer Schrift und Sütterlin auf Schulheftpapier mit Rechenkästchen geschrieben und von Koeppen mit Faden geheftet, die er vergebens an verschiedene Adressen, an Zeitschriften und Verlage schickt. »Knospen Staubblüten Schrei« schreibt er auf das Titelblatt. Das Werdende, das Befruchtende, das Aufbegehrende: ein ganzes expressionistisches Programm in drei Worten, geschrieben in einer Zeit, in der der Expressionismus schon von der Tagesordnung verschwunden war. Der Debütant war ein zu spät Gekommener. Trotzdem darf die Ablehnung der Zeitungen und die Tatsache, daß Koeppen nie auf sein Frühwerk zurückkam, nicht das letzte Wort über diese Dichtungen sein, zumal sie – bzw. der Expressionismus – sein Schreiben lebenslang beeinflußten: »In jedem Werk der Literatur, der Kunst ist Expressionismus als Geburtshelfer zu finden«, schreibt der Siebzigjährige bekenntnishaft.
[…]
SINN UND FORM 3/2015, S. 300-308, hier S. 300-303
