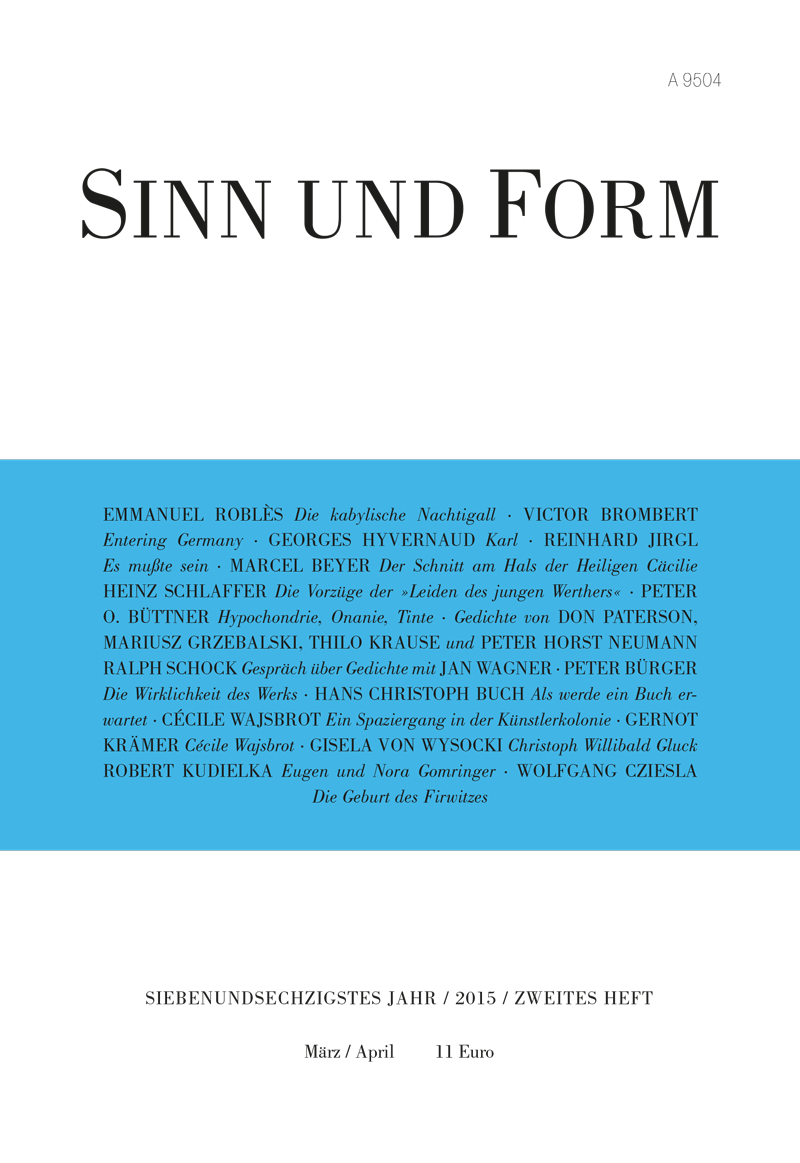
[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-22-5
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 2/2015
Schock, Ralph
»EINE ANDERE WAHRNEHMUNG DER WELT«
Ein Gespräch über Gedichte mit Jan Wagner
RALPH SCHOCK: Ihr neuer Gedichtband »Regentonnenvariationen« ist vor einigen Monaten erschienen. Ich habe Sie in Frankfurt während der Buchmesse daraus lesen hören und gedacht, das ist ein Autor, mit dem ich gern über Dichtung sprechen würde. Ihre literarische Karriere hat aber gar nicht mit einem Lyrikband begonnen.
JAN WAGNER: Bevor mein erstes eigenes Buch herauskam, habe ich unter anderem Charles Simic übersetzt, einen amerikanischen Dichter mit Belgrader Wurzeln, und wie so viele junge Lyriker eine Zeitschrift herausgegeben, besser gesagt, ein Objekt zwischen Zeitschrift, Buch und Kunstgegenstand – eine Literaturschachtel.
SCHOCK: Können Sie diese Literaturschachtel beschreiben?
WAGNER: Von 1994 bis 2003 haben wir elf Ausgaben gemacht. Der Titel »Die Außenseite des Elementes« ist im Grunde eine Art sprachliches Ready-made, nämlich der Aufkleber, mit dem Glaser die Außenseite einer Fensterscheibe bekleben, also die Wetterseite. In der DIN-A4-Pappschachtel befindet sich eine gedruckte Loseblatt-Sammlung mit Lyrik aus aller Welt, im Original und in Übersetzung, aber auch Prosa, Zeichnungen, Radierungen und so weiter. Durch den Verzicht auf Heftung und Seitennumerierung waren die Leser eingeladen, selbst die Reihenfolge zu bestimmen: das Lieblingsgedicht nach oben zu legen, vielleicht sogar eine Zeichnung, die sie besonders mochten, herauszunehmen, zu rahmen und an die Wand zu hängen. Mit anderen Worten: Es war eine nichthierarchische Publikation, bei der die Käufer in den Gestaltungsprozeß eingebunden werden sollten. Das Ganze zum Selbstkostenpreis und gewissermaßen als literarische Hommage an Marcel Duchamp und seine Schachtelkunst.
SCHOCK: Sie haben auch Arbeiten von Lyriker-Kollegen herausgegeben. Beachtung fanden zum Beispiel die 2003 erschienene Anthologie »Lyrik von Jetzt« und der einige Jahre später veröffentlichte Nachfolgeband.
WAGNER: Beide Bücher habe ich mit Björn Kuhligk herausgegeben. Es war der Versuch, die Lyrik unserer Generation zu sammeln. Wir wußten ja, wie aufregend das war, was in der deutschsprachigen Poesie geschah. Nicht zu Unrecht ist gesagt worden, daß der Reichtum an großartiger Lyrik seit Mitte der neunziger und erst recht in den letzten zehn Jahren seinesgleichen sucht, daß es vielleicht seit dem Frühexpressionismus keine solche Vielfalt individueller Stimmen mehr gegeben hat. Wenn man das selbst erlebt und sieht, wer in den Cafés und Kneipen liest, wer in den kleinen Zeitschriften, von denen es ja wimmelt, publiziert, hat man den Wunsch, es einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die in der Regel gar nichts davon ahnt.
SCHOCK: Sie wurden 1971 in Hamburg geboren und haben dort und in Dublin und Berlin Anglistik studiert. Sind Sie in einem literarischen Elternhaus aufgewachsen?
WAGNER: Ich bin in einem Haus mit einer großen Bibliothek aufgewachsen, und meine Eltern haben mich schon in frühester Kindheit zum Lesen ermuntert. Zuerst waren das vor allem Romane, die Lyrik kam dazu, als ich vierzehn, fünfzehn war, und hat mich regelrecht zum Glühen gebracht. Emily Dickinson hat einmal geschrieben: »Wenn es sich anfühlt, als würde Deine Schädeldecke abgehoben, dann weißt Du, es ist Poesie.« Und das geschah mir zum Beispiel mit den Frühexpressionisten Georg Heym, Georg Trakl, besonders aber mit englischsprachigen Dichtern. Der erste, der mich so begeistert hat, daß ich dachte: So würde ich die Sprache auch gern beherrschen, als eine Magie zweiter Ordnung, war Dylan Thomas, der berühmte walisische Dichter, der auch eine wunderbare Stimme hat. Eine Freundin beschrieb sie einmal als »a rich old fruity portwine of voice«, als volle, fruchtige Portweinstimme, was es sehr gut trifft. Ich habe seine Stimme, seine Gedichte und auch sein Hörspiel »Unter dem Milchwald« gehört und war hin und weg.
SCHOCK: Sie sind mit Ihren Veröffentlichungen außerordentlich erfolgreich, sind Mitglied mehrerer Akademien, wahrscheinlich fast überall eines der jüngsten, Ihre Gedichte wurden in allen wichtigen Anthologien gedruckt, die Liste der Ehrungen und Preise bei Wikipedia ist beinahe länger als Ihr biographischer Eintrag. Können Sie als Lyriker auskömmlich leben?
WAGNER: Ich bin in jedem Fall beglückt und wurde reich beschenkt, gar keine Frage. Das ändert aber nichts an der Faustregel, daß man von Lyrik nicht leben kann. Niemand, der ein geregeltes Auskommen haben möchte, sollte darauf hoffen, das mit dem Schreiben von Gedichten erreichen zu können. Das ist, anders als bei Romanen, im Grunde unmöglich, und viele befreundete Dichterentscheiden sich deshalb ganz bewußt für einen Brotberuf. Sie sind zum Beispiel Buchhändler, arbeiten beim Rundfunk oder an einer Universität. Es ist möglich, als freier Lyriker zu leben, wenn man verschiedene Einkünfte hat, in meinem Fall etwa durch eigene Bücher, durch Lesungen in Buchhandlungen oder Literaturhäusern, durch Übersetzungen und Rezensionen. Doch selbst dann ist man darauf angewiesen, ab und zu ein Stipendium zu bekommen, das einem ein halbes Jahr oder länger Sicherheit und Unabhängigkeit schenkt.
SCHOCK: Haben Sie angesichts all der Ehrungen und Preise eine bestimmte Strategie, um nicht abzuheben, um auf dem Teppich zu bleiben?
WAGNER: Mein Teppich ist so gut verlegt, daß ich die gar nicht brauche, und es ist auch kein fliegender Teppich. Es mag banal klingen, aber für mich ist das Gedicht das Entscheidende. Ich bin erstaunt und beglückt, daß meine Texte so positiv aufgenommen werden, aber was mich wirklich glücklich macht, ist das Gelingen eines Gedichts. Ich glaube, so geht es allen, die Gedichte schreiben. Das liegt an der Wichtigkeit, die man der Sprache beimißt, dem Wunsch, all ihre widerstrebenden Elemente – das Musikalische, die Semantik, die Metaphern, die Paradoxien – auf engstem Raum zu vereinen, zum Klingen zu bringen und etwas zu schaffen, das dem Diktum von Emily Dickinson entspricht, das zu einer anderen Wahrnehmung der Welt führt, zu einer Explosion im Kopf. Der Wunsch, das zustande zu bringen, ist so groß, daß er das Hauptaugenmerk beansprucht.
SCHOCK: Diesen Anspruch haben Sie in dem wunderbaren Gedicht »giersch« exemplarisch eingelöst. Können Sie erzählen, wie so ein Text zustande kommt? Giersch ist ja eigentlich ein Unkraut. Manche Leute essen ihn auch als Gemüse. Haben Sie das mal probiert?
WAGNER: Nein, ich bin auch kein Gartenbesitzer, aber ich habe mir sagen lassen, daß er gut schmeckt. Man kann Suppe daraus machen, Salat, auch Quiche, was mir gut gefällt, weil Quiche und Giersch – als Giersch-Quiche – eine wunderbare Wortkombination ergibt. Jeder Gärtner liebt und haßt den Giersch, aber man kann unmöglich so viel davon essen, daß der Garten gierschfrei wird. Ich saß einmal als einziger Balkonbesitzer unter lauter Kleingärtnern, die sich über ihre Gierscherfahrungen austauschten und jammerten und stöhnten. Als Unbeteiligter konnte ich mich ganz auf das Wort Giersch konzentrieren, in dem wunderbarerweise schon die Gier enthalten ist, die ihn ausmacht. Ich ließ mich von dem Gespräch wegtreiben und begann über die Laute dieses Wortes nachzudenken. So kam es zu dem Gedicht. Wenn man es zum ersten Mal hört, wird man vielleicht nicht merken, daß es eine klassische Form bedient. Es ist ein Sonett, allerdings ein unterwandertes oder, wie es sich für den Giersch gehört, ein überwuchertes. Die Klangstruktur des Wortes sprengt mit ihrem sprachlichen Wurzelwerk die Form, bricht sie auf und überwuchert das ganze Gedicht.
SINN UND FORM 2/2015, S. 214-228, hier S. 214-216
