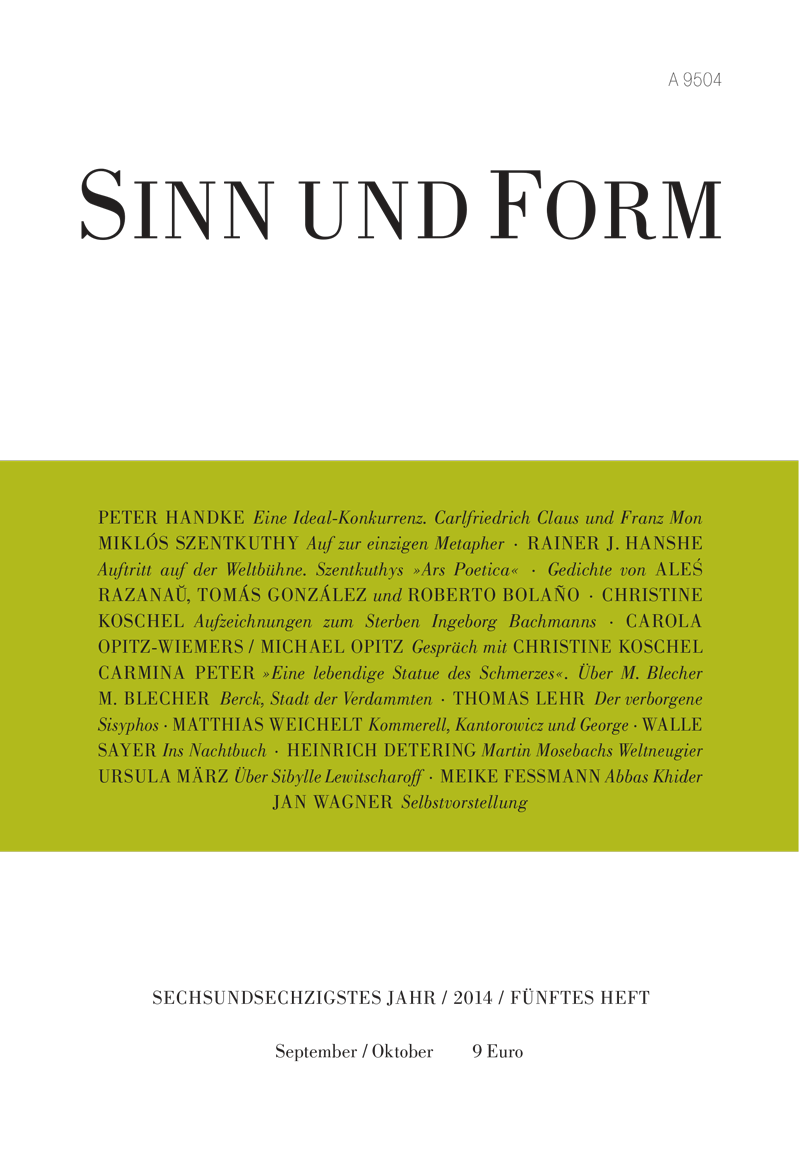
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-19-5
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 5/2014
Opitz-Wiemers, Carola, und Michael Opitz
»Der Bachmann glaube ich, was sie schreibt»
Gespräch mit Christine Koschel
MICHAEL OPITZ, CAROLA OPITZ-WIEMERS: Sie haben 1961, im Alter von fünfundzwanzig Jahren, mit dem Lyrikband »Den Windschädel tragen« debütiert. Wann haben Sie mit dem Schreiben begonnen?
CHRISTINE KOSCHEL: Mit etwa fünfzehn, als der alte Fürst von Thurn und Taxis starb. Ich besuchte in Regensburg eine Internats-Klosterschule, und wir mußten in der Kirche an dem aufgebahrten Fürsten vorbeidefilieren. Für uns Kinder war das ein schockierendes und berührendes Erlebnis. Aus dieser Begegnung mit dem Tod ist mein erstes Gedicht entstanden.
OPITZ/WIEMERS: Hat Sie jemand ermutigt, diese ersten Texte zu veröffentlichen?
KOSCHEL: In der »Zeit« wurde ganz früh etwas gedruckt, das habe ich neulich im digitalem Archiv wiedergefunden. Teilweise sehr lustige Texte, ich war erstaunt, daß ich das mal geschrieben haben soll. Diese ersten Veröffentlichungen verdanke ich Wolfgang Liebeneiner. Er war während der Nazizeit Produktionschef der UFA-Film. Eigentlich wollte ich ja Schauspielerin werden, und er hat mich zum Vorsprechen und danach zum Essen eingeladen. Dabei habe ich ihm wohl erzählt, daß ich Gedichte schreibe. Er hat sie dann an Rudolf Walter Leonhardt, den damaligen Feuilletonchef der »Zeit«, weitergegeben, der fünf oder sechs davon gedruckt und sogar ein Honorar gezahlt hat, worüber ich sehr glücklich war, da ich kaum Geld hatte.
OPITZ/WIEMERS: Wann war das?
KOSCHEL: Das muß 1957/58 gewesen sein, vor meinem Kontakt mit Heinrich Ellermann. Ich lebte in München, und man hatte mir gesagt, daß es dort einen Verleger für neue Lyrik gebe, bei dem ich es versuchen solle. Ich bin also nach Schwabing in seinen Verlag gegangen und habe ihm meine Manuskripte gezeigt. Und er meinte: Schreiben Sie weiter und kommen Sie in einem Jahr noch mal zu mir. Nach einem Jahr habe ich ihm wieder etwas geschickt. Darauf bekam ich ein Telegramm von ihm, in dem stand: Ich drucke Sie. Das war der Vertrag. Ich durfte mitbestimmen, wie das Buch aussah, japanische Blockbuchheftung, und habe einhundert Freiexemplare bekommen sowie die Zusicherung, daß ich immer zu ihm kommen dürfe, wenn ich Geld brauche. Das habe ich zweimal gemacht. Das war Herr Ellermann, ein Traumverleger. Durch ihn ist auch die Beziehung zu Nelly Sachs zustande gekommen, denn er war der erste, der ihre Gedichte in Westdeutschland veröffentlichte. Er schickte ihr mein Buch, woraufhin sie mir sofort schrieb. Daraus ist unser Briefwechsel entstanden. Später, 1969, wollte sie mich auch in Rom besuchen – sie sollte in der Villa Sciarra lesen. Leider haben ihr die Ärzte die Reise verboten. So haben wir uns nicht persönlich kennengelernt.
OPITZ/WIEMERS: Aus dem Briefwechsel stammt auch Nelly Sachs‘ Formulierung, Sie hätten »viele Blitze aus den Nächtigkeiten der Worte geschlagen«, die im Nachwort Ihres jüngsten Bandes »Bis das Gedächtnis grünet« wieder auftaucht.
KOSCHEL: Das hat sie mir auf einer Briefkarte geschrieben. Es ist eine unmittelbare empathische Reaktion, die mir damals sehr half, denn ich war wahnsinnig unsicher und hatte keinerlei Rückendeckung. Meine Mutter hat immer gesagt, ich schreibe, wie es im Telefonbuch steht.
OPITZ/WIEMERS: Ein seltsamer Vergleich. Sie hatte also eine eher ablehnende Haltung?
KOSCHEL: Ja, eine zutiefst negative. Ich bin auch von zu Hause weggegangen, wir haben uns nie wiedergesehen. Sie hatte nur einen Maßstab, und der war Utta Danella.
OPITZ/WIEMERS: 1963, zwei Jahre nach Ihrem Debüt, waren Sie bei der Gruppe 47 eingeladen.
KOSCHEL: Ich war überhaupt nicht eingeladen. Aber ich kannte Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger und hoffte, daß sie mir helfen würden, eine Einladung zu bekommen. Ein Freund aus München meinte dann, fahr doch einfach hin, und packte mich ins Auto nach Saulgau. Weder die Bachmann noch die Aichinger waren da, dafür aber Alexander Kluge, den ich aus dem »Schwabinger Nest« kannte, einem Café, in dem sich damals alle trafen, die irgend etwas mit Kunst, Film und Theater zu tun hatten. Mit Kluge war ich ein bißchen befreundet, obwohl wir ganz unterschiedliche Menschen waren. Ich hatte meinen Ellermann-Band dabei und sagte: Alexander, ich bin jetzt hier und würde gerne lesen. Kannst du mir eine Lesung verschaffen? Er hat gesagt, ich solle warten, ist mit dem Buch ins Hotel zu Hans Werner Richter gegangen, hat mich dort eingeführt, und sofort habe ich die Einladung erhalten. Ich habe dann als Vorletzte gelesen, es gibt auch ein Bild von mir auf dem Stühlchen. Die Lesung wurde positiv aufgenommen, ich hatte nur gute Kritiken, von Walter Jens und Günter Grass und Johannes Bobrowski, der im Vorjahr den Preis der Gruppe bekommen hatte. Ich war damals furchtbar schüchtern. Bobrowski machte mir ständig Zeichen, ich solle doch mein Manuskript herzeigen, was ich schließlich auch tat. Am letzten Abend hat mich Unseld mit den Suhrkamp-Autoren an seinen Tisch geholt, aber ich bin mit meinem Buch schließlich zu Piper gegangen. Im Nachlaß von Ingeborg Bachmann habe ich einen Brief gefunden, in dem Piper ihr von meinem Auftritt in Saulgau berichtet. Er hat für mich votiert.
OPITZ/WIEMERS : Das war ja schon eine der letzten Tagungen der Gruppe 47. Haben Sie als Neuankömmling überhaupt bemerkt, daß Veränderungen im Gange waren?
KOSCHEL: Nein, gar nicht, für mich war alles neu und interessant. Peter Weiss, der aus seinem Stück »Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats« las, fand ich sehr komisch, weil er sich immer als Schriftsteller und Maler vorgestellt und einem gleich die Hand gegeben hat. Ein wunderbarer Autor, was ich damals aber noch nicht wußte. Mir waren eigentlich all diese Leute unbekannt. Ich bin als junge Autorin, die auch mal lesen durfte, dort reingekommen und habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Es gab auch einen Abschlußball, bei dem ich mit Günter Grass einen Tango getanzt habe. Er hat mich an sich gerissen und übers Parkett geschleudert, und ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen.
OPITZ/WIEMERS: 1965 sind Sie von München, wo Sie als Regieassistentin für Film und Theater arbeiteten, nach Rom gegangen. Welche Gründe gab es für Sie, Deutschland zu verlassen?
KOSCHEL Das hing unmittelbar mit meiner Arbeit zusammen. Schauspielerin wollte ich nicht mehr werden, da mir das Schreiben wichtiger war. Ich hatte aber das Glück, eine Regieassistenz bei Kurt Hoffmann zu bekommen, der damals ein bekannter Filmregisseur war. Bei Theater und Film war ich Assistentin von Hans Dieter Schwarze. Ich wollte etwas ganz anderes. Einen Bruch mit dem traditionellen Theater. Das »Arme Theater« von Jerzy Grotowski aus Breslau, der später nach Berlin kam, wäre meine Richtung gewesen. Aber die Deutschen mochten ihn nicht, auch nicht nach seinem Tod. Die Italiener dagegen haben ihn gefeiert. Auch die geistige Atmosphäre in München hat mich nicht befriedigt. Obwohl ich damals noch nicht politisch gedacht habe, hat es mich doch gewundert, daß in den Gedichten der hofierten Autoren und Preisträger der Krieg kaum vorkam. Günter Eich war damals die bestimmende Figur, aber auch in seinen Gedichten ist von der Katastrophe des Dritten Reichs eigentlich nichts zu spüren. Als Regieassistentin habe ich seine Frau, Ilse Aichinger, kennengelernt. Ich habe sie verteidigt, als sie während einer Hörspielproduktion vom Dramaturgen und von Schwarze angegriffen wurde. Daraus entstand unsere langjährige Freundschaft. Sie lud mich nach Lenggries ein, wo ich auch Eich kennenlernte. Wir tauschten dann unsere Gedichte aus, und sie schrieb das Nachwort zu meinem Band »Pfahlfuga«. Aber Eich blieb mir ein Rätsel.
OPITZ/WIEMERS: Warum entschieden Sie sich für Italien, Sie hätten doch auch nach Frankreich oder Norwegen gehen können?
KOSCHEL: Meine erste Reise nach Italien machte ich 1959. Ich hatte kein Geld, aber man konnte damals in Rom ganz billig von Trauben und Brot leben. Ich wohnte bei einem Schneider, der sehr gut Deutsch sprach und Fichte las, was ich wunderbar fand. Ich mietete ein Bett bei ihm und schlief hinter einem Vorhang. Und beim Frühstück erzählte er mir begeistert von Fichte, über den ich gar nichts wußte. So habe ich den Nachkriegsglanz von Rom erlebt, das noch einen ganz anderen Zauber hatte, auch hinsichtlich der Menschen und ihrer Lebensweise. Das gibt es heute gar nicht mehr. Im Rückblick hat diese Faszination mit dazu geführt, daß ich mich 1965 entschieden habe, nach Rom überzusiedeln. Damit begann das Sich-Einlassen auf Italien, auf die Luft, die Gerüche, die Dinge, ohne irgendwelche politischen oder sprachlichen Vorkenntnisse.
OPITZ/WIEMERS: Als Sie zum Treffen der Gruppe 47 nach Saulgau fuhren, kannten Sie Ingeborg Bachmann bereits. Wie war es dazu gekommen?
KOSCHEL: Das passierte im Oktober 1958, im Münchner Studio Fink in der Kaulbachstraße, einer privaten Villa, in der viele Lesungen stattfanden. Ingeborg Bachmann las »Was ich in Rom sah und hörte« – das wurde natürlich bedeutsam für mich – und sie las Gedichte aus ihrem Band »Anrufung des Großen Bären«. Ich war von dieser schönen jungen Frau und ihren Texten so fasziniert, daß ich zu meinem damaligen Freund sagte: Du, ich würde sie gerne kennenlernen. Und dieser Freund hat – ohne es mir zu sagen – die Bachmann angerufen, von meiner Begeisterung erzählt und gefragt, ob sie mir nicht ein Treffen gewähren würde. So hatte ich plötzlich eine Verabredung mit ihr in einem Café am Elisabethplatz. Wir haben uns zwei oder drei Stunden intensiv unterhalten und unsere Adressen ausgetauscht.
[…]
SINN UND FORM, 5/2014, S. 638-646, hier S. 638-641
