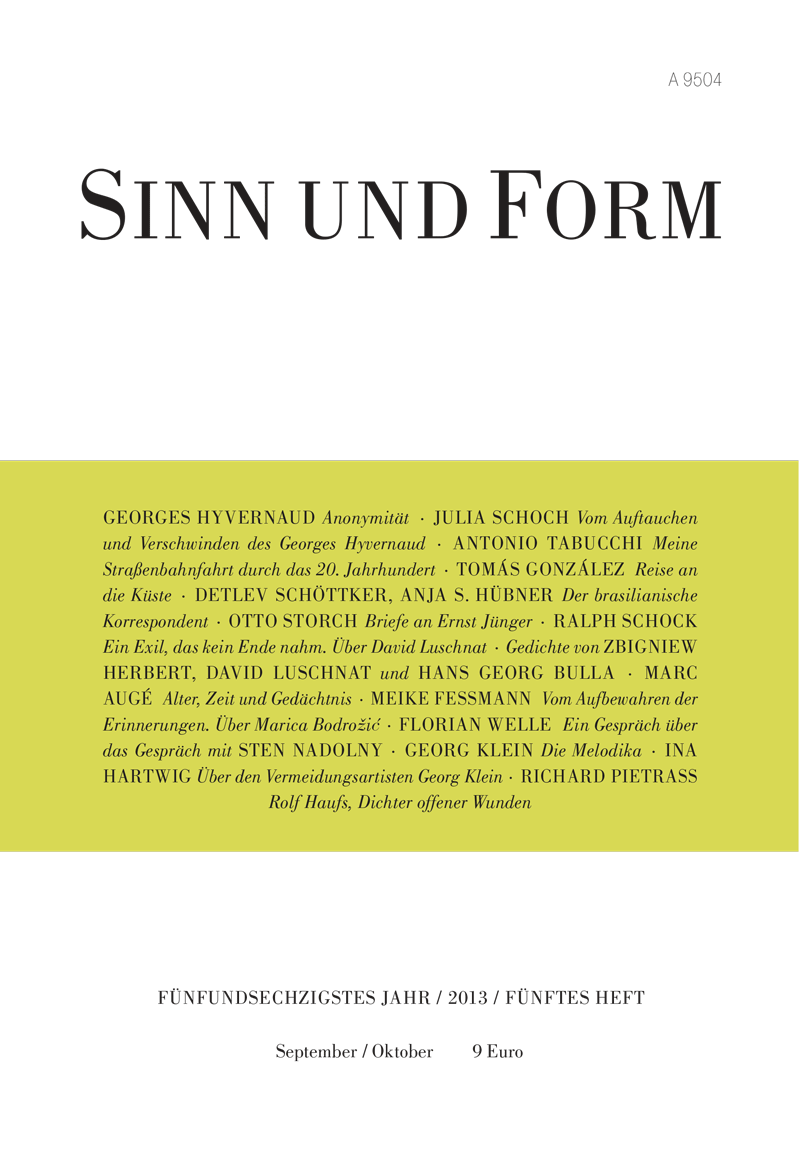Leseprobe aus Heft 5/2013
González, Tomás
Reise an die Küste
Für Don Gabriel
diese Geschichte, die aus dem wenigen entstand, das ich weiß oder erinnere, und dem unendlich vielen, das ich nicht weiß oder vergessen habe.
»Übermorgen ist der dritte«, sagte die Mutter.
»Schon wieder November«, erwiderte Emma. »Das Jahr ist wie im Flug vergangen.«
Am nächsten Tag räumten Mutter und Tochter das Bett und die anderen Möbel aus dem Zimmer, von dem man auf die Mangobäume und die Gartenmauer dahinter schaute, und stellten zwei Reihen Stühle auf – so wurde es zum Eisenbahnwagen. Aus dem Wohnzimmer entfernten sie allen Zierrat und hängten die Bilder ab – der Wartesaal. Den Schreibtisch rückten sie in den Gang; er sollte als Fahrkartenschalter, als Theke und außerdem als Ablage für die schwarzen Papptafeln dienen, auf denen mit weißer Kreide die einzelnen Stationen geschrieben standen. Die hatten sie nach ihrer Erfahrung mit der ersten Reise angefertigt und in der richtigen Reihenfolge bereitgelegt, um nicht wieder durcheinanderzukommen. In La Dorada mußte man in den Expreso del Sol umsteigen.
»Ich werde Käsestückchen in Bananenblättern verkaufen«, sagte Emma.
Sie war das jüngste der acht Kinder und wohnte als einzige noch bei den Eltern. Während der alljährlichen Reise ihres Vaters an die Küste mußte sie verschiedene Rollen spielen, und für jede hatte sie die passenden Kostüme und Requisiten zur Hand: Käseverkäuferin, Gebäckverkäuferin, Verkäufer von bunten, auf einen Pfahl gespießten Lutschern, auf einer Bahnhofsbank eingenickte Frau, Polizist mit Schlagstock und angeklebtem Schnurrbart, alleinreisender junger Mann, der Aguardiente aus der Flasche trinkt, und viele andere.
»Und Karamelkekse bitte«, sagte Jesusita.
Am Abend packte Don Rafael seine Sachen, und sie achtete darauf, daß alles komplett war. Das letzte Mal hatte er acht Unterhosen eingepackt, aber keine Socken. Er würde von allem zwei Paar brauchen für die zwei Tage, die sie bei seiner Familie in Barranquilla zu Besuch sein wollten.
Im vergangenen Jahr hatte Don Rafaels Mutter, die fünf Jahre zuvor mit 95 und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte gestorben war – zu viele Kräfte und zu besitzergreifend, fanden manche ihrer Enkel –, ihren Sohn noch ungestümer als sonst zum Bleiben gedrängt, denn eine so lange Reise lohne sich nicht für einen so kurzen Besuch. Als sie ihn schon beinahe überredet, ja, fast genötigt hatte, war Jesusita gezwungen einzugreifen – obwohl es ihr unheimlich war und sie sich allein auf ihre Intuition verlassen mußte, denn sie konnte nicht wissen, was ihre Schwiegermutter sagte, sie hörte ja nur, was Don Rafael antwortete. Aber sie machte es sehr gut und erreichte schließlich, daß Don Rafael zurückkehren durfte.
Jesusita und Don Rafael waren zeitig am Bahnhof, kauften ihre Fahrkarten und setzten sich in den Wartesaal.
»Hoffentlich hat er nicht wieder Verspätung«, sagte sie und schaute auf die Bahnhofsuhr.
»Wir sind früh dran«, sagte Don Rafael.
»Ja, nicht wahr?« sagte Jesusita rasch, glücklich darüber, daß er zum ersten Mal seit Monaten wieder sprach.
Emma, in den Kleidern der Verkäuferin des Bahnhofskiosks, reichte ihrem Vater zwei Kaffee und vier Karamelkekse über den zur Theke gewordenen Schreibtisch. Trotz der Hitze ergriff Don Rafael die Tasse mit beiden Händen, als wolle er sich wärmen, und schlürfte geräuschlos. Jesusita hatte ihm einen Wollpullover eingepackt, denn nachts wurde ihm schnell kalt, sogar im warmen Klima von Honda.
»Man kann ihn schon hören«, sagte Don Rafael nach einer Weile.
Sie schaute auf die Uhr. Nur zwanzig Minuten Verspätung. Letztes Jahr war es fast eine Stunde gewesen, wegen eines Erdrutschs am Alto de la Mona, und um ein Haar hätten sie den Anschlußzug in La Dorada verpaßt. Jesusita liebte das Reisen, und besonders diese Reise, die 25 bis 35 Stunden dauern konnte und auf der man so viel erlebte. Sie genoß den Duft der Pflanzen, der durchs Waggonfenster hereinkam, den Wind und sogar den Dieselgeruch der Lokomotive. »Ja. Ich kann ihn auch hören.«
Die erste dieser Reisen lag vier Jahre zurück. Don Rafael hatte nach und nach das Gedächtnis und die Fähigkeit, die Dinge zusammenzuhalten, verloren und lebte schon seit langer Zeit in einem Zustand, in dem er nichts mehr tat und kaum noch redete. Eines Abends sah Jesusita, wie er seinen Koffer aus der obersten Ablage des Wandschranks holte und zu packen begann.
»Willst du verreisen?« fragte sie ihn, und er sagte, ja, und forderte sie auf, ebenfalls zu packen, denn sie müßten nach Barranquilla fahren. Seine Mutter habe Geburtstag, und die ganze Familie würde zur Feier kommen. Jesusita wußte sofort, woran sie war, und brauchte nicht erst zu fragen, wie er zu reisen gedachte, denn Don Rafael war seit seiner Zeit als Vertreter für Singer-Nähmaschinen – bevor er sich in Honda niederließ, Jesusita kennenlernte und die Eisenwarenhandlung aufmachte – ein großer Freund der Eisenbahn.
»Deine Mutter lebt nicht mehr, Rafael, und den Zug haben sie abgeschafft«, erinnerte sie ihn, doch er packte schweigend weiter.
Jesusita überlegte einen Moment, wie sie damit fertigwerden sollte.
»Alles klar«, sagte sie. »Fahren wir!«
Weil damals niemand vorbereitet war, gab es Probleme mit den Sitzplätzen, mit den Namen der Stationen, bei der Versorgung mit Reiseproviant, und obendrein machte ihnen die Hitze zu schaffen. Trotzdem war die Reise für Jesusita ein unvergeßliches Erlebnis. Danach lernten sie, die Dinge besser zu organisieren, und die Fahrt an die Küste wurde für alle zu einem Vergnügen, auch wenn sie so lange dauerte und es jedes Jahr am Ende ihres Besuchs unweigerlich zu einem häßlichen Zusammenstoß zwischen Jesusita und ihrer aufdringlichen Schwiegermutter kam.
Sie erreichten La Dorada. Emma rannte am einfahrenden Zug entlang und bot Weintrauben und Ananasscheiben feil. Sie machte ihre Sache so gut, daß der Eindruck entstand, sie würde nicht allein rennen, sondern mit einer ganzen Schar von Kindern und Jugendlichen, die etwas zu verkaufen hatten. Jesusita und Don Rafael verließen den Zug und bahnten sich durch das Chaos der Verkäufer einen Weg zu den Toiletten. Danach stiegen sie in den Expreso del Sol, der gerade eingetroffen war und den Verkäufern zufolge in zehn Minuten weiterfahren sollte.
Nachdem sie das Gepäck verstaut und ihre Plätze eingenommen hatten, reckte Jesusita, nach Luft schnappend, den Kopf aus dem Wagenfenster, um zu sehen, wo Emma blieb. Die Hitze war so groß geworden, daß der Fächer, mit dem sie sich Kühlung zuwedelte, nicht mehr ausreichte. Wie immer, wurden aus den zehn Minuten fünfzehn, dann zwanzig und schließlich dreißig, bis sich der Zug endlich in Bewegung setzte und die Ventilatoren für frische Luft sorgten. »Man kann den Fluß riechen«, sagte Don Rafael.
Vom leichten Schaukeln der Eisenbahn eingelullt, nickten sie nach La Dorada ein. Als sie aufwachten, fuhr der Zug gerade durch Caño Alegre, einen Ort, der keinen richtigen Bahnhof hatte, sondern nur einen Bahnsteig, an dem der Expreso del Sol nicht hielt. Jesusita hatte die Augen wegen des Fahrtwinds halb geschlossen und sog den Geruch der Pflanzen und des Gestrüpps entlang der Gleise ein. Die ersten fünf Stunden waren im Nu vergangen. Aus dem Proviantkorb nahm sie Sandwiches, die sie am Abend vorbereitet hatte, in Dreiecke geschnitten und ohne Rinde, belegt mit Ei, Wurst, Tomaten, Salatblättern und Mayonnaise. Aus einer Thermoskanne, die auch im Korb war, schenkte sie kalte Limonade ein.
er Tag erreichte seinen strahlenden Höhepunkt. Don Rafael sah, wie die Rinder auf den Weiden, über die die Eisenbahnstrecke führte, den Schatten der Ceibas suchten, während die Reiher ihnen die Zecken aus der Haut pickten oder einfach nur auf ihren Rücken standen, als gehöre ihnen die Welt. Das Geländer einer Eisenbrücke flog am Wagenfenster vorbei, und unten, am Ufer eines kleinen Flusses, kniete eine Frau, die Wäsche auf einen Stein schlug und zu ihnen aufsah. Weder Don Rafael noch Jesusita kamen dazu, Emma zuzuwinken, denn der Blick aus dem Wagenfenster wurde durch ein vorbeisausendes Gestrüpp verdeckt. Dann ging es wieder über ausgedehnte Weideflächen mit Viehherden.
Don Rafael beobachtete leicht amüsiert seine Frau, die sich seit einiger Zeit mit halbgeschlossenen Augenlidern dem Fahrtwind hingab. Er konnte einem solchen Vergnügen nichts abgewinnen, er fand eher an handfesten Dingen Gefallen, an einem stabilen Weidezaun etwa oder einer majestätischen Hochspannungsleitung. Bis zu der Zeit, als er sich nicht mehr zurechtfand, hatte Don Rafael in seiner Eisenwarenhandlung gearbeitet, und deshalb zog ihn alles an, was aus Metall war, kleine Dinge wie das Räderwerk einer Armbanduhr oder monumentale Werke wie Eisenbrücken und das Gleisgelände in La Dorada. Sein Bruder Jaime saß jetzt neben ihm und erzählte von früher, als sie zum Angeln an die Ciénaga Grande gefahren waren. Wo war er eigentlich zugestiegen?
»Jaime arbeitet in Nare«, sagte Don Rafael.
Jesusita fand es nicht nötig zu berichtigen – denn Don Rafael hätte es sofort wieder vergessen –, daß Jaime in der Tat viele Jahre in der Zementfabrik von Nare gearbeitet hatte, aber seit mehr als zehn Jahren pensioniert war und jetzt in Barranquilla lebte. Falls man das leben nennen konnte, denn er litt an einem schweren Emphysem.
»Ah, ist er wieder dort?« sagte sie. »Wo ihm die Stelle doch gar nicht zugesagt hat.«
Don Rafael schaute aus dem Zugfenster und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt.
»Da, die Kuppel der Kirche von Puerto Nare.«
»Kannst du sie sehen?«
»Auf der Kirchturmuhr ist es jetzt eins.«
Jesusita machte sich nicht die Mühe, auf ihre eigene Uhr zu schauen. Es war ein Uhr.
Dann schlief Don Rafael ein. Sein Kinn war auf die Brust gesunken, und eine schlaffe graue Haarsträhne hing ihm in die Stirn. Jesusita stand auf, um mit Emma zu reden, die mit aufgestützten Ellbogen am Küchentisch saß und Kaffee trank. Emma hatte mit Flor telefoniert, ihrer ältesten Schwester, die in Armero wohnte und am Abend kommen wollte, um ihr bei der Reise zu helfen. Mit den anderen Geschwistern konnte man nur ab und zu rechnen, oder in Notfällen, denn sie hatten ihre Arbeit und Familien mit kleinen Kindern. Aber alle verfolgten den Verlauf der Reise, und wenn sie kurz vorbeikamen, brachten sie Emma Sachen zum Verkaufen mit – Backwaren, Würstchen oder eiskalte Hafermilch – und warfen einen Blick in den Eisenbahnwagen.
Kurz vor Puerto Berrío fing es an, in Strömen zu regnen. Emma war auf dem Bahnhof und bot, in ein Regencape gehüllt, Ananasscheiben, Weintrauben und Mandarinen aus ihrem Obstkorb an. Der Regen hatte die meisten anderen Verkäufer vertrieben, sie waren zur Gartenmauer geflüchtet, unter die Mangobäume.
»Wann fahren wir endlich weiter?« fragte Jesusita und wedelte sich mit ihrem Jungmädchenfächer – rote Rosen auf weißem Grund – etwas Luft zu. Emma hatte die Ventilatoren ausgeschaltet.
»Ich geh aufs Klo und erkundige mich unterwegs«, sagte Don Rafael. Kurz darauf hörte Jesusita die Spülung im oberen Stockwerk und wie er die Treppe herunterkam und mit Leuten sprach, wahrscheinlich mit anderen Reisenden oder mit jemandem vom Zugpersonal. Dann kam er in den Waggon zurück. »Es ist nicht voll, aber es sind eine Menge Leute da«, berichtete er, als wenn er, um das herauszufinden, seinen Platz verlassen hätte.
Für die zweite Reise hatte Emma aus Pappe die lebensgroßen Umrisse von zehn Personen ausgeschnitten, die sie mal als Reisende, mal als Verkäufer oder Streckenarbeiter einsetzte. Sie bewahrte sie mit der Weihnachtsbeleuchtung in einer Abstellkammer auf und holte sie jedes Jahr Anfang November wieder heraus. Im Augenblick waren sie Verkäufer und Verkäuferinnen, denen der Regen die Hosenbeine und Röcke naßgespritzt hatte. Neben dem Reigen der Hosen und Röcke sah Don Rafael die Körbe mit Maismehlkrapfen und Tamales, mit Käse und Guavengelee, mit gekochten Hühnern, die gelb und fettglänzend – für seinen Geschmack alles andere als appetitlich – ihre Keulen zum Himmel streckten.
Don Rafael aß immer sehr wenig. Seine Frau und seine Kinder sorgten sich um seine Gesundheit und forderten ihn bei Tisch ständig auf, sich mehr zu nehmen. Er trug Tropenhemden, hellblaue oder hellgelbe, fast weiße, immer makellos gebügelt, und seine schlanke Gestalt und seine vornehme Art zu sprechen flößten jedermann Respekt ein. In diese Würde und Eleganz hatte sich Jesusita vor mehr als fünfzig Jahren verliebt, als sie in Honda in die Ober schule ging. Und das war Don Rafael noch immer: ein stattlicher karibischer Gentleman, auch wenn sein Gedächtnis zerrüttet war.
Eine Stunde hinter Puerto Berrío hielt der Zug erneut. Der Regen hatte aufge hört, und die Sonne brachte die nassen Weideflächen zum Glitzern. »Wahrscheinlich arbeiten sie an den Gleisen«, sagte Jesusita, die ihren Mann kannte. Denn Don Rafael sagte dann, was er bei dieser Gelegenheit auf jeder Reise sagte, nämlich, daß nur ein Schwarzer fähig sei, bei dieser Sonnenglut die Schienen geradezubiegen. Dem stimmte sie zu.
»Schau mal, diese Rücken«, sagte sie.
Der kleine Trupp arbeitete vor der Lokomotive. Nicht alle Arbeiter waren schwarz, zwei der vier Männer waren Weiße, mit gelblicher Haut, Bierbäuchen und kräftigen Armen, aber die beiden, die gerade die Gleishämmer schwangen, waren Schwarze. Jesusita sagte: »Was für Prachtkörper die Negerbürschchen haben!« Ein bemerkenswerter Ausdruck von jemandem wie ihr, einer kleinen, zierlichen, trotz ihrer Jahre anmutigen Person, für die beiden Kolosse, zu denen nichts weniger paßte als eine solche Verniedlichung. Entlang der Gleise erstreckte sich ein Weidezaun mit MatarratónBäumen. Das Gras duftete.
Sie dösten in der feuchten Hitze vor sich hin, während die Streckenarbeiter in der Sonne rhythmisch auf die Schienen schlugen. Als sie fertig waren, traten die vier zur Seite und standen mit schweißglänzenden Körpern da, während der Zug sich mit leise quietschenden Rädern langsam in Bewegung setzte. Der Fahrtwind brachte Jesusita Kühlung, und sie schloß wieder die Augen. Doch hinter der scheinbaren Behaglichkeit quälte sie der Gedanke an die unver meidliche Auseinandersetzung mit der Schwiegermutter und die Schwierig keiten, die sich der Rückreise entgegenstellen könnten. Jesusita wollte auf gar keinen Fall an die Möglichkeit denken, ihren Mann Gott zurückzugeben, selbst wenn Don Rafael völlig unansprechbar werden und zu Hause kein Wort mehr sagen würde.
Als Flor mit Tamales und einem Kasten Limonade ins Haus kam, hatte der Zug schon eine ganze Weile im Bahnhof von Barranca gestanden, dessen intensive schwüle Hitze sprichwörtlich ist. Flor und Emma boten ihnen Tamales an, die Jesusita bezahlte und durchs Fenster entgegennahm.
»Sind sie auch wirklich frisch, ihr beiden?«
»Wenn sie sauer sind, bekommen Sie Ihr Geld zurück«, sagten die Verkäufe rinnen und kicherten.
»Aha! Ihr wollt uns also verhungern lassen, was?« sagte Jesusita, und die beiden lachten wieder.
»Sehr gut, der Tamal«, sagte nach einer Weile Don Rafael, der ungewöhnlich gesprächig war. Das Reisen schien ihm ein Stück Jugend zurückzubringen. »Es ist nicht ganz so heiß wie sonst, aber die Schwüle ist erdrückend“, sagte Jesuita. „Willst du Chili-Soße?“
Er wollte. Jesusita streckte den Kopf aus dem Fenster, um die Verkäuferinnen zu rufen, die ihr ein schmales Fläschchen reichten, aus dem Don Rafael ein paar Spritzer der feurigroten Soße auf seinen Tamal schüttelte. Emma und Flor hüpften unter ein und demselben gelben Schirm quietschvergnügt den Bahnsteig auf und ab. »Als ob es zwei Leute bräuchte, um ein paar Tamales zu verkaufen!« dachte Jesusita und schüttelte den Kopf. »Die sind doch viel zu groß für solche Albernheiten. Flor hat Kinder, die auf die Universität gehen, kaum zu glauben, und mit ihrer Figur sollte sie sowieso nicht so herumspringen.« Don Rafael hingegen machte es Spaß, den beiden jungen Verkäuferinnen zuzuschauen, wie sie – die eine rund, die andere wie ein Strich – ihre Arbeit auf dem Bahnsteig in ein Spiel verwandelten.
Der Zug fuhr wieder an. Am Abend kam Gonzalo, der jüngste Sohn, mit Nachschub für die Verkäuferinnen – Fleischtaschen und Maisfladen mit Käse – und um seine Rolle im Zug zu übernehmen. Er zog die Schaffneruniform an und ging durch den Wagen, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Mit seinem einnehmenden Wesen, immer lächelnd, zuvorkommend und hilfsbereit, war er wie für diesen Job geschaffen. Als die Uniform geschneidert werden sollte, wußte keiner, wie die Schaffner früher gekleidet waren, denn es gab schon lange keine Eisenbahnen mehr. Am Ende entschieden sie sich für einen dun kelblauen Anzug, eine Mütze, auf die eine Tochter in weißen Buchstaben FCN stickte, und eine rote Krawatte. Rot war Gonzalos Lieblingsfarbe für Kra watten. Als Don Rafael ihn das erste Mal sah, schaute er seinen Sohn verdutzt an. Doch er sagte nichts und nahm es wohl hin, daß sich die Uniformen der Schaffner geändert hatten.
Inzwischen waren weitere Kinder und mehrere Enkel gekommen, und im Eßzimmer wurde es laut. Don Rafael hatte die Preise im Zugrestaurant immer als skandalös empfunden und darum auf seinen Geschäftsreisen fast nie dort gegessen. Kurz nach ihrer Hochzeit, als er noch bei Singer arbeitete und Jesu sita ihn zum ersten Mal auf einer Reise begleitete, hatte er sie, um sie zu beeindrucken, in den Speisewagen geführt. Sie war über die Preise entsetzt, und Don Rafael mußte sie darauf aufmerksam machen, daß ihr das Mittag essen nicht bekommen würde, wenn sie nur daran dachte, was es kostete.
Der Lärm im Speisewagen dauerte an, und Jesusita sagte, die dürften nicht geöffnet haben, wenn unsereins schlafen will. Trotzdem schliefen beide dann doch ein. Als sie erwachten, sahen sie das große Rund des Vollmonds, das sich feierlich über der Kordillere erhob, hinter der Gartenmauer, zwischen zwei Mangobäumen. »Die gute Emma!« sagte Jesusita zu sich selbst. »Ich dachte schon, sie würde es vor lauter Tratschen im Eßzimmer vergessen.« Der Mond war aus Aluminiumfolie, und Emma ließ ihn aufgehen, indem sie ihn mit einer Bambusstange hochhob und mit einer Taschenlampe anleuchtete. Auf einer der Reisen war der echte Mond über den Mangobäumen aufgegangen, und Jesusita war enttäuscht gewesen, weil sein Wunder dem Wunder des Taschenlampenmondes die Show stahl. Neben dem richtigen Mond sah die beleuchtete Scheibe wie ein Lampion aus.
»Jetzt kommt Chiriguaná, nicht wahr?«
»Jetzt kommt Gamarra«, sagte Don Rafael und zählte alle Stationen zwischen La Dorada und Ciénaga auf, und als Gamarra und Chiriguaná an die Reihe kamen, hob er die Stimme, wie um seine Frau zu ermahnen, sich ein für alle Mal die richtige Reihenfolge zu merken. Jesusita hatte natürlich genau gewußt, wie der nächste Bahnhof hieß, denn Emma stellte das Schild mit dem jeweiligen Ortsnamen immer so auf, daß es für ihre Mutter gut sichtbar war, aber sie wollte Don Rafael die Gelegenheit geben, mit seiner Antwort recht zu behalten.
In Gamarra hielt der Zug eine Stunde lang. »Was ist denn los, Señor?« fragte Jesusita den Schaffner, und Gonzalo sagte, die Lokomotive habe schon seit Villeta, also lange bevor die beiden eingestiegen waren, mit einer technischen Störung zu kämpfen, und man müsse eben Geduld haben auf einer so langen Reise. »Das Gute beim Reisen ist, daß man nie weiß, was einen alles erwartet«, sagte sie, entzückt von der Schönheit des Mondes über dem Kamm der Kordillere.
»Am besten, Sie schlafen eine Weile, dann wird Ihnen die Reise nicht zu lang, und Sie spüren die Hitze nicht«, sagte Gonzalo, »vor allem der ältere Herr.« Jesusita glaubte in seinen Worten einen leichten Vorwurf zu hören, als ob sie für diese Reisen verantwortlich wäre, die Don Rafael in den Augen der Familie aus seinem geruhsamen Lebensrhythmus rissen. »Bestimmt rede ich mir das nur ein«, dachte sie. Doch dann kam sie zu einem anderen Schluß: »Sie sind schon ungerecht, die Kinder.«
Von all den heißen Orten am Mittellauf des Magdalena ist Gamarra der heißeste, weil hier fast nie ein Wind weht. Jesusita fächelte sich Luft zu, und Don Rafael befeuchtete sein langes, schmales Gesicht mit einem Taschentuch, das so weiß war wie Emmas Mond über der Gartenmauer. »Eine Reise ohne Hitze ist keine Reise«, dachte Jesusita, als würde sie auf Gonzalos Bemerkung antworten. »Dann kann man ja gleich zu Hause bleiben.«
»Länger als eine halbe Stunde wird es bestimmt nicht mehr dauern«, sagte Don Rafael. In der rechten Hemdtasche hatte er ein weiteres Taschentuch, auch mit Kölnisch Wasser getränkt und genauso weiß wie das erste. Damit erfrischte er sein Gesicht, seine glattrasierten Wangen und die Stirn, und ab und zu hielt er es sich an die Nase und atmete den herben Duft ein, als wolle er auch seinen umnebelten Geist beleben. Jesusita schaute Emma an und gab ihr mit den Augen einen Wink, die Ventilatoren anzustellen.
Aus dem Transistorradio eines Fahrgasts im hinteren Teil des Waggons erklang das Lied »Los Sabanales«, gespielt von den Corraleros de Majagual, einer in dieser Gegend sehr bekannten Band. Don Rafael mochte die Vallenato-Musik nicht, sie war ihm zu primitiv, und wenn man ihn auf diese Gruppe angesprochen hätte, hätte er gesagt, natürlich kenne er Majagual, er sei ja oft dort gewesen, aber diesen plärrenden Viehhirten sei er nie begegnet. Jesusita hingegen, die trotz ihrer siebzig Jahre immer noch gern tanzte, bewegte kaum merklich ihre angewinkelten Arme und die Schultern zum Rhythmus der Musik.
Von Gamarra an, oder schon vor Gamarra, waren in einem fort Vallenato- Melodien zu hören, als wollten die fremden Klänge ihnen einhämmern, daß sie nun in einer anderen Welt waren.
Hier sitze ich
Und singe von meiner Savanne
Denn alles, woran ich mich erinnere,
Ist auf diesen Hügeln geblieben.
Das hätte man von Don Rafael auch sagen können, daß ihm nur die Erinnerungen an früher geblieben waren, an die Küste, dachte Jesusita. Alles andere hatte er verloren oder war dabei, es zu verlieren. Was für ein Jammer. Ein schönes Lied, wirklich schön, dachte sie. Don Rafael war eingeschlafen, und das bedeutete, daß die Reise länger dauern würde, als Jesusita und Emma vorgesehen hatten. Später in der Nacht öffnete er die Augen und fragte, wo sie seien. Da nahmen die Ventilatoren ihre Arbeit wieder auf, und die Reise ging weiter.
In Chiriguaná hatte es gerade geregnet, darum war es außergewöhnlich frisch für diesen sonst so heißen Ort. Der Zug hielt, und bevor Emma hinter die Gartenmauer ging, um die Position des Mondes ein wenig zu verändern, stellte sie die Ventilatoren auf die niedrigste Stufe. Es waren zwei hellblaue Geräte der Marke Sankey, die für die Eisenbahnfahrten immer in einem bestimmten Abstand zur Waggontür aufgestellt wurden.
»Es ist kühl geworden, Frau«, sagte Don Rafael, und sie half ihm, sich den Pullover überzuziehen.
In Chiriguaná stiegen zwei Männer zu, die er offenbar kannte, die Jesusita aber nicht zuordnen konnte. Nach der förmlichen Art zu urteilen, in der er mit ihnen sprach, standen sie ihm nicht sehr nahe, vielleicht waren es Bekannte der Familie, die er lange nicht gesehen hatte. Don Rafael war anzumerken, daß er die beiden rasch loswerden wollte, obwohl er immer höflich blieb. Als sie endlich gegangen waren, verkniff es sich Jesusita, ihn nach den Männern zu fragen, denn sie hatte gemerkt, daß ihm die Begegnung unangenehm gewesen war. Auf der ganzen Strecke nach Aracataca ging ihr die Sache nicht aus dem Kopf. Etwas sagte ihr, daß die beiden vielleicht mit Don Rafaels Mutter zu tun hatten, aber zuerst traute sie sich nicht zu fragen, und dann vergaß sie es.
Sie waren jetzt zwanzig Stunden unterwegs. Mit zunehmender Müdigkeit verloren die Bahnhöfe für Jesusita ihren Reiz: einer war wie der andere. Den Verkäufern sah man an, daß sie übernächtigt waren, und die Käsestückchen in den Bananenblättern wurden säuerlich. Nur der Mond schien weiter in voller Pracht. Jesusita kannte diese Müdigkeit, die sich tief in der Nacht einstellt und auf einer langen Reise jeden überwältigt.
Don Rafael war eingeschlafen und sprach im Schlaf, wie Jesusita vermutete, mit den beiden Männern, die ihn vor ein paar Stunden im Zug begrüßt hatten. »Ja, ja, hm. Gut, ja, gut, aber vorher muß ich sie fragen«, sagte er entschieden, als sei das sein letztes Wort, bevor er still weiterschlief.
Jesusita schaute weg, zur Decke hinauf, um sich zu beruhigen.
»Da ist noch was, Ángel, warte einen Moment!« rief Don Rafael plötzlich und öffnete die Augen, als die beiden Männer offenbar schon an der Tür zum nächsten Waggon waren. Da dämmerte es Jesusita, daß es sich bei dem einen vielleicht um Ángel Oñate handelte, einen Schulfreund von Don Rafael, den er oft erwähnt hatte, weil er als junger Mann gestorben war, an Kälte und an Heimweh, als er in Tunja Jura studierte.
»Und was, wenn sie nein sagt?«
Der Zug stoppte abrupt mitten auf der Strecke, und die Schaffnerin kam und sagte, eine Kuh blockiere mit ihrem Kalb die Gleise. Gonzalos Uniform war Emma etwas zu groß, und Jesusita dachte, daß sie mit den aufgekrempelten Hosenbeinen wie ein Kind aussah, das sich als Erwachsener verkleidet hat. Die Kuh wurde vom Bahndamm getrieben, und sobald sich der Zug in Bewegung setzte, sprangen die Ventilatoren wieder an.
Als auf beiden Seiten die Bananenpflanzungen begannen, weckten die zunehmende Geschwindigkeit und die Üppigkeit der Welt draußen Jesusitas Lebensgeister. Natürlich würde sie nein sagen! Was dachten sich diese Narren eigentlich? Weder Ángel Oñate noch irgendein anderer Engel oder sonst ein Wesen würde es mit ihr aufnehmen können!
Sie passierten den Bahnhof von Aracataca in jenem unbestimmten Moment, da es nicht mehr Nacht und noch nicht Tag ist, oder beides, in dem alles eins wird, Tag und Nacht, Leben und Tod, Wachen und Träumen. Der Zug hielt nicht, sondern drosselte nur die Geschwindigkeit, denn um diese Uhrzeit wollte niemand ankommen oder ließ die letzten Straßen des Ortes hinter sich, nahm wieder Fahrt auf, und allmählich erwachte der Tag, mit Reihern, Wolken und Schwalben.
Emma hatte im hinteren Teil des Wagens Platz genommen und war jetzt der alleinreisende junge Mann, der regelmäßig, aber in kleinen Schlucken Aguardiente trinkt, während die Welt am Fenster vorbeizieht. Ein anderer Reisender schaltete sein Transistorradio ein und begrüßte den Tag mit einem rhythmischen Vallenato.
Das Lied handelte davon, daß die vergangene Zeit nicht wiederkehrt und daß von dem, was man geliebt hat, nur die Erinnerung bleibt. Und nicht einmal die Erinnerung, dachte Jesusita. Alle Lieder hatten irgendwie mit Don Rafael zu tun. Doch dann empörte sich etwas in ihr. Wer sagt denn, daß er keine Erinnerungen hat, he? protestierte sie aufgebracht und fast in Panik, als hätte jemand ihre Gedanken gelesen und könnte aus diesem Moment der Schwäche und Unachtsamkeit seinen Vorteil ziehen. An das, was vor langer Zeit geschehen ist, erinnert er sich doch sehr genau! Und selbst wenn er keine Erinnerungen hätte, was sagt ihr dazu, daß er noch reist oder sich seine Fischsuppe schmecken läßt, auch wenn er nur wenig ißt, weil er einen Vogelmagen hat? Wer will behaupten, daß das nichts ist? Muß er sich vielleicht um eine Stelle bewerben? Nein. Er hat sein Arbeitsleben hinter sich und hat es gut gemacht und gutes Geld verdient. Wenn es sich einer leisten kann, das Gedächtnis zu verlieren, dann er. Dabei macht Don Rafa immer noch eine gute Figur, auch ohne Gedächtnis, dachte Jesusita, er ist nett und höflich zu den Menschen, auch wenn er sie nicht mehr erkennt.
Diese Auseinandersetzung mußte sie jedes Jahr am Ende ihres Besuchs mit ihrer Schwiegermutter führen, die in ihrer arroganten Art darauf beharrte, daß es sich nicht lohne, auf der Welt zu bleiben, wenn man sich nicht mehr erinnere. Die hat gut reden, nicht wahr? Sie, die nicht mehr auf der Welt ist, dachte Jesusita, und die nichts mehr zu verlieren hat. Aber Don Rafael war noch am Leben und für manche Dinge sehr empfänglich. Mit welchem Vergnügen er dem Gesang der Trupiale lauschte! Und ihre Schwiegermutter, wie kam die überhaupt dazu, sich in ihre Ehe einzumischen, bitte sehr! Aber so war sie immer gewesen. Eine tyrannische Frau.
»Kommt jetzt Fundación, Rafa?« fragte sie ihren Mann, der gerade aufgewacht war.
»An Fundación sind wir längst vorbei, Frau!«
Wenn sich jemand an all diese Orte erinnert, dann interessiert ihn die Welt doch noch, oder? ereiferte sich Jesusita. Warum sollte er sie denn verlassen, solange er sie genießt? Don Rafael zählte die Stationen zwischen Gamarra und Ciénaga auf und betonte die Ortsnamen, als er zu Fundación, Aracataca und Sevilla kam. Jesusita lächelte. Es machte sie verlegen, in ihrem Alter das Wort Liebe zu denken. »Wie stark einen das gefangenhält!« dachte sie vielmehr. »Und um wieviel Uhr waren wir eigentlich in Fundación? Ich hab’s gar nicht gemerkt.«
Es war schon hell, als sich vor Jesusita die Ciénaga Grande, die Große Lagune, in ihrer ganzen Schönheit auftat. Die auf Pfählen in den See gesetzten Häuser schwebten im Nebel, und die Ciénaga hatte sich in Dampf und grüne Schatten aufgelöst. Das Bild erinnerte Jesusita an das »Haus in der Luft«, von dem in einem dieser Vallenato-Lieder die Rede war, die seit einiger Zeit ohne Unterlaß aus dem Transistorradio schallten. Jesusita hätte Emma oder Gonzalo bitten können, es auszuschalten, besser gesagt: Sie hätte sich beim Zugpersonal über die Musik beschweren können, die sie nicht bestellt hatte – doch in Wirklichkeit hörte sie sie gern und hätte am liebsten mitgesungen oder im Gang dazu getanzt, und sei es nur ein paar Sekunden lang.
Am Bahnhof von Sevilla war Emma wieder auf dem Bahnsteig. Sie sahen, wie sie am Zug entlanglief und gekochte Eier, Brötchen und Costeño-Käse verkaufte, den Jesusita liebte. Manche dieser regionalen Spezialitäten genoß sie sogar mehr als Don Rafael. Die Kola Román, zum Beispiel, die süß wie Sirup ist – wenn sie die kalt trank, eiskalt, und dazu den sehr salzigen und trockenen Costeño-Käse und ein rundes, süßliches Brötchen aß, wie es sie nur an der Küste gibt, war das für sie das Höchste. Das Rubinrot des Getränks war wunderschön und leuchtete wie eine Neonreklame. Don Rafael dagegen verabscheute dieses Zuckerwasser, und früher, als er noch mehr redete, sagte er immer, dieses pappige Zeug, das sie Brötchen nennen, habe mit Brot überhaupt nichts zu tun. Und wenn Jesusita der Gesang der Mariamulata-Vögel bezauberte, antwortete er, wie immer nicht unhöflich, aber etwas mürrisch: »Ach, diese Flatterviecher.«
Mariamulata- und Guanabó-Vögel waren die ganze Zeit in den Palmen zu hören, solange der Zug im Bahnhof stand. Wenn Jesusita ein Glücksgefühl empfand, wehte es wie ein Luftzug heran, unverhofft und leicht. Zwei oder drei Dinge mußten zusammenkommen, Palmen, frische Luft und Vögel, so wie jetzt, und da war es schon, das Glück. Aber genauso leicht verschwand es wieder. Eine ganze Weile hatte sie schon nicht mehr an Ángel Oñate und ihre Schwiegermutter gedacht, aber als jetzt ein Rütteln durch die Waggons ging und dann der Zug mit einem Ruck anfuhr, waren sie in ihren Gedanken wieder da. Wenn sie ihn holen, müssen sie mich auch mitnehmen, die Elenden, dachte sie mit solcher Intensität, daß auf einmal die Vögel nicht mehr zu hören waren, als habe ein ehrfurchtgebietendes oder heiliges Ereignis sie zum Schweigen gebracht. Da spürte sie eine kalte Angst im Bauch, denn das Jahr würde kommen – nicht dieses, da sollten sie sich bloß keine Hoffnungen machen, dachte sie, aber es würde unausweichlich kommen –, in dem es mit Don Rafaels Rückreise schwierig würde.
»Wie schön die Ciénaga Grande war!« sagte Jesusita, um sich abzulenken. »Aber Mädchen, die Ciénaga kann man vom Zug doch gar nicht sehn!« »Dann hab ich wohl geträumt«, sagte Jesusita. »Aber schön war sie auf jeden Fall. Ganz in Nebel gehüllt.«
Als sie endlich im Bahnhof von Ciénaga ausstiegen, waren Don Rafael die Strapazen der Reise anzusehen. Jesusita verzichtete darauf, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und sich im Bahnhof umzuschauen, dessen hohes Dach für Frische sorgte und der ihr wegen der Holzschnitzereien über den Fenstern besonders gut gefiel. Statt dessen gingen sie gleich zum Bus nach Barranquilla. Obwohl ihr alle Bahnhöfe gefielen, jeder auf seine Art, mochte sie den von Ciénaga am liebsten. Vor kurzem hatte sie irgendwo ein Foto des Gebäudes gesehen, doch wirkte es darauf etwas heruntergekommen und verlassen. Das hohe, mit Zinkblech gedeckte Dach war zwar zu sehen, aber das Gebäude sah nicht so aus, als habe es dort je Holzschnitzereien gegeben.
»Hier hast du sie jetzt, die Ciénaga Grande«, sagte Don Rafael auf der Fahrt im Bus, der sich mit Böen von Meeresluft füllte. Auf der einen Seite die Pracht der Mangroven der Lagune, auf der anderen die Herrlichkeit des Meeres. »Schön, nicht?« sagte Jesusita.
»Was? Ach ja«, sagte Don Rafael zerstreut, ganz ein Mann der Küste, der keine romantischen Gefühle mit dem Meer verbindet. Tatsächlich schien ihn die Ciénaga mehr zu interessieren, vielleicht weil mit ihr die Farben und Gerüche seiner Jugend zurückkamen, die Angelausflüge mit seinen Brüdern.
In Barranquilla wurden sie von Mercedes, Don Rafaels jüngster Schwester, mit einem Fischeintopf in ihrem hübschen Haus empfangen, das modern war, aber schattig mit seinen halbgeschlossenen Rollos und blühenden Tulpenbäumen im Garten. Mercedes war eine leidenschaftliche Köchin. Sie gehörte zu jenen, die nur für fünfzehn oder mehr Personen kochen können, und für so viele kochte sie, auch wenn nur zwei Gäste geladen waren. Zum Glück kamen fast immer mehr als zehn, denn die Familie war groß und hatte viele Freunde, die mit der Zeit auch Teil der Familie geworden waren. Mercedes war eine wohlbeleibte Frau mit einem schönen Gesicht und leuchtenden Augen und dirigierte von ihrem Stuhl im Wohnzimmer drei Köchinnen und einen jungen Mann, der als Küchengehilfe und Bote arbeitete.
Als Jesusita von Mercedes umarmt wurde, fühlte sie sich wie in Abrahams Schoß. Sie wurde von der Körperfülle ihrer Schwägerin – Gott hab’ sie selig – und der menschlichen Wärme, die sie ausstrahlte, fast erstickt und lebte auf im Bewußtsein, daß Mercedes sie genauso innig liebte, wie deren Mutter sie verachtete. Daß die mollige Mercedes und der schmale Don Rafael Geschwister waren und sich sogar ähnlich sahen, wunderte sie ebenso wie die große Ähnlichkeit zwischen der dicken Flor und ihrem hageren, schlaksigen Vater.
Die beiden Frauen schauten zu, wie er langsam die Treppe hinaufstieg, und tauschten mitleidsvolle Blicke, denn sie wußten, daß er in das Zimmer ging, das seine Mutter die letzten Jahre bewohnt hatte und das Emma mit großer Sorgfalt hergerichtet hatte, damit sie in Ruhe miteinander reden konnten. Danach würden die anderen Geschwister und viele Neffen und Nichten eintreffen, und bis spät in die Nacht würde Musik zu hören sein.
Später, im Bett, wurde Jesusita von jenem Schaukeln in den Schlaf gewiegt, das man nach einer langen Fahrt mit dem Zug oder dem Schiff noch eine gewisse Zeit zu spüren glaubt; sie hatte sogar, wenn auch nur noch schwach, den ätzenden Dieselgeruch in der Nase. Bevor sie einschlief, dachte sie, daß Flor Mercedes’ Rolle dieses Jahr wirklich glänzend gespielt hatte. So gut war sie gewesen, daß Jesusita fast vergessen hatte, daß Don Rafaels jüngste Schwester, die zeit ihres Lebens Übergewicht hatte, vor ein paar Jahren krank geworden und so stark abgemagert war, daß man sie kaum wiedererkannte, bis sie schließlich zu leicht fürs Leben wurde.
In Barranquilla waren sie an einem Freitag angekommen, und am Montag wollten sie nach Honda zurückfahren. Sie nahmen aber nicht den Zug, wie ursprünglich geplant, sondern machten die Rückreise mit dem Flugzeug, denn weder Emma noch Don Rafael hatten noch die Kraft für eine so lange Eisenbahnfahrt. Jesusita dagegen hätte, wäre es nur um sie gegangen, für die Rückreise gern wieder den Zug genommen.
Während sie unter sich, winzig klein, Hausdächer und Kühe vorbeiziehen sah und Wolken wie Wattebäusche, die zwischen dem Grün der Berge hingen, dachte Jesusita, wie schwierig es dieses Jahr gewesen war, Don Rafael von seiner Mutter loszueisen, die ihn unbedingt dabehalten wollte und noch unterstützt wurde von diesem Kerl, Ángel Oñate, der sich frech in die Diskussion eingemischt hatte und nicht müde wurde, auf Don Rafael einzureden, er solle bleiben.
Jesusita bewunderte den Schneegipfel, der am Flugzeugfenster vorbeizog. Eine schöne Überraschung, die Emma sich ausgedacht hatte! Großartig. Als das Glitzern des Schnees vorbei war, kehrten Jesusitas Gedanken zu der Auseinandersetzung mit ihrer herrischen Schwiegermutter zurück. Nicht daß der Streit sie niedergeschmettert hätte, nein, wütend war sie geworden, denn ihr war klar, daß seine Mutter sich letzten Endes durchsetzen würde und sie, Jesusita, nachgeben müßte. Und wenn sie daran dachte, daß sie ihn ihr diesmal beinahe weggenommen hätten, kochte sie vor Wut, denn sie taten das aus reiner Willkür, ohne überzeugende Argumente gegen die guten Gründe, die sie angeführt hatte.
Was bildeten sich die beiden eigentlich ein! Warum wollten sie nicht kapieren, daß sie nicht nach Belieben kriegen konnten, was sie wollten, nein, sondern erst wenn sie, Jesusita, den Moment für gekommen hielt. Während der Auseinandersetzung mit ihrer Schwiegermutter und diesem Kerl, Ángel Oñate, hatte sie geweint, das schon, aber sie hatte ihre Argumente mit Bestimmtheit und ohne die Stimme zu erheben vorgebracht. Nur aus dem, was Don Rafael sagte, hatte Jesusita heraushören können, was die beiden anderen verlangten, aber trotz allem machte sie ihnen unmißverständlich und ein für allemal klar, daß sie, seit über fünfzig Jahren seine Frau, es als erste merken würde, wenn Don Rafael sich nicht mehr an den Sonnenuntergängen freute, am Gesang der Trupiale, oder an seinen Tropenhemden aus feinem Leinen, oder an den zwei makellos geplätteten Taschentüchern und ihrem frischen Duft.
Dann, und erst dann, und nicht, wenn es zwei Dahergelaufenen einfiel, willkürlich zu entscheiden, daß die Stunde gekommen sei, würde sie – und wenn es ihr das Herz bräche – zulassen, daß Don Rafael die Reise mit dem Flugzeug, der Eisenbahn oder sonstwas absagte und nicht mehr zurückkehrte.
Aus dem Spanischen von Rainer Schultze-Kraft und Peter Schultze-Kraft
SINN UND FORM 5/2013, S. 657-671