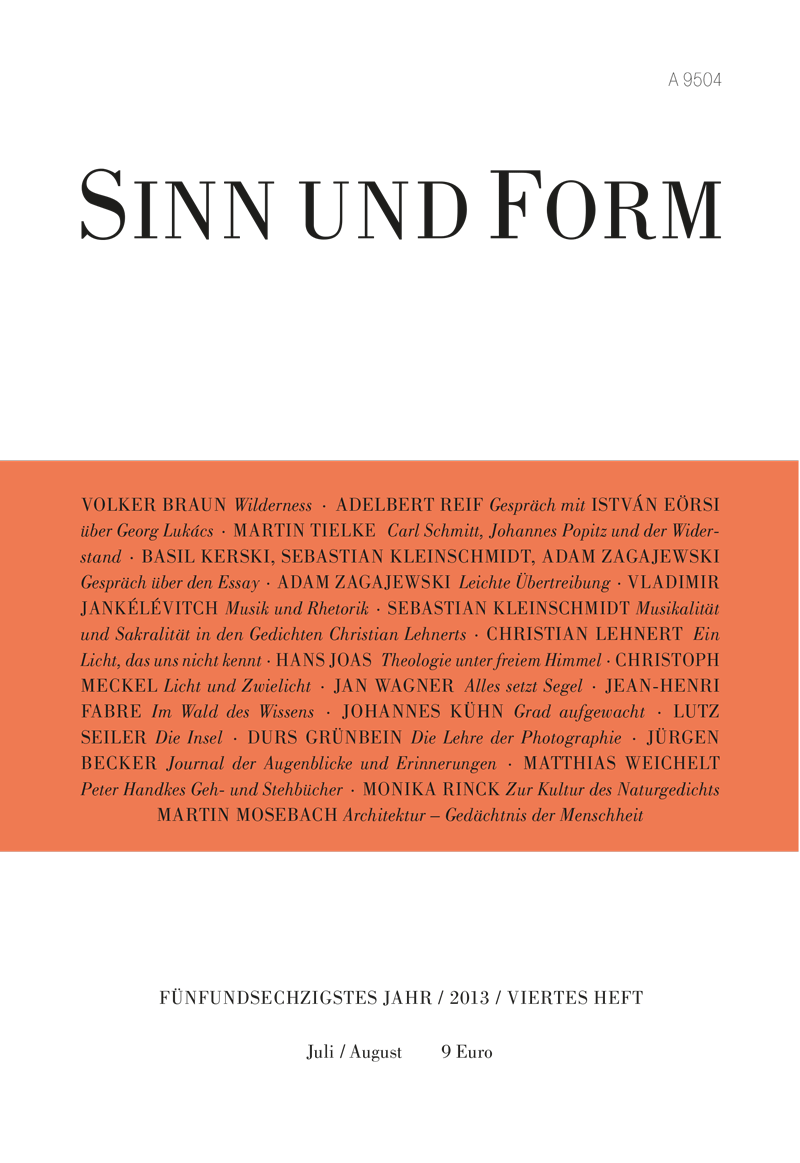
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-11-9
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 4/2013
Weichelt, Matthias
Für den, den's angeht
Zu Peter Handkes Steh- und Gehbüchern
Man kann sich unschwer freundlichere Einladungen zur Lektüre vorstellen: »(Für den, den’s angeht)« steht über Peter Handkes erstem, die Jahre 1975 bis 1977 umfassenden Journal »Das Gewicht der Welt«. Und dieses Motto, heißt es 1998 in »Am Felsfenster morgens«, gelte auch für alle darauffolgenden Aufzeichnungsbücher. Wer eines davon aufschlägt, weiß also nicht, ob sich die spröde Widmung auch auf ihn bezieht, ob das Angebot, das hier gemacht wird, auch eins für ihn ist. Herausfinden kann man es nur, indem man es annimmt. Daß sogenannte »Geschäfte für den, den es angeht« ohnehin juristische Ausnahmen vom Offenkundigkeitsprinzip sind, dürfte Handke, der in den sechziger Jahren Rechtwissenschaften in Graz studierte, jedenfalls gewußt haben. Sie kommen auch dann zustande, wenn bei alltäglichen Besorgungen, beim Kauf einer Semmel oder einer Zeitung, jemand in fremdem Auftrag auftritt, einem Freund oder Nachbarn eine Besorgung abnimmt. Der Vertrag bindet nicht den, der die Ware als erster erhält, sondern den, für den sie bestimmt ist, den, den es angeht. Und der wird sich schon finden.
Um die einfachen und alltäglichen Dinge, um das Unscheinbare und Unbemerkte geht es auch im »Gewicht der Welt«. Um die ihr Sandwich kauende Verkäuferin in einem leeren Laden. Um den alten Mann im Restaurant, mit seiner Weinflasche und seinem Glas. Um den Geldschein auf dem Zahlteller und die vom Nachbartisch herüberblickende Frau. Um die nach eingetrocknetem Schneewasser riechende Skimütze des Kindes. Um das Zuziehen eines Reißverschlusses und das Röhren der Heizung im Keller. Und um die Frage, warum solch spontan festgehaltene Reportagen eines »Einzel-Bewußtseins« andere überhaupt etwas angehen sollen. Daß ihre Veröffentlichung auch als Indiskretion oder Anmaßung verstanden werden kann, war dem Autor bewußt. Entsprechende Vorwürfe suchte er mit der Versicherung zu entkräften, daß »dieses Bewußtsein (ich) auf etwas aus ist, pathetisch gesagt: sich unablässig durchdringen will«. Sich selbst zu erkennen ist hier nicht Wahlspruch der Selbstbespiegelung, sondern Maxime eines Weltzugangs. Das Ich wird zum Medium, das sich Eindrücken, Empfindungen, Erlebnissen wie einer Röntgenbestrahlung aussetzt, die sein Inneres abbildet und beschreibbar macht. Die ursprünglich als bloßes Material für größere literarische Arbeiten vorgesehenen und daraufhin ausgewählten Notate hatten sich im Zuge der Niederschrift immer mehr verselbständigt, verwandelt in zweckfreie Aufzeichnungen zweckfreier Wahrnehmungen – eine Lösung aus vorgegebenen Formen und Mustern, eine Eröffnung neuer literarischer Möglichkeiten, durch die das Sprachliche, die Sprache selbst zum Gegenstand des Schreibens wird: »Was auch immer ich erlebte, erschien in diesem ›Augenblick der Sprache‹ von jeder Privatheit befreit und allgemein.«
Eine solche Abwendung vom Privaten und Persönlichen ist nicht jedem Leser geheuer. Den Reiz veröffentlichter Tagebücher, Briefwechsel, Journale findet man gemeinhin ja gerade in den darin enthaltenen Beichten und Bußen, den endlich offenbarten Geheimnissen, den schließlich abgelegten Geständnissen. Was einer nur für sich oder nahe Freunde aufschreibt, wird doch einen unverstellten Blick auf sein Wesen, auf die versteckte Buchführung seines Lebens freigeben. Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein. Wer nach derlei Vertraulichkeiten sucht, wird in der Mehrzahl der Journaux intimes reich belohnt. Die meisten Tagebuchschreiber, notiert Carl Schmitt 1948 in seinem »Glossarium «, kämen ihm vor »wie Kinder, die an ihren Fingern saugen und an allem saugen, was sie in ihre Finger bekommen«. Unverstellt und authentisch soll die Selbstbeschäftigung sein, eine leicht zu entschlüsselnde, von kindlicher Offenherzigkeit geprägte Botschaft an die Mit- und Nachwelt. Auch der Journalist André Müller, der mit Handke mehrere lange Interviews führte, ließ sich von der inhaltlichen Komposition und literarischen Absicht des »Gewichts der Welt« nicht irritieren und glaubte, aus einzelnen Einträgen auf die Gemütsverfassung des Autors an diesem oder jenem Tag schließen zu können: »Ein anderes Mal, so schreiben Sie, waren Sie kurz davor, den verachtetsten aller Menschen um Hilfe zu bitten.« Seinen Freund Hermann Lenz mußte Handke wiederum in einem Brief beruhigen, daß nur zwei Gesten von dessen Frau um dieser Gesten willen im Buch beschrieben seien, nicht die Person selbst: »Im Journal kommt sie nicht vor – es wäre auch eine Anmaßung von mir.« Die Wahrnehmung und Schilderung solcher für sich stehenden und über sich hinausweisenden Gesten ist das Anliegen dieser mal eine halbe Seite, mal einen Satz langen Eintragungen, nicht die Protokollierung von Begegnungen und Erlebnissen. Über Freundschaften, Feindschaften und Liebesangelegenheiten erfährt man dabei fast nichts.
Über sich »persönlich« habe er ohnehin nie etwas sagen können, schreibt Handke später in »Gestern unterwegs«, er lebe von dem, was die anderen nicht von ihm wissen. Auch an den Tagebüchern Kafkas interessierten ihn nicht mehr die Klagen und Selbstbezichtigungen, »nur noch seine Beschreibungen«. Die Hinwendung zum immer achtsameren Hören und Schauen, zur sorgfältigen, manchmal auch nachträglichen Berichterstattung des Tages schlägt sich insbesondere in den auf das »Gewicht der Welt« folgenden Aufzeichnungsbüchern nieder, bei denen die Bezeichnung Journal im Titel entfällt. Was dafür aus den überallhin mitgeführten, nach Hosentaschentauglichkeit ausgewählten »Geh und Stehheften« übernommen wird, muß dem Anspruch auf Anschaulichkeit und Klarheit genügen, nicht dem auf Lebensdarstellung oder Zeitgenossenschaft. Die gefundene sprachliche Form macht die Bedeutung des Notierten aus, daher kann alles nebeneinander stehen in der »Geschichte des Bleistifts« (1976–1980), den »Phantasien der Wiederholung« (1981/1982), in »Am Felsfenster morgens« (1982–1987) und »Gestern unterwegs« (1987–1990): Lebensgedanken ("Wie ein Liebespaar entsteht: Beide müssen, zusammen, etwas meistern«) und Leseeindrücke ("Keine Bücher für mich: die mit dem unangenehmen Beben des Gebildetseins«), Beschreibungen im Straßenstaub badender Spatzen und romanischer Kirchenskulpturen, Wortfindungen ("Verb für die Schönheit: ›nötigt (zum Bleiben)‹«) und Schreibvorgaben ("Ans Schreiben gehen: Füg der Stille etwas hinzu; bring etwas heim aus der Stille«), Landschaftsschilderungen und Gedanken über Wortgenauigkeit und Begeisterung, übers Gehen und Langsamwerden, über Müdigkeit, Wachsamkeit und den Wandel der Farben. Und immer wieder aus allem hervorleuchtende Poèmes en prose, helle Augenblicke der Sprache: »Das Wange-an-Wange von Stute und Fohlen, und dann das Hals-auf-Kruppe, und dann das Flanke-an-Flanke, und dann das Kopf-unterm-Hals, und endlich das Saugen, gebückt, des schon großen Kindes unter der Mutter: was für eine Liebe; und das alles unter dem Zwetschkenbaum«.
Der all diesen Wahrnehmungen vorausgehende Impuls, ihr eigentlicher Ursprung ist das Staunen. So wie man als Kind im Märchen das Fürchten lernte, kann man hier das Staunen lernen, kann sich die Augen öffnen lassen für den Reichtum, die Fülle der Welt und ihrer Erscheinungen ("auch nur auf dem kurzen Weg zu einer Metrostation: es war eine von stürzenden Körpern durchzuckte Ideallandschaft«). Das Sichtbare ist viel mannigfaltiger, viel umfassender als das Gesehene, das Gehörte nur ein kleiner Ausschnitt des Hörbaren. Jeder Satz in diesen Wirklichkeitserforschungsbüchern ist zugleich Aufforderung und Selbstermahnung, die Bilder des Tages, die regennassen Jacken der in den Bus steigenden Arbeiter, die schmutzigen Fensterscheiben im Bahnabteil, den alten Mann auf der Parkbank und den auf dem Tisch liegenden Bleistift als etwas so nie zuvor Gesehenes, erst zu Erschauendes und damit zu Erkennendes zu entdecken. Die Kunst, so wie sie hier verstanden wird, soll vom bloßen Anschein, vom Augenschein erlösen, soll den »phantastischen Augenblick« erzeugen, den Blick von Grund auf verändern. Wer dem folgt, fängt tatsächlich wieder an zu staunen, kann durchs Staunen gesund werden. Wer das Staunen verlernt hat, sieht keine Unterschiede und auch nichts Wesentliches mehr, »hört überhaupt auf zu sehen«, registriert nur noch, ohne Sinn für das, was vor ihm, über ihm, unter ihm und auch mit ihm geschieht: »Eine der innigsten Erscheinungen ist das Dahinziehen, Treiben und Kreisen der Blätter, Halme, Sporen, Vogelfedern, Grasspitzen in den länglichen, oft bootsförmigen Feldweglacken – eine Umschreibung der Stille«. Um an solchen Wirklichkeitsbildern nicht achtlos vorüberzugehen, um nicht blind für sie zu sein oder taub für die Stille, muß man schauen, bis einem »Nüstern wachsen«, muß man die Redewendung vom »Aus dem Staunen nicht herauskommen« als mögliches Lebensmotto akzeptieren – als Voraussetzung nicht nur des Dichterischen, sondern des Menschlichen überhaupt. Der wahre Mensch sei ganz Gehör, der wahre Dichter müsse die Stille erfahren haben und sich nach ihr sehnen. Und die sinnliche Erfahrung zum Fundament seines Schreibens machen, »das Besondere, die Spielart eines jeden einzelnen Dings erforschen – etwa, wie die Blätter eines Erdbeerhains sich anfühlen an der Innenseite des Unterarms, an der darüberstreichenden Handwurzel, am sie umgreifenden Handteller …«.
In der Offenheit für die Spielart jedes einzelnen Dings finden diese Notizen ihren ganz eigenen Zugang zur Wirklichkeit, die für Handke in der »bloßen geheimnisvollen Erscheinung« liegt, ja, in der Gleichsetzung von Geheimnis und Wirklichkeit. Wer dieses Geheimnis nicht verrät, sondern sich darauf einläßt, wird, das ist das große Versprechen dieser Aufzeichnungen, etwas zurückerhalten – nicht irgend etwas, sondern das, worauf es ankommt: »Ziel des Schreibens, des Lesens, des Lebens: ein Ding, eine Steintreppe, eine Glyzinie, eine Tür, wird von mir gesehen und zeigt sich erkenntlich: das Sich-Erkenntlich-Zeigen der Dinge«. Die Dinge werden erkannt in ihrer Form, ihrer Wesensart, ihrer Eigenheit – und sie erweisen sich dafür als dankbar, da sie nur durch die Betrachtung existieren, angewiesen sind auf einen Resonanzraum, ein Gegenüber, ohne das sie bloße Schemen bleiben, Geschöpfe einer Schattenwelt. Sprache bedeutet hier Erweckung der toten Natur. So wenig Goethe sich die Farben ohne das sie wahrnehmende menschliche Auge denken wollte, so unvorstellbar erscheint es Handke, »daß während der unermeßlichen Zeiträume ohne Menschen das Branden des Meeres von niemandem gehört worden sein soll«. Ein Klang, der im Nichts verhallt, ein Konzert ohne Publikum.
Fremd bleiben muß einer solchen Weltsicht alles schon Erstarrte und Genormte, alles allzu Berühmte und Bewunderte, die pittoresken Straßenszenen und kulissenhaften Landschaften, die beworbenen Sehenswürdigkeiten und zu Tode fotografierten Kunstwerke, die sich dem offenen Zugang, der freien Sinnzuschreibung verweigern. Denn eben darin besteht für Handke die »Aufgabe der Literatur: die noch nicht vom Sinn besetzten Orte ausfindig zu machen«. Ein Fahndungsauftrag, für den sich kaum ein tauglicheres Mittel denken läßt als die dem schweifenden Blick, der gelassenen Aufmerksamkeit, der berührungsfreundlichen Handfläche oder Fußsohle sich verdankenden, aus Anschauung oder Erinnerung gewonnenen Bewußtseinsreportagen. Das sie auslösende Staunen pulsiert noch in der Hülle der Sätze, schützt sie gleichsam davor, schablonenhaft und knöchern zu werden, dem Dargestellten Raum und Freiheit zu nehmen. Gute Literatur, hat Handke einmal gesagt, komme aus dem Erleben der Dinge und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis gegenüber, aus nichts anderem. Dafür aber muß der Vorgang des Aufnehmens und Erinnerns in die Beschreibung Eingang finden, muß das Erlebnis in den Eintragungen nachklingen, Wortstellung und Satzbau bestimmen. Ein kaum merklich vibrierender Grund, tragfähig und erschütterbar. Ein Boden, auf dem der Raum der Stille wachsen kann.
Und mit ihm der reine Gegenwartssinn, die beglückende Aufmerksamkeit für das, »was jetzt da ist (die Mancha-Disteln, hellgrau, im Wind neben den Bahngleisen)«. Das, was jetzt da ist – gewissermaßen Handkes Kurzformel für das epiphanische Aufscheinen der Wirklichkeit, das Zusammenkommen von Welt und Wahrnehmung, das nicht herbeigeführt, aber erwartet werden kann. Und zugleich Umschreibung des eigentlichen, des höchsten Lebensgefühls, des schieren In-der-Welt-Seins. Wer sich dieses Zustands bewußt wird, fügt sich ein in den Fluß der Dinge, spürt das Vorwärtsgleiten und Vorankommen, wird hineingehoben in den »Sattel der Gegenwart«. In diesem muß er sich halten, muß den Rhythmus annehmen, die Zügel anziehen und wieder lockerlassen, im Wechsel des Sich-Aussetzens und Sich-Einlassens. Was Handke sich in diesen Aufzeichnungen verbietet, eigentlich jeder Literatur verbieten will, ist das bloße Zuschauen und Beobachten, den Kommentar, das Protokoll, die voyeuristische Perspektive, die sich dem, womit sie sich beschäftigt, nicht aussetzt, die sich nicht einläßt auf das, was sie beschreibt: »Halt gegen die empörende Selbstgefälligkeit der Text- und Geschichten- und Romanhersteller immer den preisgebenden, sich preisgebenden, nicht anders könnenden, aber doch etwas könnenden und dabei doch nie nur sich bespiegelnden, sondern auch den anderen ihr Spiegelspiel ermöglichenden sogenannten ›Narziß‹ hoch!« Das einzige wirkliche Lebendigkeitsgefühl, heißt es in »Gestern unterwegs «, sei Teilnahme. Und ein Dichter kann für Handke nur sein, wer »sich auf ein Ding nach dem anderen einläßt« ("Am Felsfenster morgens«). In der Fähigkeit zur Teilnahme, in der »Kraft des Sich-Einlassens« liege die Befä-higung zum Schreiben, im immer wieder neuen Sich-Aussetzen strukturiere sich die Phantasie. Und aus der Nicht-Beobachtung erwächst das literarische Vermögen, wie angesichts eines Mitreisenden im »Gewicht der Welt«:
Das Gesicht des Mannes heute im Zug, wie es, indem ich, Beobachtungsfeindlicher, Beobachtungsloser, es ganz, ganz wegrücken ließ, mir allmählich ganz nahe kam und allmählich das allgemeine Gesicht wurde, wahnsinnig und lebendig, Mann und Frau zugleich verkörpernd, Gesicht einer Filmhandlung, deren Höhepunkt es gerade darstellte, tief und grenzenlos entrückt, während ich es entrückt betrachtete und doch gleichzeitig noch voll Mißtrauen war – und als ob der Mann das merkte, setzte er sich um und blickte in eine ganz andere Richtung (sein Gesicht war das eines großen Schauspielers gewesen, in Großaufnahme zu sehen auch in der Entfernung)
Wer diese Aufzeichnungsbücher liest, sitzt oft im Zug, in der Metro oder im Bus, manchmal auch im Flugzeug (in den Jahren von »Gestern unterwegs« hat Handke keinen festen Wohnsitz, reist durch Europa, Asien, Amerika). Vor allem aber zu Fuß ist dieser Autor unterwegs, auf Spaziergängen und Wanderungen, durch Großstädte, durch Vororte und im freien Gelände. Das Gehen bereitet den Weg zu den Dingen, setzt etwas in Gang, wird zum »Maschinisten der Seele«, zum Motor der Welterfahrung, hilft hinein in jenen »Sattel der Wirklichkeit« – und in den Tag, in die aus Dunkelheit und Nacht immer wieder entstehende, sich aus der Erstarrung lösende Welt, die ebenfalls eines Impulses, eines Auftakts bedarf, wie ein Schwungrad in Gang kommen muß: »Dieser vorbeifahrende Zug gab dem Tag seine erste große Bewegung. Die abgefallenen Blätter rochen aus dem Rinnstein. Noch war Morgenluft«. Und noch ist Zeit für das Langsamwerden, eine später verpaßte »Möglichkeit(sform)«. Noch kann man sich einlassen und einstimmen auf das, was Handke ganz unbefangen den schönen Tag nennt: »Schöne Tage, es gibt sie, sie sind nicht nur eine Redensart – die Schönheit von Himmel und Erde greift dann ein in das innerste Herz«. Dem geglückten Tag hat Handke, wie der Müdigkeit, der Jukebox und später dem Stillen Ort, auch einen seiner »Versuche« gewidmet. Was er damit meint, ist fern von aller Betulichkeit. Der schöne, der geglückte Tag ist keiner des behaglichen Müßiggangs, sondern eine Herausforderung, die angenommen und bestanden werden will, ein Kaleidoskop, dessen Farben und Muster es zu entschlüsseln gilt. Gelingt dies, werden die Formen erkennbar, benennbar, beschreibbar, bilden sich Linien, Gestalten, Existenzen. Der eigentliche Tagesanfang, schreibt Handke, vollziehe sich in diesem Werden der Formen – »das Sichzacken der Platanenblätter, die auf dem nassen Asphalt liegen – und das Übergehen der Formen auf mich, wodurch ich ersetzt und erweitert werde«. Für den Rest des Tages könne einem dann nichts mehr passieren …
Aber etwas passiert dann doch. Denn wer sich von den Formen des Tages ersetzen und erweitern lassen, wer dem Erlebten gerecht werden und es bestehen will, kann selbst nicht unverwandelt bleiben. Er muß eine Art elastischer Gegenkraft entwickeln, muß der Welt durchlässig standhalten, muß die Durchlässigkeit als »das Standhalten« begreifen. In »Gestern unterwegs« notiert Handke, sein Idealzustand vereine Freudigkeit, Stille, Durchlässigkeit und Schwäche. Und darin bestehe auch die Aufgabe von Büchern, von Gedichten, von Kunst überhaupt – dort, »wo nichts ist, Durchlässigkeit« zu schaffen, dem selbstgewissen Behaupten, Bestimmen, Beweisen entgegenzutreten, die »täglich gehörte, vor Vertrautheit nichtssagende, hilflose ›Du weißt schon, was ich meine‹-Sprache des Kommunikationszeitalters« zu ersetzen. All das traut Handke der Literatur zu. Ohnehin traut er (wie kaum ein anderer) ihr fast alles zu. Aus Stroh kann sie Gold spinnen, Leere und Stille und Schwäche in Sprache, in Schönheit verwandeln, das Nichterlebnis zum Erzählabenteuer machen. Sein großer Schatz, so Handke, das seien gerade die Ermangelungen, die ausgebliebenen Ereignisse der Kindheit – die Eintönigkeit des Tages, die ausgefüllt, die Beschränktheit des Blickfelds, die weggeträumt werden mußte. Das karge dörfliche Leben in Kärnten scheint ein guter Nährboden gewesen zu sein für das Wachsen der Phantasie, für die Erforschung der Dinge, für das weitausholende Erzählen. Und hat vielleicht schon früh die Sehnsucht geweckt nach dem, was später als fernes künstlerisches Ideal erscheint: »Das allerschönste Werk, bestehend aus Nichts, und wieder Nichts, und dem menschlichen Atem, dem Licht, den Tagen und Nächten, hat die Menschheit noch nicht geschaffen«.
In seinen Aufzeichnungsbüchern steht Handke dieses Ideal jedenfalls immer vor Augen. Und die Wege, diesem das Nichts, den Atem und das Licht enthaltenden Werk nahezukommen, sind die Wege der Einfachheit, können nur die der Einfachheit sein. Für das, was einem nahe ist, kann man keine Fremdworte verwenden, hat Martin Walser einmal gesagt. Und auch Gegenwartssinn, Durchlässigkeit und Teilnahme können nur aus Nicht-Distanz, also aus Nähe entstehen. Es sind die einfachen Worte, mit denen die Dinge beschreibbar, die einfachen Gesten, an denen Menschen und Tiere erkennbar sind. Und was sich darüber sagen läßt, lernt man aus den »Varianten des Immergleichen«. Das dabei zu Papier Gebrachte ist das Gegenteil jeder medial aufgeblasenen Kunst. Bleistift oder Kugelschreiber, Notizheft oder Schreibblock reichen aus, um die Eindrücke des Tages, das den Händen Erreichbare, den Augen Sicht-bare, den Ohren Hörbare festzuhalten. Nicht um ein möglichst artifizielles Sprachspiel geht es, sondern, wie Handke mit Blick auf Goethe sagt, um das »stille Sichaneinanderfügen des Vorhandenen«. Dann stellen sich auch die Bilder ein, die lebendigen, gültigen, Denk- und Vorstellungsvermögen erregenden, Sinne und Leidenschaften ansprechenden Bilder. In ihnen liege »der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit«, an ihrer Bilderfähigkeit ermesse sich, immer wieder, die Gesundheit der Seele.
Für all das muß der Leser bereit sein. Der wirkliche, sich etwas erwartende, auf etwas wartende Leser, der sich einem Buch wie einem Abenteuer aussetzt und davon gesund oder vielleicht auch krank werden will. In jedem Fall müsse das Lesen, so Handke, eine Konsequenz haben, eine Handlung nach sich ziehen. Denn das Entscheidende der Poesie sei nicht ihre Gefälligkeit, sondern ihre Dringlichkeit. Das Buchaufschlagen ist eine folgenreiche Entscheidung, ein existentieller Akt. Anders als Zeitungen, Meldungen, Nachrichten mit ihrer von vornherein gegebenen Aktualität sei »das Buch, auch bloß ein Satz, ein Absatz, eine Seite« stets etwas »zu Aktualisierendes – zu Erarbeitendes«. Erarbeiten muß man sich auch die zunächst ganz unverbunden und isoliert anmutenden, in scheinbar beliebiger Reihenfolge angeordneten Notizen dieser Journale. Nur wer sich einläßt auf ihre verborgene Dramaturgie, nur wem sich die Durchlässigkeit der Zwischenräume, das Atemholen und Miteinandersprechen der Sätze mitteilen, wird den alles verbindenden, den epischen Blick erfassen, dem »selbst der Zahnstocher zwischen den Lippen eines Passanten« erzählenswert erscheint. Ein »persönliches Epos«, belebt und getragen von Poesie, dem »gefühlten wie begriffenen Rätsel« – einem Rätsel, das auch mit dem Lesen nicht endet. Denn alles wirkt weiter, alles klingt nach. So wie man nach einer langen Wanderung noch die Bewegung des Gehens in den Beinen spürt, oder das Wogen des Meeres nach einem Tag auf See. Warum man sich auf dieses Rätsel einlassen soll, warum es einen betrifft, ist die Frage jeder Kunst. Und jeder Leser, jeder Hörer, jeder Betrachter muß seine Antwort finden. Jeder, den’s angeht.
SINN UND FORM 4/2013, S. 603-610
