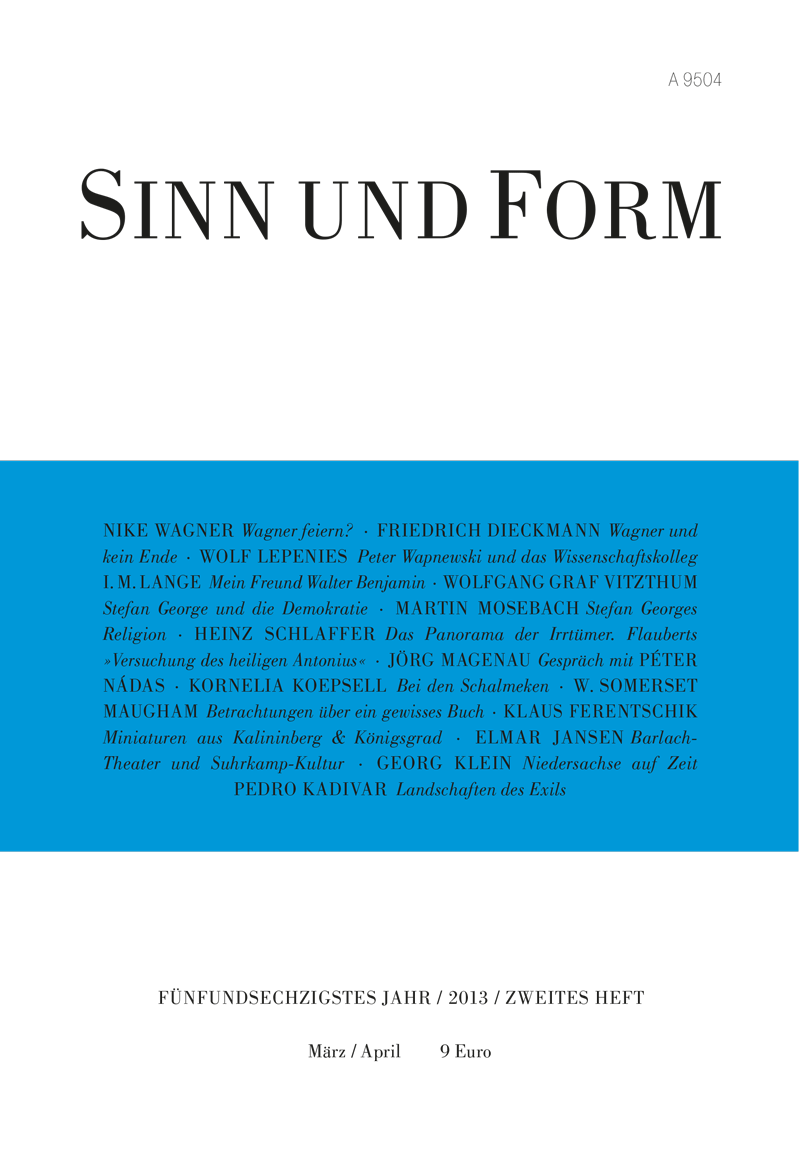
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-10-2
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 2/2013
Jansen, Elmar
»SEELENVERWANDTSCHAFT, EINE BLEIBENDE»
Ein etwas anderer Blick auf das Barlach-Theater und die Suhrkamp-Kultur
»Immer noch leichter Nebel – eigentlich gar nicht unsympathisch, … es kann mehr dahinter stecken als man denkt, kann anders kommen als ausgemacht ist …« So beginnt Barlachs »Blauer Boll« – als schwebendes Verfahren. Bei der Berliner Erstaufführung 1930 unter Jürgen Fehling am Gendarmenmarkt betrat mit diesen Worten Heinrich George die Szene. 1981 erarbeitete Frank-Patrick Steckel mit Wolf Redl die Rolle für die Schaubühne. Vorfassungen des Dramas, die ich im gleichen Jahr bekannt gemacht hatte, konnten einbezogen werden.
Den Boll hatte Barlach zunächst Baal genannt; Umrisse der gleichnamigen, gleichfalls »religiöser Delikte« überführten Brecht-Gestalt rückten in die Nähe und wurden doch auf Distanz gehalten. Steckel und sein Dramaturg Wolfgang Wiens legten ein 180seitiges Meditationsbuch zum Läuterungsprozeß des Lebemannes vor. 1985 hatte der Boll dann mit Kurt Böwe Premiere am Deutschen Theater. Auch hier wieder der niederdeutsche Marktplatz mit hochaufragendem Turm, von dem Boll in seiner Qual sich herabstürzen will, bis ihm – »Gewalt, himmelwärts ist am Werk« – im letzten Akt bessere Aussichten zuteil werden.
Kurt Pinthus hatte 1930 Fehlings Inszenierung Qualitätsmerkmale eines Reißers zugesprochen. Auch der überhaupt erste Barlach in der Schumannstraße erwies sich als zugkräftig; ihm war ein bisher bei solch schwierigen Stücken nicht gekannter, lang anhaltender Erfolg beschieden. Gastspiele in Köln, Kiel, Duisburg, Wuppertal schlossen sich an. 1988 folgten am gleichen Ort und mit nahezu gleichem Personal »Die echten Sedemunds« (Regie wiederum Rolf Winkelgrund), noch im selben Jahr herübergebeten zum Thalia-Theater Hamburg. Eine regelrechte Barlach-Welle begleitete die Aufbruchstimmung vor und nach den Wendejahren: Günter Krämer inszenierte den »Armen Vetter« in Bremen und Köln, Michael Gruner in Hamburg und Stuttgart; Wolf Redl wagte sich in Bochum an die Regie des »Toten Tags« und der junge Thomas Bischoff polarisierte am Mecklenburgischen Landestheater Parchim die Gemüter mit der selten aufgeführten, in den Jahren des heraufziehenden Nationalsozialismus entstandenen »Guten Zeit«. Hans Lietzau – schon in den 1950er Jahren am Berliner Schillertheater einer der produktivsten Barlach-Regisseure – inszenierte 1991 an den Münchner Kammerspielen einen so herausragenden »Boll«, daß er zum 29. Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Das Goethe-Institut London sah sich veranlaßt, alle diese deutsch-deutschen Erstaunlichkeiten in einer Barlach-Tagung aufzuarbeiten (Elmar Jansen: Verflucht deutsch, FAZ, 8. Januar 1992). J.M. Ritchie stellte seine Übersetzung des »Squire Blue Boll« zur Diskussion, gedruckt in den von ihm mitherausgegebenen »Seven Expressionist Plays. Kokoschka to Barlach«.
Zwanzig Jahre später ein anderes Barlach-Theater. Schrille Pfiffe, Krakeel, gelegentlich untermalt von milderen Einlassungen. Das Bühneninteresse am »Boll« scheint dagegen auf dem Tiefpunkt. Doch halt: Rumort es da nicht an einem stillen Ort? Es hört sich an wie die herunterrasselnde Kette eines Rettungsankers. Peter Handke, unterwegs zu immer neuen Erfahrungen in der Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, erzählt einen eigentlich »Unerzählbaren Alptraum« (Die Zeit 52/2012). Gegen Ende dieser neuerlichen Publikumsbeschimpfung kommt ihm ein erlösender Gedanke: den »Boll« in Sprachen zu übertragen, in denen er bisher nicht vorliegt.
Etwa in den Jahren, als sein »Kaspar« – auch der von Wolf Redl verkörpert – in Frankfurt herauskam, hat Handke den »Boll« gesehen. Wann, wo und mit wem, das weiß er nicht mehr genau. Aber da er den Namen des Regisseurs nennt, läßt es sich präzise rekonstruieren: Es war der nach Fehling entscheidende Triumph des Stücks unter Hans Bauer mit Hans Dieter Zeidler, erstmals am 7. April 1967, Landestheater Darmstadt. Ein »tiefsinniges Mysterium« begegnete Peter Handke dort; sehr »zum Unglück« sei das Werk heute »vergessen«. Handke empfand damals »Seelenverwandtschaft, eine bleibende«; »nie mehr« habe er seitdem »so stille, träumerische und, gerade im Abstand voneinander so aufeinander bezogene, nein eingestimmte Menschen« gesehen. Der hohe Ton scheint anzudeuten, daß es ihm ernst ist. Auch die Kritik (Georg Hensel, Günther Rühle) fällte seinerzeit über Barlach, Bauer und Zeidler enthusiastische Urteile.
Handke will an »Erzadern« rühren, er will den Boll in eine französische Fassung transponieren, vielleicht auch in eine slawische Sprache (Le Boll Bleu; Modri Boll). Je größer die Wut, mit der er zu Werke geht und seinen Boll in eine andere Welt hinüberhorchen läßt, desto mehr käme das dem Furor des Stückes zugute. Suhrkamp sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen.
Bereits der Verlagsgründer – er wußte noch nichts von der vielberedeten »suhrkamp culture« – hatte sich dereinst die ehrwürdigsten Verdienste um Barlach erworben. Aus den zur Verramschung bestimmten Buchbeständen des zwangsweise aufgelösten jüdischen Verlags Paul Cassirer rettete Peter Suhrkamp 1936 elf Barlach-Titel, darunter den »Blauen Boll«.
Auf Barlachs Gedächtsnismale sind schon vor 1933 Anschläge von rechts verübt worden. Die ihm nach Hindenburgs Tod von Freunden dringend angeratene Mitunterzeichnung einer Stellungnahme zur Zusammenlegung des Reichskanzler- und des Reichspräsidentenamtes sollte ihm eine Atempause verschaffen, aber die Diffamierungen nahmen unvermindert ihren Fortgang. Barlach verfluchte nachträglich dieses einzige Zugeständnis gegenüber dem Regime; ein sarkastisch gezeichnetes »Bild des derzeitigen Staatsoberhauptes im Rahmen des vor kurzem allverehrten Vorgängers« verleibte er seinem Romanmanuskript »Der gestohlene Mond« ein.
Noch vor der Aktion gegen die »entartete Kunst« – nach neuesten Forschungen konfiszierte man über 600 seiner in Museen befindlichen Werke – wurde ein von Barlachs Jugendfreund Reinhard Piper liebevoll konzipierter Band mit Zeichnungen beschlagnahmt. Da man Barlach aber, von der Herkunft her, keine Spur mißliebigen Blutes in den Adern nachweisen konnte, war sein literarisches Werk zwar unerwünscht (Aufführungen wurden abgesetzt), aber nicht von vornherein zu verbieten.
Auf diesem schmalen Grat hat sich Peter Suhrkamp furchtlos bewegt; er veröffentlichte über den Tatbestand der Übernahme Barlachs in den Verlag 1936 eine Annonce und hielt die elf Buchausgaben in seiner Backlist vorrätig. Wiederholt hat er Barlach gebeten, ihm auch neue Werke zu übergeben, hat ihn, zusammen mit Gottfried Bermann-Fischer, in Güstrow persönlich aufgesucht. In der von ihm redigierten »Neuen Rundschau« druckte Suhrkamp 1934 ein Prosastück »Der Güstrower Dom«, versehen mit der Widmung »Für Ernst Barlach« – ein scheinbar winziger Versuch, für den Verfolgten, dem man in Güstrow die Fensterscheiben einschlug, etwas zu tun. Verfasser des kleinen Denkbildes war Barlachs Freund und späterer Nachlaßverwalter Friedrich Schult. Schult publizierte solche auf Herkunft, Landschaft und Alltagsleben bezogene Prosa ohne Blut-und-Boden-Töne sowohl in der Frankfurter Zeitung als auch in Anton Kippenbergs »Inselschiff «. Suhrkamp muß diese Arbeiten fast so geschätzt haben wie die Miniaturen Walter Benjamins, den er ab 1950 verlegte.
[...]
SINN UND FORM 2/2013, S. 267-271
