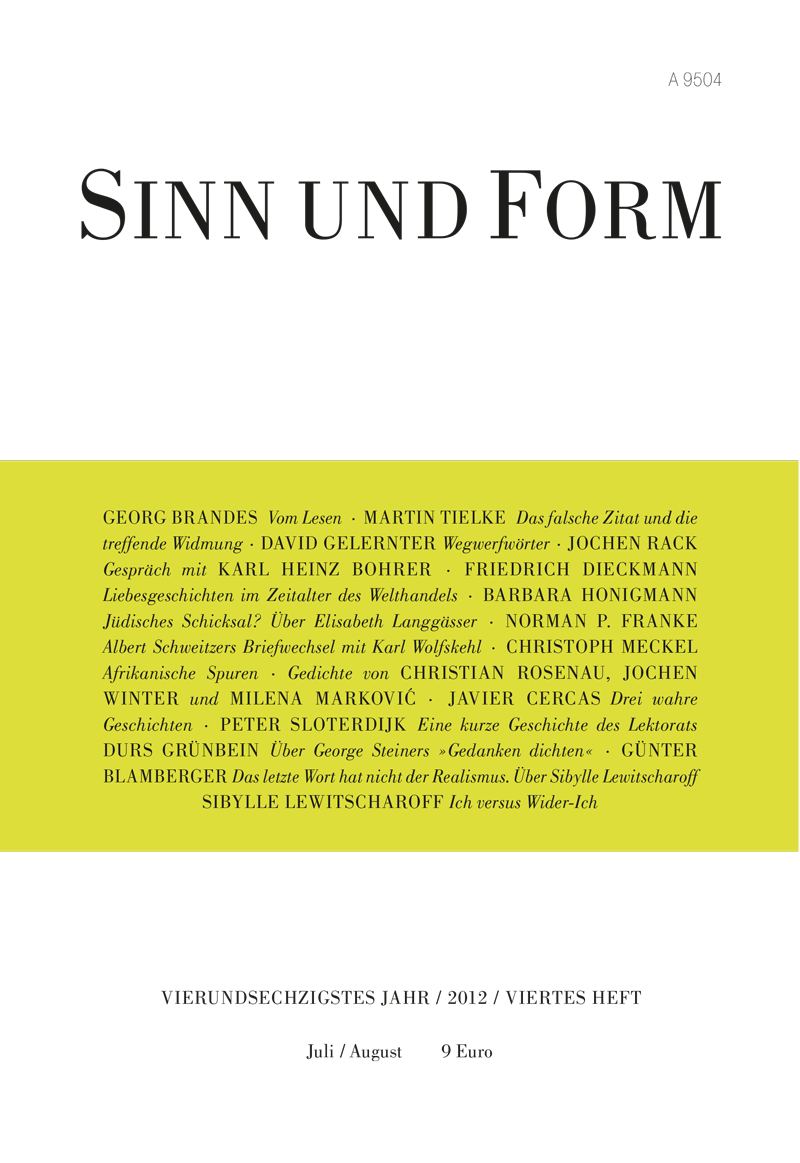
[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-06-5
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
Leseprobe aus Heft 4/2012
Honigmann, Barbara
JÜDISCHES SCHICKSAL?
Über Elisabeth Langgässer
Commystis commito.
Ist es eine Widmung oder ein Motto, das Elisabeth Langgässer ihrem Roman »Das unauslöschliche Siegel« voranstellt?
Es heißt auf deutsch: den Miteingeweihten gewidmet. Die mystes sind die Eingeweihten.
Das ist es, was mir die Lektüre von Elisabeth Langgässers Texten so schwermacht, ich fühle mich nicht als Mit-Eingeweihte, also als eine, der das Buch gewidmet, für die es geschrieben worden ist.
Bei der immer wiederkehrenden Stendhalschen Widmung »to the happy few« hingegen, auch einem Motto, fühle ich mich selbstverständlich mit eingeschlossen, obwohl der Unterschied zwischen den happy few und den commystis nur eine Nuance ist, aber im Raum dieser Nuance geht es weniger geheimnisvoll, weniger dunkel zu. Vielleicht bin ich noch ein letztes Kind der Aufklärung, jedenfalls verspüre ich keine Neigung zum Mystischen, und am Judentum zieht mich seine helle, die Tagseite an und nicht die mystische, kabbalistische, von der so viele Nichtjuden merkwürdigerweise glauben, sie repräsentiere das Jüdische in besonderer Weise. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich bin also Jüdin. Der Langgässer-Preis stellt für mich eine gewisse Herausforderung dar. Das Werk Elisabeth Langgässers, ihre Person, ihre Lebensgeschichte erscheinen mir schwierig und problematisch. Natürlich muß ich sie in ihrem katholischen Glauben akzeptieren und tue das auch, aber den Kampf, der auf jeder Seite ihres Werks zwischen Gott, Satan, Vorsehung, Versuchung, Auferstehung, Gottheit Christi und den trotz Taufe noch immer schwankenden Juden und deren schließlich erfolgender gnadenvoller Erlösung und Wiedergeburt geschildert wird, und zwar in einer überzeitlichen, zauberischen Sprache, kann ich nicht mitkämpfen, auch deshalb nicht, weil alle diese Wörter geschrieben stehen, um die Botschaft Christi zu übermitteln, die schon viele Generationen meiner Vorväter und Vormütter nicht gehört haben und nicht hören wollten. Abgesehen davon, daß ich Texte mit Botschaften nicht sonderlich mag.
Aber auch andere Leser Elisabeth Langgässers werden, wenn sie des Lateinischen nicht mächtig sind, ihre Schwierigkeiten haben, die Widmung zu verstehen, eine Widmung, die sie, ob gewollt oder nicht, von vornherein ausschließt. Und sie werden wohl auch die unzähligen Referenzen und Metaphern aus der griechischen und römischen Mythologie nicht mehr in ihre eigene Sprache und Lebenswirklichkeit übertragen können und mit der christlichen Glaubensunterweisung nicht viel anzufangen wissen.
Den Namen Elisabeth Langgässer kannte ich nicht, bevor ich ihm in Cordelia Edvardsons Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer« begegnete. In der Bibliothek meiner Eltern, die meine frühen Lektüren bestimmte, gab es Ausgaben von Heine, Rilke, Brecht, den Manns und eine, wahrscheinlich nicht vollständige, Gesamtausgabe von Sigmund Freud, ich nehme an, die, die in England herausgegeben wurde, von wo sie meine Eltern mitgebracht hatten; meine Mutter schenkte sie dann einem befreundeten Psychiater in der DDR, der sich über dieses Geschenk sehr gefreut haben dürfte. Es gab auch den Roman »Die Thibaults« des Nobelpreisträgers von 1937, Roger Martin du Gard, eines französischen Schriftstellers des »renouveau catholique«, an dem sich Langgässer in den dreißiger Jahren stark orientiert hat, aber ihre eigenen Werke fand ich in der Bibliothek meiner Eltern nicht.
In der unerhörten Überlebensgeschichte ihrer Tochter – alle Überlebensgeschichten sind unerhört – ist sie mir dann, wie gesagt, zum erstenmal begegnet, also nicht als Autorin eines ihrer Werke, sondern in dieser, um es vorsichtig auszudrücken, schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. In ihrem Buch erzählt die Tochter vierzig Jahre später, lange nach dem Tod Elisabeth Langgässers, die Geschichte, die ihre Mutter nicht erzählt hat, bzw. sie stellt richtig, was die Mutter aus ihrer Perspektive nur angedeutet hat. Sie hat das, bei aller Anhänglichkeit, deutlich und ohne metaphysische Überfrachtung getan, denn sie war aus Auschwitz zurückgekehrt, dem Ort, der viel dunkler war, als jedes mystische Erleben je sein kann.
Kurze Zeit nachdem Elisabeth Langgässer überhaupt vom Überleben ihrer Tochter erfahren hat, bittet sie sie in einem Brief, ihr doch ihre Erfahrungen in A. in Form eines schriftlichen Berichts mitzuteilen; wiedergesehen haben sie sich erst später und auch nur noch ein einziges Mal. Den Namen Auschwitz schreibt sie nicht aus. Kann sie es nicht, wagt sie es nicht, ist das schon eine Verharmlosung? Das wird es wahrscheinlich sein, denn sonst könnte sie in demselben Brief nicht behaupten: »In Wirklichkeit weiß ich ja alles, was ich aber brauche« (brauche!), »sind ganz reale Anschauungen!«
Alles in mir sträubt sich, wenn ich diese Zeilen lese, es bringt mich auf, ich empfinde es nicht nur als unsensibel, sondern eigentlich als unanständig. Aber es ist jetzt natürlich sehr leicht, aufgebracht zu sein, zu urteilen und gar zu verurteilen oder auch über einen noch früheren Brief Elisabeth Langgässers entsetzt zu sein, in dem sie 1933 darum bettelt, doch in die Reichsschrifttumskammer, aus der sie auf Grund der Rassengesetze ausgeschlossen worden war, wieder aufgenommen zu werden, und zwar mit dem Argument, ihre künstlerische Begabung käme einzig und allein aus der rein arischen Linie ihrer mütterlichen Herkunft und sie sei doch mit einem Arier verheiratet und die jüdischen Verlage hätten sie alle mehr oder weniger boykottiert. Als sie keine Antwort erhält, wendet sie sich mit denselben Argumenten noch einmal direkt an Goebbels, der ihr natürlich auch nicht antwortet. Und setzt dann weiter, mit mäßigem Erfolg, alles in Bewegung, um nur ja auf der Bühne der deutschen Literatur präsent zu bleiben. Das »innere Exil« sucht sie erst, als ihr kein anderer Weg mehr offensteht. Die Idee, auszuwandern, scheint ihr nie in den Sinn gekommen zu sein, obwohl Kollegen, enge Freunde und Bekannte, einer nach dem anderen, das Land verlassen.
In der Korrespondenz dieser Jahre erscheint sie übelnehmerisch und selbstgerecht. Ich verstehe: es ist eine schwere Zeit, sie möchte sich als Schriftstellerin behaupten, ihre Position ist unsicher und gefährdet und wird noch viel unsicherer und gefährdeter werden, ihre Anstrengungen um Anpassung nutzen ihr nämlich nichts, die Rassengesetze belegen sie für die Dauer des Dritten Reichs ein für allemal mit Publikationsverbot.
Zur gleichen Zeit, 1933, schreibt die Karmeliternonne Edith Stein ihre Autobiographie »Aus dem Leben einer jüdischen Familie«.
Es ist vielleicht unfair, diese beiden Figuren miteinander zu vergleichen. Der Vergleich drängt sich mir jedoch auf. Edith Stein war knapp zehn Jahre älter als Elisabeth Langgässer und offensichtlich eine sehr viel intellektuellere Frau. Sie promovierte bei Edmund Husserl und assistierte ihm zusammen mit Heidegger an der Universität Freiburg, ging durch Zeiten atheistischer Anschauungen und feministischen Engagements, interessierte sich also für »Frauenfragen«, in denen Elisabeth Langgässer besonders konservativ blieb, indem sie ein Ideal der Mütterlichkeit und Häuslichkeit verteidigte, dem sie im Leben eigentlich überhaupt nicht entsprach.
Edith Stein nahm 1922 mit 31 Jahren den katholischen Glauben an, in Bergzabern, nicht sehr weit von Darmstadt, wo Elisabeth Langgässer zur gleichen Zeit als Lehrerin arbeitete, und trat später in das Karmeliterkloster in Köln ein. Gleich 1933, nach den ersten antijüdischen Aktionen und Gesetzen, wandte sie sich in Briefen, die er vielleicht nie gelesen hat, an Pius XII., um ihn zu beschwören: »Wir fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält.« Als sie schließlich aus dem inzwischen nach Holland emigrierten Kloster mit ihrer Schwester zur Deportation abgeholt wird, soll sie zu ihr gesagt haben: »Komm, wir gehen für unser Volk.«
Dieses Zugehörigkeitsgefühl zum jüdischen Volk hat Elisabeth Langgässer nicht gespürt, hat es wahrscheinlich auch nicht spüren können, denn vielleicht wußte sie ja lange gar nichts von der jüdischen Herkunft ihres Vaters. Insofern ist es schwer von einer wie auch immer gearteten jüdischen Identität überhaupt zu sprechen, zu der sie sich hätte bekennen können, auch wenn ihr dann eine übergestülpt wurde, für die sie teuer bezahlt hat.
[...]
SINN UND FORM 4/2012, S. 504-515
