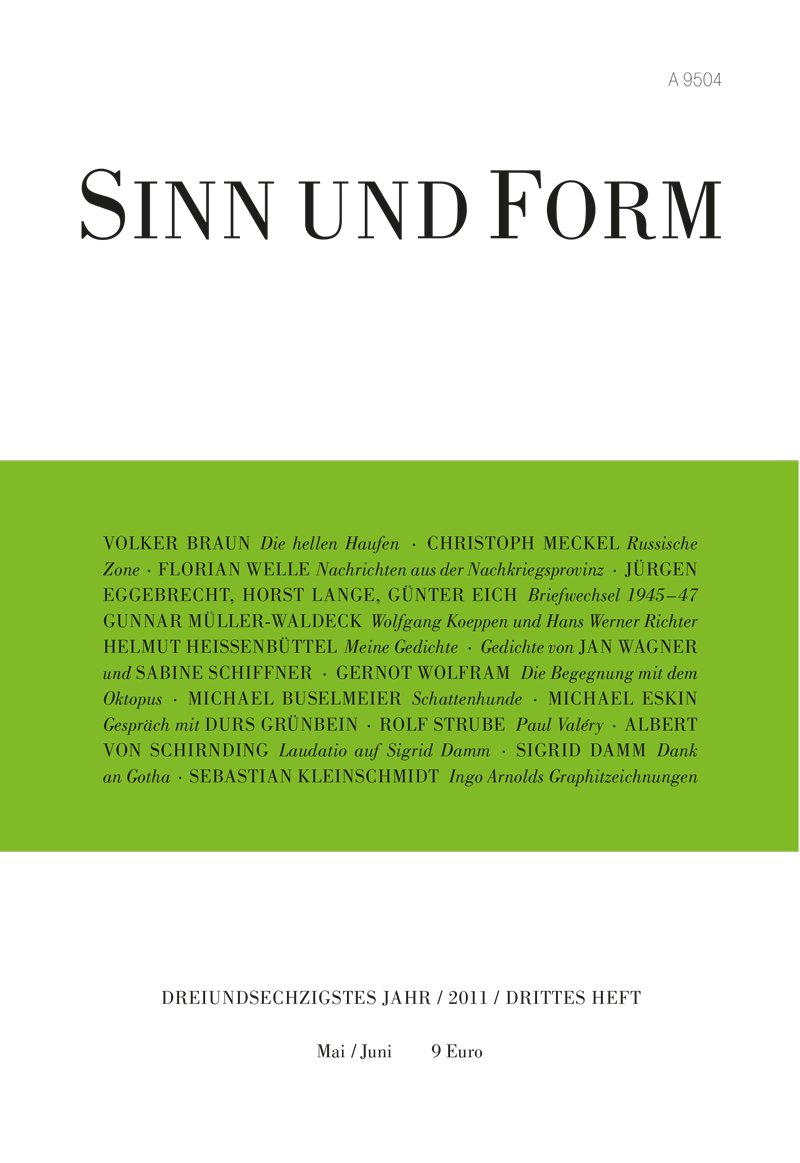Leseprobe aus Heft 3/2011
Strube, Rolf
VON DER MUSIK DER IDEEN
Paul Valéry – Dichter, Philosoph, Europäer
Paul Valéry hat zeitlebens über die Sprache nachgedacht. »Den Dichter«, sagt er einmal, erkennt man »an der einfachen Tatsache, daß er den Leser in einen Inspirierten verwandelt.« Lesen und Verstehen wird hier zu einem kurzen, scharf umrissenen Vorgang, als ginge es um nichts anderes als den gelungenen Anstoß einer Billardkugel, die ihre kinetische Energie beim Aufprall an eine andere weitergibt. Jahrhunderte der Exegese und Hermeneutik werden spielerisch überbrückt, wie um zu demonstrieren: Es geht auch einfacher und vor allem – präziser. Valéry liebte Anleihen oder besser Analogien aus physikalischen und mathematischen Bereichen, er hat sie immer wieder als Mittel gebraucht, um die kunstbegeisterte, an der Geschichte der Grande Nation orientierte Gesellschaft seiner Zeit aus ihren Träumen zu wecken, ein Bewußtsein dafür zu schaffen, daß Richtung und Tempo künftiger Entwicklungen von den empirischen Wissenschaften, von Technik und Industrie bestimmt sein würden.
In diesem Sinne läßt sich auch »Der Abend mit Monsieur Teste« aus dem Jahr 1895 lesen – als provokatorischer Kommentar zum Fin de Siècle, dem Valéry selbst seine ästhetischen Vorlieben, seine philosophischen Interessen verdankte. Monsieur Teste – man kann den Namen mit »testa«, dem italienischen Wort für Kopf, oder dem lateinischen »testis«, dem »Zeugen«, in Verbindung bringen – ist ein seltsamer Zeitgenosse: einer, der vehement die Ansicht vertritt, man könne nur in einer nüchternen, unpersönlichen Umgebung, einer Büro- oder Hotelzimmeratmosphäre geistig arbeiten. Er lebt, wie es heißt, »von unbedeutenden Wochenspekulationen an der Börse«, hält sich aus beruflicher Konkurrenz heraus. Irgendwann scheint er sich entschlossen zu haben, seinen ausgeprägten Geltungsdrang zu den lästigen Begleiterscheinungen des Lebens zu zählen, er versteigt sich sogar zu der Behauptung, die stärksten und fähigsten Köpfe der Menschheit hätten einsam für sich gearbeitet und seien namenlos geblieben, es gebe eine Art Parallelgeschichte des unbekannten Entdeckers und Erfinders.
Monsieur Teste besitzt, könnte man sagen, durchaus eine entfernte Verwandtschaft mit all den verkannten Genies und verkrachten Existenzen, die damals die Pariser Künstlercafés bevölkerten. Ihn allerdings hätte man dort vergeblich gesucht: seine äußere Erscheinung – betont unauffällig, geradezu absichtsvoll nichtssagend – verrät Distanz zur Extravaganz der Bohème, auch sein Desinteresse an Musik und Theater hat etwas Ostentatives, Programmatisches. Teste hat es sich zur Aufgabe gemacht, den verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens und Zusammenlebens eine neue »cartesianische« Klarheit und Durchsichtigkeit zu erschließen.
Der Leser erfährt davon nur in Andeutungen, er bleibt angewiesen auf die Perspektive eines bewundernden Freundes. Dieser Ich-Erzähler, ein homme de lettres, vielleicht ein Lyriker, bedient sich einer auffallend bilderreichen Sprache. Es scheint, daß er Metaphern zu Hilfe nimmt, um seine Eindrücke und Vermutungen überhaupt zum Ausdruck bringen zu können – etwa wenn er mit Blick auf Testes Faible für experimentelle Anordnungen, mathematische Reihen und Wahrscheinlichkeiten wie über einen Botaniker redet und von ihm sagt: Er sorgte für die Wiederholung gewisser Ideen, »begoß sie mit dem Element Zahl«. Testes Gedankenwelt ist eingefaßt in dichterisches Empfinden, von einer Aura des Enigmatischen umgeben.
Es ging Valéry nicht darum, der Zukunft in der Art eines Jules Verne oder H.G. Wells ein Gesicht zu geben, wohl aber um die Erregung, an der Schwelle einer neuen Epoche zu stehen. Aus heutiger Sicht weisen Monsieur Testes nüchterne Visionen, sein kalter Blick auf die menschlichen Verhältnisse hellsichtig voraus auf das soziale Klima der modernen Massengesellschaften, auf Zeiten, in denen es für alle Bereiche – Stadtplanung, Marktforschung, Versicherungs- und Gesundheitswesen – Statistiken gibt. Und es deutet sich in Testes kühlem Verhältnis zu den schönen Künsten auch bereits die Geringschätzung an, mit der der Dichter Valéry die, wie er glaubt, traditionell überschätzte künstlerische Inspiration behandeln wird: Dichtung und abstraktes, methodisches Denken schließen einander – ganz im Sinne von Edgar Allan Poes »Philosophy of Composition« – keineswegs aus, Kunst und analytische Geometrie unterscheiden sich, wie Ezra Pound formuliert, allenfalls in der Wahl des Gegenstands. All das ist in Monsieur Teste angelegt, den Valéry im nachhinein, als er in den zwanziger Jahren an weiteren Episoden schrieb, als eine Kunstfigur charakterisierte – kaum lebensfähig und geboren aus einer fixen Idee, die damals all seine intellektuellen Aktivitäten beherrschte, einem unstillbaren Verlangen nach Präzision, einem »Wahn der Genauigkeit«, dessen tautologische Formel »Ich habe versucht, das zu denken, was ich dachte« als Motto des Sprach- und Wissenschaftsphilosophen Valéry dienen könnte.
Die Erstauflage des »Abend mit Monsieur Teste« sollte ursprünglich dem Künstler Edgar Degas gewidmet sein, mit dem Valéry in jungen Jahren gut bekannt war . Degas lehnte jedoch ab. Valéry kommt Jahrzehnte später darauf zu sprechen, in seinem Essay »Tanz, Zeichnung und Degas«, den er 1936 anläßlich einer großen Pariser Degas-Ausstellung verfaßte. Er schildert ausführlich, wie er dem Künstler 1893 im Hause des Malers und Kunsthändlers Henri Rouart begegnete und wie sich daraus eine – wenn auch wegen Degas’ schwierigem, impulsivem Charakter distanzierte – Freundschaft entwickelte. So sehr man Degas’ Urteil in ästhetischen Fragen schätzte, so sehr fühlte man sich durch die Spottiraden brüskiert, mit denen er über Künstlerkollegen und Gelehrte herzog. Auch Valéry bekam anfangs seine Geringschätzung der zeitgenössischen Literatur zu spüren, die »keinen Schuß Pulver wert« sei. Er gehörte, schreibt Valéry, zu jenen an Racine und der alten Musik geschulten Connaisseuren, die sich für jede Lebenslage mit Zitaten und geflügelten Worten gewappnet hatten und immer bereit waren, ihren »klassischen« Geschmack und den Kanon zu verteidigen – wenn es sein mußte, auch mit Wutausbrüchen.
Den jungen Valéry, der sich nach ersten Erfolgen als symbolistischer Dichter seines Weges durchaus nicht sicher war, faszinierte dieser Rigorismus: Degas war für ihn das Muster eines bildenden Künstlers, dem die Verfeinerung spezieller Techniken zur Lebensaufgabe geworden war, der eben darin seine Bestimmung gefunden hatte. Sein Artistentum hatte sich auf unspektakuläre, eigentlich »unbedeutende Gegenstände« konzentriert. Erst die Mühe, die er auf sie verwandte, umgab sie, wie Valéry es ausdrückt, mit einer »Art von Unendlichkeit« – was er sinngemäß auch über Stéphane Mallarmé sagte, den zweiten Virtuosen, in dessen Bann er in diesen Jahren geriet: So wie Degas’ Tänzerinnen und weibliche Akte, die ihn berühmt gemacht haben, für ein künstlerisches Universum stehen, bewegt sich Mallarmés Spiel mit den sich überlagernden Bedeutungsebenen in einem absolut gesetzten System von Worten, in dem sich die magischen Abgründe der Sprache öffnen.
In biographischer Hinsicht klingen bereits im »Abend mit Monsieur Teste« Möglichkeiten der Selbstbefreiung an, die Valéry wenig später praktisch umsetzt. Seine literarischen Ambitionen treten mehr und mehr in den Hintergrund, für viele Jahre wird die Beschäftigung mit Philosophie, Sprachanalyse und den empirischen Wissenschaften für ihn bestimmend.
Es scheint ihm in dieser Zeit geradezu lästig zu sein, auf seine frühen Erfolge als Lyriker angesprochen zu werden – etwa auf sein Gedicht »Narcisse parle«, »Narziß spricht«, das den antiken Mythos in einen magischen Moment in der Abenddämmerung einbettet. Andeutungen lassen den Schluß zu, daß er die Beziehung zu Mallarmé, der ein literarischer Mentor für ihn wurde, als belastend empfunden hat. Gerade zu Beginn, sagt Valéry, habe ihm die Literatur »fast nichts mehr« bedeutet. Lesen und Schreiben habe er mit einer Unlust betrieben, die ihn nie wieder ganz verließ. In seinen Erinnerungen findet sich auch der Hinweis, es sei entmutigend, »inmitten soeben entstandener Meisterwerke geboren zu werden«, einer vom Glück begünstigten Dichtergeneration folgen zu müssen – wobei er auf die Antipoden Mallarmé und Verlaine anspielt.
1892 erlebt Valéry während eines Aufenthalts in Genua eine nächtliche Krise, die weitreichende Folgen hat. Was in dieser Oktobernacht geschah, wissen wir nur aus einigen kurzen Notizen:
»Entsetzliche Nacht. Auf dem Bett sitzend verbracht. Überall Gewitter. Bei jedem Blitz blendende Helle in meinem Zimmer. Und mein ganzes Schicksal spielte sich in meinem Kopf ab. Ich bin zwischen mir und mir... Ich fühlte mich als ein anderer heute morgen. Aber – sich als ein anderer fühlen – kann nicht von Dauer sein – sei es, daß man sich zurückverwandelt und der frühere den Sieg davonträgt, oder daß der neue Mensch den früheren absorbiert und zunichte macht.«
Valéry hat die Geschehnisse dieser Nacht als eine Art Doppelgänger-Erlebnis eingestuft. Ein Gefühl der Fremdheit sich selbst gegenüber beherrschte ihn, begleitet von der anhaltenden Verwunderung darüber, gerade diesen Körper, dieses individuelle Leben zu besitzen. Die »Nacht von Genua« hinterläßt tiefe Spuren, die psychischen Vorgänge von damals wiederholen sich noch oft, sie bleiben beunruhigend, wenn sie ihn auch nicht mehr erschrecken.
Valéry zieht daraus eine Konsequenz: Ab 1894 macht er es sich zur Gewohnheit, so früh aufzustehen, daß er vor Tagesbeginn Zeit für Notizen und Reflexionen findet – wenn der eben erwachte Geist noch nicht von den Aufgaben des Tages absorbiert ist, die Einstimmung auf das tägliche Rollenspiel noch nicht erfolgt ist. »Das sind zwei oder drei Stunden innerer Manöver, die ich physiologisch brauche«, bemerkt Valéry dazu. »Wird dieses Bedürfnis durchkreuzt, ist mir mein ganzer Tag verdorben, ich fühle mich nicht mehr... Ans Aufschreiben dessen, was ich veröffentlichen muß, mache ich mich erst nach dieser Zeit, die ich mir gewähre oder besser, die ich dem Zufall der Eingebungen des Geistes überlasse...«
Tag für Tag begibt sich Valéry als erstes an die Grenzen dessen, was sich über den Menschen, sein Gehirn, seinen Körper, seine Orientierung in Raum und Zeit sagen läßt. Wie sein Vorbild, der Mathematiker Poincaré, sucht er seinen Weg abseits der damals vorherrschenden Überzeugung von der totalen Determiniertheit physikalischer Prozesse. Er betreibt eine breitgefächerte wissenschaftsphilosophische Grundlagenforschung und fragt nach Sinn und Wert der Naturgesetze ebenso wie nach dem Verhältnis von Sprache und Denken, Selbstsein und Welt. Alles, was Geist und Sprache lehren können, so seine Überzeugung, kommt durch den Bezug auf etwas anderes, außerhalb Liegendes zustande, das weder Geist noch Sprache ist – eine physikalische Realität, die nur durch präzises Beobachten erkannt werden kann. Valérys analytischer Zugriff, seine Fähigkeit, im scheinbar Disparaten das Gesetzmäßige zu erkennen und zu formulieren, war bekannt und wurde gelegentlich von jungen Wissenschaftlern genutzt – wie von dem Neurologen Ludo von Bogaert, der ihn in den zwanziger Jahren häufig frühmorgens aufsuchte, wenn Valéry die Arbeit an den »Cahiers« gerade beendet hatte.
[...]
SINN UND FORM 3/2011, S. 403-413