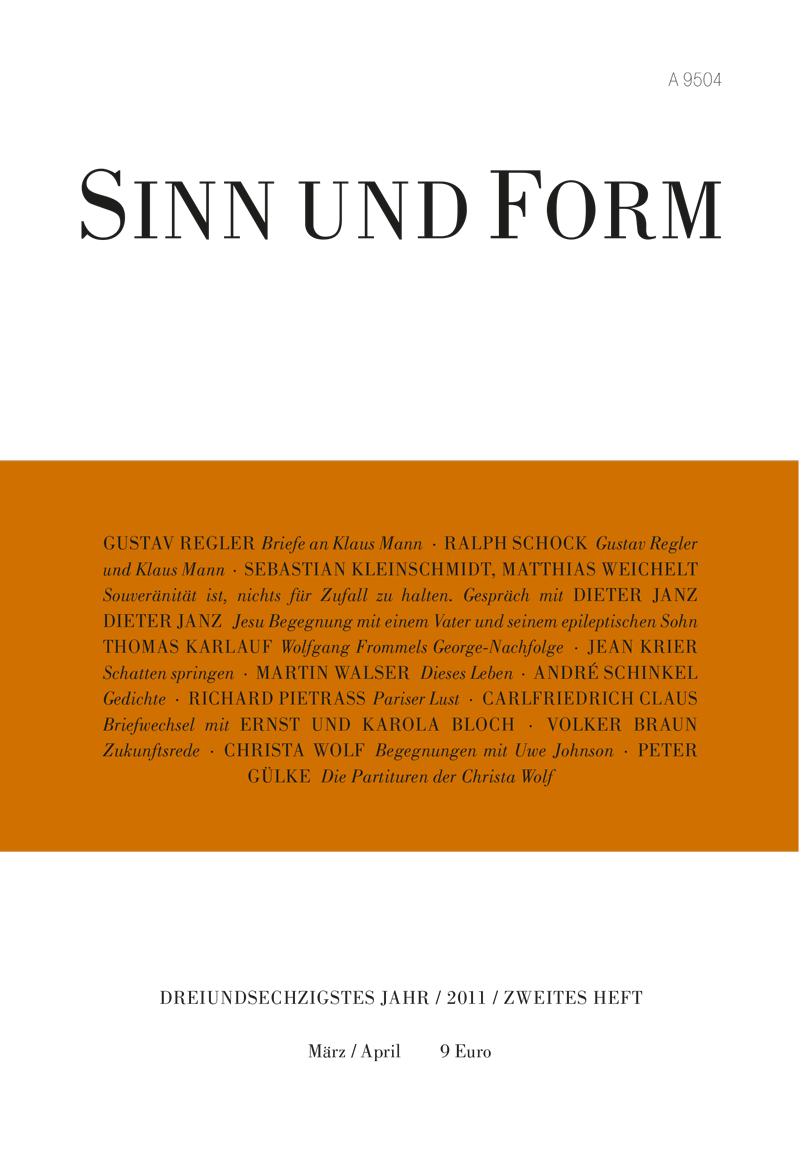Leseprobe aus Heft 2/2011
Weichelt, Matthias
Souveränität ist, nichts für Zufall zu halten. Gespräch mit Dieter Janz und Sebastian Kleinschmidt
SEBASTIAN KLEINSCHMIDT: Sie sind Arzt, Neurologe, Ihre Spezialität ist die Epileptologie. Generell aber verstehen Sie sich als Gewährsmann der anthropologischen Medizin. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
DIETER JANZ: Es ist nicht ganz einfach zu sagen, was medizinische Anthropologie bzw. anthropologische Medizin ist, aber versuchen wir es. Die drei Stücke, die Viktor von Weizsäcker 1927 für die »Kreatur« verfaßt hat, nämlich »Der Arzt und der Kranke«, »Die Schmerzen« und »Krankengeschichte«, nannte er Stücke einer medizinischen Anthropologie. Und dort sagt er, das Urphänomen der medizinischen Anthropologie und der Hauptgegenstand ihres Wissens sei der kranke Mensch, der eine Not hat, der der Hilfe bedarf und dafür den Arzt ruft. Und dieser Ursprungssituation sollte das Verhältnis von Krankheit und Medizin entsprechen. Die Medizin, wie sie gelehrt wird, ist eine Medizin, die sich mehr einem Etwas zuwendet als einem Jemand. Dieses Gewichtsverhältnis zu ändern, das heißt die Beziehung zwischen Arzt und Krankem menschlich ernst zu nehmen, ist die Absicht einer anthropologischen Medizin. Bis hierhin ist das alles sehr einfach. Der nächste Schritt, der nächste Gedanke ist, sich zu fragen, was unterscheidet den kranken Menschen der anthropologischen Medizin vom Patienten der Schulmedizin? Antwort: daß man ihn als Objekt begreift, das ein Subjekt enthält, und daß der Arzt dieses Subjekt anerkennt. Und nun beginnt ein Gespräch. Die Anamnese aus der Schulmedizin gilt natürlich auch in der anthropologischen Medizin. Aber hier wird sie zum Gespräch, in der Schulmedizin ist es eine Erhebung. Eine Erhebung von Tatsachen nach einem gewissen Schema, zuerst Familiengeschichte, also Auflistung der Krankheiten der Eltern und Geschwister, dann der Kinderkrankheiten, der Geschlechtskrankheiten und anderer Leiden, schließlich der Operationen, während in der anthropologischen Medizin der Arzt fragt: Wo fehlt es? Oder, was fehlt Ihnen? Und dann aufmerksam lauscht. Das Lauschen ist eine außerordentlich bedeutsame ärztliche Handlung, auch weil sie alle möglichen Nebentöne mithört. Und das, was der Kranke sagt, führt hin auf den Weg zur Heilung, denn er ist es doch, der gesund werden will. Hinzu kommt, daß der Patient mehr von der Krankheit weiß als der Arzt, Dinge weiß, die sich erst im Gespräch erschließen. Und so beginnt der Arzt mit den einfachen, im gewissen Sinne klassischen Fragen: wo, wann, was und warum? Also wo. Wo spüren Sie etwas? Das geht erst mal auf die Anatomie zu, wobei die objektive Anatomie eine andere ist als die subjektive, das muß man im Auge haben. Dann das Wann. Wann ist das passiert, wann haben Sie das zuerst wahrgenommen, wann spüren Sie das, wann tritt das auf? Dieses Wann meint mehr als nur die Zeitangabe, es zielt auf den Kontext der Situation, in der die Symptome sich zuerst und dann immer wieder zeigten. Dann geht es zum Was, zur Art der Beschwerde. Mechthilde Kütemeyer, eine befreundete Ärztin, hat mir mal erzählt, daß man aus der Heftigkeit, mit der der Kranke seine Schmerzen schildert, auf die Dramatik des Traumas schließen kann. Also auch Nuancen spielen eine Rolle. Und schließlich kommt die letzte Frage, die Frage nach dem Warum. Im schulmedizinischen Verständnis ist das eine Frage nach der Ursache, im anthropologischen aber eine nach dem Sinn. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Empirisch gibt es darauf ganz bezeichnende Antworten. Zum Beispiel eine solche: Das müssen Sie doch wissen. Das ist oft ein Hinweis darauf, daß der Kranke nicht mitmacht bei der Ursachenfindung, er bietet das Symptom, und der Arzt soll damit umgehen. Aber so geht das in der anthropologischen Medizin eben nicht. Und nun fragt der Arzt: Was meinen Sie denn, wo das herkommt? Und es ist erstaunlich, was da so herauskommt. Zunächst die Spitzen: Daß man überhaupt so was gefragt wird. Dann die Scheu zu sagen, was man sich selber dabei gedacht hat. Das sind aber Abwehrversuche, die man überwinden muß als Frager. Damit darf man sich nicht zufriedengeben, sondern muß weiter insistieren, und zwar in einer Weise, die es dem anderen erlaubt, ungeniert auch dumme Sachen zu sagen. Und die dummen Sachen sind oft die, die helfen, einen Weg zu finden. Das gilt auch für organische Krankheiten. Es kommt vor, daß sich hier eine psychoneurotische Konstellation anschultert. Zum Beispiel bei Kranken mit einer Multiplen Sklerose oder mit Gelenkrheumatismus. Wenn man fragt, wo das ihrer Meinung nach herkommt, kann einem gleich ein ganzes Familiendrama erzählt werden. Wenn man die Biographik bei chronischen Krankheiten studiert, muß man die erste Schicht wegnehmen, um zu einer tieferen zu gelangen. Zuerst kommen etwa Aggressionen gegen einzelne Familienmitglieder zur Sprache, deren Berechtigung zweifelhaft ist. Und erst dann erscheint vielleicht etwas von Bedeutung, das man in Pathogenese und Therapie einbeziehen sollte. Also das ist die Frage nach dem Warum. So fein sind die Unterschiede zwischen Schulmedizin und anthropologischer Medizin. Das philosophische Gerüst – besser die ärztliche Einstellung – dahinter ist entscheidend. Das gilt besonders für die Sinnfrage. Die kann ja nur gestellt werden, wenn der Arzt eine Vorstellung hat, was der Sinn sein könnte, und wenn der Kranke bereit ist, mitzudenken. Man braucht ja vom Sinn nicht gleich eine umfassende Vorstellung zu haben. Es muß sich einem auch nicht alles sofort erschließen. Weizsäcker benutzt für den Begriff Sinn oft den der Bestimmung. Er fragt, welche Bestimmung hat eine Krankheit in einem Leben. Und man kann, ja, man muß unterscheiden zwischen einer vorletzten und einer letzten Bestimmung. Ich weiß gar nicht, wo diese Unterscheidung herkommt. Vielleicht wissen Sie es.
KLEINSCHMIDT: Nicht auf Anhieb, aber es leuchtet natürlich ein. Man muß ja nur auf die Sprache hören. Wir haben doch die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, und von da ist es nur ein Katzensprung zurück zu den vorletzten. Und so kommt man darauf. Und schon öffnet sich ein neuer Raum.
JANZ: Und wenn man einen Sinn dafür hat, daß es das Vorletzte und Letzte gibt, ist man viel freier, auch danach zu fragen. Das ist doch das Merkwürdige, daß die letzten Dinge auf die vorletzten abfärben. Philosophisch gesehen ein interessantes Phänomen. Deswegen ist die anthropologische Medizin für den nachdenklichen Arzt so anziehend.
KLEINSCHMIDT: Genaugenommen sprechen Sie ja jetzt über Formen der kooperativen Diagnostik zwischen Arzt und Patient. Und da sollte man die Hermeneutik ins Spiel bringen, und zwar in ihrer Gadamerschen Form. Hans Georg Gadamer hat sein langes Gelehrtenleben lang immer wieder neue Auslegungen dessen gegeben, was Hermeneutik ist. Und eine davon lautet, daß der hermeneutische Zugang zu einem Text – im Falle der Krankheit müßte man sagen zum Text der Erkrankung – darin besteht, ihn als Antwort zu verstehen, und zwar als Antwort auf eine Frage, die man noch nicht kennt. Das Gespräch bestünde dann darin, vom Antwortcharakter des Textes zur Rückgewinnung der verborgenen Frage zu gelangen.
JANZ: Ja, das ist ganz richtig. Das muß auch hier der Zugang sein, nämlich auszugehen von der festen, auf Erfahrung gegründeten Zuversicht, daß hinter der Krankheit ein verborgener Sinn liegt, den der Kranke nicht unmittelbar weiß und den auch der Arzt nicht weiß, und in diesem gemeinsamen Erforschen, in diesem gemeinsamen Erkennen sich am Ende einig zu werden, worin dieser Sinn besteht. Das ist übrigens etwas, was man auch in der Psychotherapie erfährt, daß nämlich nur die Deutung wirkt, die dem Patienten einleuchtet.
KLEINSCHMIDT: Man müßte nicht einmal sagen, daß die Deutung stimmt, es genügte festzustellen, daß sie wirkt.
JANZ: Das ist der Schlüssel in der Medizin. Das Wirksame ist das Wahre. Entscheidend ist zu verstehen, daß Krankheit immer in einen lebensgeschichtlichen Zusammenhang eingebettet ist und daß die ihr zugrundeliegenden Konflikte und Spannungen verborgen sind. Will man sie ans Licht bringen, muß man in die Biographie des Kranken einsteigen. Aus der biographischen Einbettung der Krankheit ergibt sich, daß der Mensch ein zeitgebundenes Wesen hat. Auch Krankheit hat daran teil. Zeitgebundenheit der Krankheit bedeutet, daß durch die Behandlung keine Restitution des vor der Krankheit herrschenden Zustandes erfolgt, daß Heilung nicht heißt: nach der Krankheit ist vor der Krankheit.
KLEINSCHMIDT: Im Gegensatz zum Fußball, wo die Trainer immer sagen: nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Natürlich, der Vergleich hinkt ein wenig …
JANZ: Ja, ja. Und es ist ungeheuer wichtig, das ernst zu nehmen, daß der Mensch nach der Krankheit nicht der Mensch vor der Krankheit ist, nicht sein kann. Auch wenn er selber meint, es zu sein.
KLEINSCHMIDT: Also keine Wiederherstellung. Es gibt zwar Gesundung, aber Heilung ist keine Rückkehr zum vorigen Zustand.
JANZ: Es gibt sie nicht, die Restitutio ad integrum. Gesundung ist keine Wiederherstellung.
KLEINSCHMIDT: Da der laienhafte Patient ja mitsprechen darf in der anthropologischen Medizin, würde ich sagen, daß in der Gesundung doch ein Moment der Wiederherstellung steckt. Da muß man gar nicht das Bild der Reparatur bemühen. Jede Erkrankung wirft den Menschen aus der Bahn, und jede Genesung führt ihn in die Bahn zurück. Das ist eine Art Wiederherstellung. Aber natürlich nur eine auf Zeit. Als ich vorhin bei Ihrer Formel »nach der Krankheit ist nicht vor der Krankheit« zum Kontrast auf die Fußball-Formel »nach dem Spiel ist vor dem Spiel« verwies, merkte ich erst hinterher, daß dies, übertragen auf unser Gebiet, in einem anderen Sinne doch stimmt. Denn niemand kann nach einer Heilung sicher sein, daß er fortan nicht wieder krank wird. Insofern gilt: nach der Krankheit ist vor der Krankheit. Die nächste Herausforderung wartet schon auf uns.
JANZ: Aber doch mit einer Erfahrung hinter uns.
MATTHIAS WEICHELT: Vielleicht muß man den Gedanken der Wiederherstellung ein bißchen genauer fassen. Natürlich geht es darum, daß der Mensch wieder mit sich ins reine kommt, daß er nicht mehr sagt, mir fehlt etwas. Nur muß man die Entwicklung dabei mitdenken. Der Mensch, der eine Krankheit durchgemacht hat und von ihr genesen ist, ist nicht mehr derselbe, der er ohne diese physische und geistige Erfahrung war. Er ist ein anderer geworden, und trotzdem wieder bei sich.
JANZ: Ja, so ist es. Und noch mehr. Man erlebt sich wieder neu. Diese Krankheit hatte man ja vorher nicht gehabt. Um es noch von einem anderen Punkt aus zu zeigen: Der Umgang mit einer Krankheit sollte darauf gerichtet sein, dahinterzukommen, was jemanden krank gemacht hat. Das bedeutet für Arzt wie Patient, die Wahrheit der Krankheit zu finden. Weizsäcker sagt: Jede Krankheit ist eine Krise der Wahrheit und eine Anerbietung von Wahrheit. Wird man wieder gesund, hat man sich also mit dieser neu errungenen Wahrheit restituiert. Und noch ein Gedanke. Nämlich die Frage, was wird dieser Mensch? Und zwar sowohl in der Krankheit wie in der Gesundheit. Der Mensch ist immer auf dem Weg. Auf dem Weg zu seiner Bestimmung.
KLEINSCHMIDT: Das berühmte »Werde, der du bist«. Ein Paradox, deswegen ist es ja so schön.
JANZ: Ich hatte jetzt mehr an die Beziehung von Krankheit und Gesundheit gedacht. Ich würde sagen, der Mensch ist immer auf dem Weg hin zur Gesundheit oder weg von der Gesundheit. Er ist immer auf dem Weg hin zu seiner Bestimmung oder weg von seiner Bestimmung. Das meint Weizsäcker.
KLEINSCHMIDT: Ja, das gibt zu denken.
JANZ: Das führt zur Frage des Gesundheitsbegriffs. Für Freud ist die Genußfähigkeit das Leitbild von Gesundheit. Für die Schulmedizin ist es die Leistungsfähigkeit, für die Sozialmedizin die Arbeitsfähigkeit. Das sind alles mehr oder weniger Fremdbestimmungen. Weizsäcker versucht davon wegzukommen, er sagt einmal, Krankheit sei genauso eine Art von Menschlichkeit wie Gesundheit. Gemeint ist, sich menschlich in der Zeit verändern, wachsen, reifen, sterben können.
WEICHELT: Das ist doch eine sehr positive Grundsicht von Krankheit.
JANZ: Ja, ich finde es auch positiv, und zwar im Sinne eines ernsten Zurüstens auf Leben, Lebendigkeit, Entwicklung, und am Ende auf den Tod.
WEICHELT: Das ist das Gegenteil dessen, was heutzutage als erstrebenswert gilt, nämlich das Leben verlängern, immer älter werden, vor allen Dingen den Tod hinausschieben.
KLEINSCHMIDT: Sie haben von der Wahrheit gesprochen, Herr Janz. Und Sie haben gesagt: Wahr ist, was wirksam ist. Man könnte auch sagen: wirksam ist nur die Deutung, über die sich Arzt und Patient im Laufe der Gespräche einig werden. Aber sind denn Wahrheit und Deutung immer heilungsfördernd? Es kann doch auch eine Wahrheit festgestellt werden, die keine Aussicht auf Gesundung eröffnet.
JANZ: Ja, es gibt Krankheiten, die nicht heilen. Franz Rosenzweigs Krankheit, das war so eine. Er litt an einer amyotrophen Lateralsklerose, einer unaufhaltsam fortschreitenden Erkrankung des motorischen Nervensystems. Und daran ist er auch zugrunde gegangen.
KLEINSCHMIDT: Nein, nein, das meinte ich nicht. Sie haben einmal vom Wahrheitsexhibitionismus in der heutigen Ärzteschaft gesprochen, während früher das Gegenteilige galt, nämlich extreme Wahrheitsscheu. Die Scheu bezog sich aufs Mitteilen, nichts aufs Erkennen. Der Arzt wußte mehr und hat es dem Patienten nicht gesagt. Wie steht es mit der Offenheit des Arztes, wenn die Wahrheit bitter und nichts als bitter für den Kranken ist?
JANZ: Wahrheit ist doch eine bipersonale Beziehung. Der Arzt muß zwischen sich und dem Kranken immer wieder neu die Situation von Frage und Antwort herstellen, von Weiterfragen und Weiterantworten. Und dann zeigt sich, daß sich beide um die Krankheit bemühen, aber das können sie nur, indem sie an das Verborgene herankommen. Und das, was verborgen ist, ist die Wahrheit über diese Krankheit. Natürlich ist das eine absolut ideale Vorstellung, die wir uns jetzt machen, denn wir haben noch nicht vom Widerstand gesprochen, der in jedem Patienten steckt und der schon in dem Satz erscheint: Ich komme zu Ihnen, weil ich gesund werden will. Der Arzt, der weiß, was auf ihn zukommt, müßte das Gespräch eigentlich so beginnen: Wissen Sie, was Sie damit sagen? Wissen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie, was gesund ist? Aber so geht das natürlich nicht. Es kommt darauf an, das Angemessene zu tun, und zwar in jeder Situation. Und das Gespräch ist nicht immer das Angemessene. Nehmen wir einen Mann mit Bandscheibenvorfall, der über die Notaufnahme in die Klinik kommt. Er ist vollkommen krumm und steif und hat wahnsinnige Schmerzen. Hier ist unmittelbare Hilfe gefordert. In diesem Zustand beginnt man kein Arzt-Patienten-Gespräch.
WEICHELT: Wie kamen Sie eigentlich zu dem Entschluß, Medizin zu studieren?
JANZ: Ich hatte einen Mitschüler, der zu Hause ein kleines Laboratorium besaß und chemische Experimente machte. Das hat mich beeindruckt. Und der war entschlossen, Medizin zu studieren. Außerdem hatte ich mit siebzehn gehört, daß man sich melden könne, wenn man auf der Pépinière in Berlin Medizin studieren wolle. Die Pépinière war eine Pflanzstätte für Militärärzte, dort konnte man umsonst studieren. Man wäre, wenn man genommen worden wäre, Fähnrich geworden und hätte sich festlegen müssen, auf zehn oder zwanzig Jahre beim Militär zu bleiben. Mein damaliger Pfadfinderführer, er war vier oder fünf Jahre älter als ich, war Medizinstudent beim Militär. Der ist noch im Krieg Militärarzt geworden. Und der hat mir in gewisser Hinsicht Eindruck gemacht. Mir gefiel er in Uniform. Ich wußte nicht, ob ich je eine so eindrucksvolle Gestalt würde abgeben können. Ich habe mich nicht so gutaussehend, nicht so kerzengerade gewachsen gesehen. Im übrigen fragt man sich, was kommt denn überhaupt in Frage. Es kam eigentlich nur in Frage: entweder Lehrer oder Richter oder Pfarrer oder eben Arzt. Was gab es denn sonst?
WEICHELT: Journalist?
JANZ: Nein, das kam nicht in Frage. Mein Vater war Pfarrer, er hat es ungern gesehen, wenn ich Zeitung las. Er fand das Deutsch, das in der Zeitung geschrieben wurde, nicht besonders förderlich für den Stil. Er hat gesagt, wenn du in der Schule einen Aufsatz zu schreiben hast, lies einige Tage vorher keine Zeitung. Mit der Vorstellung, Pfarrer zu werden, hatte ich auch gespielt. Vor der Aufgabe zu stehen, jeden Sonntag für eine halbe oder dreiviertel Stunde etwas Wesentliches, Bedeutsames und Lebenswichtiges zu sagen – und das schien mir immer das Wesen des Pfarrerberufs zu sein –, hatte etwas absolut Herausforderndes. Ich erinnere mich, daß ich mit siebzehn einmal gesagt habe: Eigentlich müßte man entweder Pfarrer oder Sturzkampfflieger werden. Ich meinte, die Berufswahl sei eigentlich eine Mutprobe. Und Pfarrer zu werden in dieser Zeit, Mitte der dreißiger Jahre, das erforderte ja Mut. Man mußte das Christentum verteidigen. Feigheit war da nicht gefragt. Als ich sagte, ich weiß nicht, ob Medizin oder Theologie, fragte mein Vetter, er war Theologe, was stellst du dir denn vor unter Theologie? Darauf ich: Unter Theologie stelle ich mir etwas sehr Abenteuerliches vor. Darauf er: Na, dann studier mal lieber Medizin.
WEICHELT: Wie verliefen Ihre beruflichen Anfänge?
JANZ: Meine erste Stelle nach dem Krieg war in Heidelberg. Ich hatte mich bei dem Neurologen Paul Vogel vorgestellt. Ihn hatte Alexander Mitscherlich mir empfohlen als den einzigen klinisch wirksamen Schüler Viktor von Weizsäckers. Drei Tage nach Weihnachten habe ich Professor Vogel, da er nicht in der Klinik war, zu Hause besucht. Das war eine unmögliche Sache. Ich habe geklingelt, er öffnete mir. Ich sagte: Entschuldigen Sie, darf ich mich Ihnen vorstellen? Herr Mitscherlich hat mir gesagt, ich solle mich an Sie wenden. Ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten. – Da kommen Sie jetzt zu mir nach Hause? sagte Vogel und drückte die Tür zu. Und da, so hat er es später erzählt bei der kleinen Rede, die er anläßlich meiner Habilitation gehalten hat, hätte ich meinen Fuß in die Tür gestellt und gesagt: Herr Professor, geben Sie mir wenigstens die Gelegenheit, daß ich mich schriftlich vorstelle. – Na, das können Sie ja machen. Ich habe ihm also geschrieben. Bald darauf kriegte ich eine Postkarte: Sie können am 1. Februar bei mir eintreten. Das war natürlich eine unbezahlte Stelle. So wurde ich also Volontär bei Paul Vogel. Das war schon was.
WEICHELT: Hatte man da schon eine gewisse Verantwortung?
JANZ: Der Stationsarzt, den ich damals hatte, war ein Ukrainer, der schon im Krieg bei Vogel war, ein kluger und auch guter Arzt. Bei dem machte man zunächst einmal die Visiten mit. Man guckte zu, wie der andere untersuchte, und schrieb die Krankengeschichte auf. Kamen neue Patienten, schrieb man die nächste Krankengeschichte. Dann untersuchte man selbst, und so kam man hinein und war sehr bald ein Helfer des Stationsarztes. So ein Stationsarzt hatte vielleicht noch zwei solche Volontäre, so war man zu dritt. Und hatte eine Station von 24 Betten. Das war die Struktur. Das Haus hatte vier solcher Stationen. Diese 24 Betten standen alle in je einem Saal. Und so hatte ich jahrelang die Möglichkeit zu sehen, wie die Patienten miteinander umgehen, wie die Schwestern mit den Patienten umgehen, wie die Ärzte mit den Patienten umgehen. Das sieht man ja bei 24 Betten – wenn man seinen Tisch in der Mitte dieses langen Bettentraktes hat –, und man kann seine Beobachtungen machen. Alle passen auf. Dennoch ist es enorm diskret. Als wären unsichtbare Vorhänge zwischen den Betten. Aber es passiert natürlich viel. Der eine bekommt Besuch, der andere nicht. Der eine weint, der andere lacht, alle diese Dinge. Man bekam viel mehr Lebensäußerungen mit als heute in den Krankenzimmern. Heute hat ein Krankenzimmer zwei oder drei Betten. Dann ist man da diese fünf oder zehn oder fünfzehn Minuten in einer im Grunde künstlichen Atmosphäre, denn alle wissen, jetzt ist der Arzt da. Aber seien Sie mal mit 24 Menschen zusammen und das über mehrere Stunden.
WEICHELT: Das ist schon eine Art Gemeinschaft, die sich auch irgendwie organisieren und disziplinieren muß.
JANZ: Nun sind zwar nicht alle bettlägerig, aber viele. Es ist ein gemeinsamer Raum und ein wechselseitiges Aufeinander-Rücksicht-Nehmen. Oder eben nicht Rücksicht nehmen. Beides hat Folgen für die Diagnose, für die Behandlung, für den Umgang. Ich sage dieses Weizsäckersche Wort Umgang, weil es alles einbezieht, Diagnose, Therapie, Gespräch, Verhalten usw. Nach sechs Wochen hat Paul Vogel zu mir gesagt, er möchte, daß ich mich für das Sommersemester auf ein Referat über eine Vorlesung von Weizsäcker »Über die ärztliche Grundhaltung« vorbereite. Sechs Wochen hatte ich Zeit. Und habe dieses Referat gehalten, das war 1946. Ich besitze den Text noch. Er wurde vor einer Weile abgedruckt, zusammen mit der Vorlesung von Weizsäcker. Und dann, nach diesem Referat, mit dem Vogel offenbar zufrieden war, sagte er: Gut, machen Sie so weiter. Versuchen Sie sich einzulesen und einzuarbeiten. Ich möchte zwei Jahre nichts Schriftliches von Ihnen sehen.
WEICHELT: Das war keine Empfehlung, sondern eine Anweisung.
JANZ: Eine Anweisung, ja. Das heißt, zwei Jahre haben Sie Zeit.
WEICHELT: Aber Sie sollten nicht untätig sein.
JANZ: Nein, nein. Mit nichts Schriftliches war gemeint: keine wissenschaftliche Arbeit. Gemeint war: Machen Sie so weiter. Lernen Sie Neurologie. Untersuchen Sie. Benutzen Sie die Bibliothek. Wir hatten eine ganz gute Bibliothek in der Klinik, den ganzen Freud. Der war auch über die Nazijahre da, die große blaue Ausgabe. Da habe ich vieles – ich will nicht sagen alles – gelesen. Das war neben dem Handbuch für Neurologie eine Grundnahrung für mich, das kann ich schon sagen. Aber die Sache mit den zwei Jahren nichts Schriftliches von Ihnen hören, das ging ja nach zwei Seiten.
WEICHELT: Man wird freigestellt, aber auf ein Ziel hin.
JANZ: So ist es. Und so habe ich es auch empfunden. Ich habe es als Glücksfall angesehen, zwei Jahre lang nur studieren zu können.
WEICHELT: Ohne das sofort verwerten zu müssen.
JANZ: Ja, genau. Ohne es unmittelbar auswerten zu müssen. Das gehört für mich zu den beeindruckenden pädagogischen Leistungen von Paul Vogel. Ich erinnere mich noch an etwas, das dazu paßt. Als Weizsäcker elf Jahre später starb, hat Vogel mich morgens in sein Dienstzimmerchen gerufen und gesagt: Nehmen Sie Platz. Herr von Weizsäcker ist heute nacht gestorben. Das war die Mitteilung, die er mir gemacht hat. Ich habe dazu nichts sagen können außer: Ja, was wird denn nun aus seinem ganzen Werk? Da sagte er: Das muß erst mal alles in die Katakomben.
WEICHELT: Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was man erwarten würde.
JANZ: Ja, das hatte wieder etwas Kryptisches. Ich habe mir wirklich oft Gedanken darüber gemacht. Na gut, ich wußte, daß man jetzt nicht viel darüber redete, daß man zusah, ob das gärt, ob sich das von selbst bewegt. Aber woran merke ich das? Wo muß ich hinschauen? Wo muß ich hinhören? Nichts darüber. Katakomben – da weiß keiner, wie und wann das wieder rauskommt. Aber man weiß, daß es rauskommt. Das war auch wieder so ein Rat.
WEICHELT: Die normale Reaktion wäre zu sagen: Jetzt ist er gestorben. Wir müssen uns um das Werk kümmern. Wir müssen Editionen machen. Aber Vogel sagte das Gegenteil. Hat Ihnen das eingeleuchtet?
JANZ: Das hat mir sehr eingeleuchtet. Einerseits ist es entlastend, andererseits nimmt es einen in die Pflicht. Man bestimmt den Zeitpunkt mit, wann es hochgeholt wird – wie es dann auch geschah.
WEICHELT: Man muß eine Sache erst mal loslassen und sie sich dann wieder zu eigen machen, ganz im Goetheschen Sinne: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Aus dem Bild der Katakombe spricht ja auch die Überzeugung vom hohen geistigen Wert des Weizsäckerschen Werks.
JANZ: Katakomben sind Orte zeremonieller Bewahrung. Was hier lagert, gewinnt spirituelle Existenz.
WEICHELT: Wie waren Ihre ersten Erfahrungen als Arzt?
JANZ: Ich erzähle Ihnen eine symptomatische Begebenheit. Es ist Ausgang Winter. Zwei uns bekannte Männer im mittleren Lebensalter kamen verletzt aus dem Skiurlaub. Der eine hatte sich den Arm gebrochen, der andere hatte einen bandagierten Fuß. Und in beiden Fällen habe ich gefragt, wie das passiert ist. Ach, sagt der eine, ich bin zu schnell den Hang hinuntergefahren, plötzlich bin ich gestürzt. – Warum sind Sie denn so schnell gefahren? – Ja, es war schon Abend, und die anderen waren alle schon unten. – Wer waren denn die andern? – Mein Sohn und seine Freundin und noch ein paar andere. – Ach, Sie waren mit dem Sohn zusammen? Wie alt ist der denn? – Der ist jetzt fünfzehn. – Kann der gut Ski laufen? – Er kann jetzt besser Ski laufen als ich. Der war sofort unten. – Sind Sie zusammen losgefahren? – Ja, es war schon spät und da sind wir sofort los, und kaum hatte ich mich besonnen, war er schon unten. Ja, und dann bin ich halt gestürzt. – Wollten Sie ihm denn hinterher? – Na klar doch. So. Das ist die eine Geschichte. Die andere war ganz ähnlich. Gut. Das war jetzt die Anamnese. Aber was man braucht, ist die Souveränität, nichts für Zufall zu halten. Daß der geschiente Arm und das bandagierte Bein nicht von ungefähr kommen.
WEICHELT: Ist es eine Entscheidung, zu sagen, wir halten nichts für Zufall, oder ist es eine Überzeugung? Ist es eine philosophische oder eine therapeutische Frage? Oder ist es Erfahrung?
JANZ: Es ist eine aus der Überzeugung entwickelte Erfahrung und eine aus der Erfahrung entwickelte Überzeugung.
WEICHELT: Mir scheint, es geht hier nicht nur um interessante, sondern auch um rätselhafte Zusammenhänge, das hat ja fast schon etwas Künstlerisches.
JANZ: So ist es. Das ist genau der richtige Begriff. Es ist das Verhältnis zum Rätsel, was zu dieser Art von Fragen führt. Es gibt ja Rätsel, die man nicht lösen kann, und es gibt Rätsel, die man lösen kann. Die Lust ist ein künstlerisches Moment. Die Lust an der Enträtselung, die Lust am Finden von Zusammenhängen, da fängt es an, und das geht natürlich weit über den Verstand und die Empirie hinaus. Am Anfang steht immer die Frage: Warum ist dieser Mensch krank und warum wird er nicht wieder gesund? Darauf muß man neugierig sein. Und um zu Antworten zu kommen, braucht man eine Begabung zum Assoziativen. Eine Begabung des Verbindens. Das Befriedigende daran ist dieses Spiel von Neugier und Finden.
WEICHELT: Heißt dieses Finden nicht in gewissem Grade auch, daß die gefundene Wahrheit nicht mehr die einzige ist, sondern nur die Ihnen gemäße?
JANZ: Nein, nein, nur die Methode ist die mir gemäße. Die Wahrheit ist die dem Patienten gemäße. Ich habe es oft erlebt, daß Väter sich mit ihren Söhnen messen. Und zwar immer dann, wenn die Söhne an ihnen vorbeizogen, und die Väter, die noch jung sein wollten, ihre Söhne in die Schranken zu verweisen suchten. Und das geht irgendwann schief. Dann muß man diese Erfahrung zu einer Erkenntnis machen, und zwar verbunden mit dem entsprechenden Genuß, zu einer Erkenntnis gekommen zu sein. Und einen bestimmten Vorgang, zum Beispiel den erwähnten Skiunfall, zu einer Erkenntnis zu machen, das ist schon das Medizinische, das Therapeutische. Mit Paul Vogel war übrigens jede Visite reizvoll. Es gab viele neurologisch interessante Fälle. Zum Beispiel folgende Geschichte: Vogel unterhält sich mit einem Patienten, weil er mit der Symptomatik nicht ganz klarkommt. Er läßt ihn aufstehen, ein paar Schritte gehen, wieder zurückkommen, auf dem einen Bein stehen, auf dem anderen Bein stehen usw. Dann unterhält er sich einen Moment mit ihm. Dann läßt er ihn wieder ins Bett gehen. Vogel geht zum nächsten Patienten. Am Ende der Visite treffen wir uns draußen auf dem Gang, und da sagt er zum Stationsarzt: Sie, hören Sie mal, der da im dritten Bett hinten, den ich habe gehen lassen, das ist doch eine Geschichte. Erzählen Sie mir die mal bei der nächsten Visite. Da hat man genau gewußt, was er wollte, wenn man das hörte. So wurde man mit dem Auftrag entlassen, die Geschichte rauszukriegen. Das heißt also, Vogel wollte, daß man sich mit dem Patienten hinsetzt und ins Gespräch kommt. Um rauszukriegen, was für eine Geschichte hinter der Krankheit steckt. Vogel hat auch ein Seminar mit Medizinstudenten über Krankheiten als literarische Gattung gemacht, also Leidensformen, Krankheitsformen, Genesungsformen in Analogie zu literarischen Formen.
WEICHELT: Darf ich noch mal auf die Frage nach dem Zufall zu sprechen kommen? Es ist doch ein starker Hang in der Weizsäckerschen Medizin, allem Geschehen einen Sinn zuzuordnen, in allem, was passiert, einen Sinn zu entdecken. Das ist ja fast ein theologischer, religiöser, ja, künstlerischer Grundzug dieser Medizin. Sie sagten: Souveränität heißt, nichts für Zufall zu halten. Also alles in einen übergeordneten Rahmen zu stellen, in eine Lebensgeschichte einzubetten, und jeden Beinbruch, jede Angina, alles was einem passiert, zum Teil der Lebensgeschichte zu machen.
JANZ: Warum sagen Sie machen? Wenn es doch ein Teil ist?
WEICHELT: Machen sage ich, weil ich glaube, daß es vom Patienten her ein aktiver Vorgang ist. Was Kranksein für den einzelnen heißt, muß er selber herausfinden. Er muß selber verstehen, was dahintersteckt. Und deswegen ist es so – das meinte ich mit künstlerischem Grundzug –, daß jeder aufgerufen ist, seine eigene Lebensgeschichte, seine eigene Lebenserzählung zu entwerfen und alles, was ihm auf dem Lebensweg begegnet, zum Teil dieser Geschichte zu machen.
JANZ: Was Sie sagen, entspricht auch einer Grundvoraussetzung der anthropologischen Medizin, daß nämlich der Patient seine Krankheit nicht nur erfährt, sondern auch macht. Wenn es so ist, dann ist es doch sinnvoll, den Teil, den er dazu beiträgt, herauszubekommen, schon im Sinne der Prävention, daß sich das nicht wiederholt. Den Zufall können wir uns hierbei gar nicht leisten. Sie vielleicht können sich den Zufall leisten, weil Sie nicht wie ich von Berufs wegen mit der Frage befaßt sind, wo kommt das her. Sie können zu dem verunglückten Skifahrer sagen: das war Zufall. Wenn Sie aber Orthopäde sind oder Unfallchirurg, und der Mann kommt zu Ihnen und sagt: Verflixt noch mal, das hätte ich nicht tun sollen. Ich bin doch schon ein alter Knopp. Als Arzt muß ich doch sehen, daß dieser Mensch unruhig ist und wissen möchte, wo die Sache herkommt. Und so mache ich mich ans Erkennen, ans gemeinsame Erkennen im Gespräch, und ich werde es auch hinnehmen, wenn ich zu keinem Ergebnis komme. Denn es ist selbstverständlich so, daß man in einer großen Zahl von Fällen nicht weiterkommt. Und trotzdem hat man den Versuch gemacht, ein paar Schritte ist man gegangen auf diesem Weg, es war aber nichts zu finden. Und doch würde ich sagen, daß auch in einem solchen Fall nicht der Zufall regierte. Das ist ein methodisches Axiom. Davon muß ich ausgehen. Wenn ich es nicht tue, bevorzuge ich den einen Patienten und benachteilige den andern. Ich sehe auch gar keinen Grund, warum ich als Arzt dem Zufall soviel Gewicht geben sollte. Das würde mich nur dazu verleiten, die eigenen Denkdefizite und damit die des Patienten zu einer objektiv begründeten Erkenntnisschranke zu erklären, und das scheint mir philosophisch nicht richtig zu sein. Es gibt doch gute Beispiele, nehmen wir die Fettsucht. Es wird ja überall besprochen, daß die Männer zu dick oder die Frauen zu dick sind und daß das bedenklich ist. Wo fängt die Fettsucht an? Von wo an ist es eine Krankheit? Wir wissen, daß hier ein Fehlverhalten eine Rolle spielt. Anfänglich gehen diese Leute nicht zum Arzt, weil sie wissen, daß sie ihr Verhalten zwar ändern sollen, aber nicht ändern können. Nun ist ganz klar: wenn so jemand zum Arzt kommt, müßte der ihm nicht bloß eine Diät verordnen oder ihm sagen, iß nur die Hälfte, sondern er müßte an die Quellen seines Fehlverhaltens herankommen, die möglicherweise in einem Umfeld liegen, für das er nichts kann, das er auch nicht ändern kann, es sei denn, er geht da heraus. Es liegt auch zum Teil an einer Unterentwicklung des ästhetischen Bewußtseins. Man kann sich am Beispiel der Fettsucht gut klarmachen, was ein Arzt, wenn er tatsächlich gebeten wird zu helfen, eigentlich tun müßte. Er müßte als erstes sagen: Wollen Sie wirklich? Das müßte die Grundfrage sein. Und meistens kommen beim Patienten dann die Zweifel.
KLEINSCHMIDT: Er könnte auf die Frage doch antworten: Wenn ich hinterher so gut aussehe wie Sie, Herr Doktor, ja, dann will ich.
JANZ: Da würde ich sofort einsteigen. Auf eine solche Bemerkung würde ich sagen: Legen Sie Wert darauf, gut auszusehen? Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Laufen Sie da nackt herum? Vor wem genieren Sie sich, vor wem nicht? Das Genieren würde ich ansprechen, ich würde ihn auch im Genieren bestärken. Das meinte ich mit dem Ästhetischen.
KLEINSCHMIDT: Sie sollten uns noch erzählen, wie Sie zu Ihrem Spezialgebiet, zur Epileptologie, gekommen sind.
JANZ: Nachdem die zwei Lehrjahre, in denen Vogel »nichts Schriftliches« von mir sehen wollte, herum waren, holte er mich 1948 zu einem intimen pädagogischen Gespräch in sein Zimmerchen und sagte: Ich meine, Sie könnten sich jetzt mal mit etwas Wissenschaftlichem beschäftigen. Ich möchte Ihnen vorschlagen, sich um Epilepsie zu kümmern. Es ist einfach so, daß das, was die Patienten von ihrer Krankheit wahrnehmen, nicht in den Lehrbüchern steht. Und was in den Lehrbüchern steht, sich nicht mit dem deckt, was die Patienten berichten. Wenn wir sie fragen, was sie von ihren Anfällen merken, vor allem was sie merken, wenn ein Anfall kommt, dann berichten sie oft erstaunliche Dinge. Vogel hat mich also auf die epileptische Aura verwiesen, auf die Sinneswahrnehmungen vor dem Anfall. Darum sollte ich mich kümmern, und zwar mit der Begründung, daß er die Aura für einen Schlüssel halte zum Verständnis sowohl der Patienten wie des Wesens von Epilepsie. Das war der Einstieg. In den Lehrbüchern steht, es gibt optische, es gibt akustische, es gibt vestibuläre, den Gleichgewichtssinn betreffende Auren. Und so hat man die Selbsterfahrung der Patienten wie die komplexe Natur ihrer Wahrnehmung immer in irgendeine vorgefertigte Schublade geschoben. Das hat Vogel nicht gemocht. Und ich fand das natürlich toll, daß es so einen Chef gibt, der sich freimacht von vorgefaßten Lehrbuchmeinungen. Ich meine, wenn das ein Philosoph gewesen wäre, von dem verlangt man so was geradezu. Aber ein Mediziner, ein Klinikchef – da habe ich die richtige Wahl getroffen. Der läßt einen selber marschieren. Und wenn was rauskommt, ist es gut. Und wenn nichts rauskommt, auch gut. Das hat man selbst zu verantworten.
WEICHELT: Und kam dann was raus?
JANZ: Ich denke schon. Um auf die Frage einzugehen, mußte ich erst mal in Erfahrung bringen, was Epilepsie ist und was nicht. Nach zwanzig Jahren Befragung, Beobachtung und Behandlung kam dann ein Buch darüber heraus, das dreißig Jahre später unverändert wieder aufgelegt wurde. Aus dem Dickicht, wie es mir anfänglich aus der Fachliteratur entgegenkam, ist so mit Hilfe der Patienten allmählich eine überschaubare Landschaft geworden, mitteilbar gegliedert, lehrbar – mit dem Ergebnis: Die Epilepsie gibt es nicht, es gibt eine Vielfalt von Epilepsien, jede von eigener Art, unterschieden nach Selbsterfahrung und Symptomatik, diagnostischem Zugang und therapeutischem Umgang.
WEICHELT: Und sind Sie mit der epileptischen Aura weitergekommen?
JANZ: Nein, nicht ganz. Das Ordnungsgeschäft hat diese Frage in den Hintergrund gedrängt. Ich hatte jedoch in besagtem Buch auf das wortreich Unbeschreibliche in der Aura von Patienten mit temporaler (Schläfenlappen-)Epilepsie hingewiesen. Daraus hat sich ein interdisziplinäres Projekt entwickelt, das zu einem klinisch und hirnlokalisatorisch nützlichen Unterscheidungskriterium geführt hat, das sich mit technischen Methoden durchaus messen kann. Auf seine ursprüngliche Frage hat Paul Vogel sich dann selbst am Beispiel der Aura von Dostojewski eine großartige Antwort gegeben in seinem Aufsatz »Zur Selbstwahrnehmung von Epilepsie. Der Fall Dostojewski«.
KLEINSCHMIDT: War Ihnen Dostojewski ein guter geistiger Partner bei der Erforschung von Epilepsie?
JANZ: O ja, das kann man wohl sagen.
KLEINSCHMIDT: Erzählen Sie bitte.
GABRIELE JANZ: Darf ich anfangen? Interessant an Dostojewski ist, daß er mehrere Krankheiten hatte, Atembeschwerden, Kreislaufbeschwerden, auch ein Lungenemphysem. Wegen seiner epileptischen Anfälle ist ihm gesagt worden: Sie dürfen nicht mehr schreiben. Er stand vor der Entscheidung: Bleibe ich Dichter oder werde ich gesund. Das ist nicht nur bei Dostojewski ein interessantes Problem, auch bei Rilke. Lou Andreas-Salomé empfahl Rilke, zu Gebsattel zu gehen, dem berühmten Viktor Emil von Gebsattel, und das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, wenn ich dorthin gehe, werde ich psychoanalysiert. In einem Brief an Gebsattel schreibt er am 24. Januar 1912: »Vielleicht sind gewisse meiner neulich ausgesprochenen Bedenken sehr übertrieben; so viel, wie ich meine, scheint mir sicher, daß, wenn man mir meine Teufel austriebe, auch meinen Engeln ein kleiner, ein ganz kleiner (sagen wir) Schrecken geschähe, – und – fühlen Sie – gerade darauf darf ich es auf keinen Preis ankommen lassen.« Und so war das auch bei Dostojewski. Er hat jedenfalls weitergeschrieben und weitergeschrieben. Seine Frau hat gemerkt, wenn etwas im Anzug war, er war dann besonders im Streß. Er litt ja eindeutig an Epilepsie.
DIETER JANZ: Dostojewskis Frau hat einen Anfallskalender geführt, mit Hunderten von Anfällen, alle mit Datum verzeichnet. Aber er hat sich nicht behandeln lassen. Als sie einmal in Genf waren, bekam er eines Abends eine furchtbare Atemnot und mußte unbedingt in Behandlung. Und so ist er nachts noch raus auf die Straße zu einem Arzt, der ihm irgendwas gegeben hat. Und der Arzt hat ihn natürlich befragt. Dostojewski sah sich gezwungen, ihm zu erzählen, daß er häufig epileptische Anfälle bekommt. Der Arzt sagte: Das können wir jetzt nicht besprechen, es ist viel zu spät, aber kommen Sie morgen bitte wieder. Keine Rede davon, daß Dostojewski noch einmal kam. Seine Atembeschwerden waren vorbei. Auch in Berlin ist er deswegen einmal zu Gespräch mit Dieter Janz 197 einem berühmten Internisten gegangen. Im Wartezimmer hat er noch ein paar Mitpatienten gefragt, was muß man denn bezahlen? Fünf Minuten war er bei ihm drin – diese Fünfminuten-Medizin gab es offenbar schon zu Dostojewskis Zeiten. Der Arzt klopft ihn ab und sagt: Sie müssen zur Kur nach Bad Ems. Ich habe da einen Kollegen, dem schreibe ich. Richten Sie ihm Grüße von mir aus. Er gab ihm die Adresse von dem Kollegen. Dostojewski ist nicht nur einmal, er ist dreimal nach Bad Ems gefahren. Alles nur Erdenkliche hat er dort gemacht, sogar Kaiser Wilhelm getroffen. Aber für seine Epilepsie hat er nichts gemacht. Nichts! Ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten. Da beschreibe ich seine Epilepsie in Sibirien. Sie wissen ja, er war verbannt und wollte wieder nach Petersburg, wollte wieder schreiben. Er hatte ja Berufsverbot, er durfte aus politischen Gründen nicht schreiben. Und immer wieder fragt er sich, wie erreiche ich nur, daß ich hier wegkomme. Schließlich konsultiert er einen Arzt, und der sagt ihm, er habe eine genuine Epilepsie. Und da protestiert er. Genuine Epilepsie! Ihm kam es darauf an, daß ihm bescheinigt wird, seine Epilepsie sei durch die Qualen seiner Haft entstanden. Auf der Rückreise nach Petersburg konsultiert er erneut einen Arzt, weil er wieder Anfälle hat. Und der sagt ihm, er müsse aufhören zu schreiben, das wäre das einzig Richtige. Das muß man sich mal vorstellen: Ein aus der Verbannung entlassener junger Mann kommt wieder zurück in die Gesellschaft. Was er geschrieben hat, ist noch nicht bekannt. Und er geht zu einem Arzt und sagt, er hätte immer epileptische Anfälle unter diesen Bedingungen. Der Arzt fragt, was sind Sie denn von Beruf? – Ich bin Schriftsteller. – Wann schreiben Sie denn? – Immer nachts. – Dann hören Sie damit auf. Und seither hat Dostojewski keine Ärzte mehr deswegen konsultiert.
GABRIELE JANZ: Meine Frage an Sie beide ist: Was denken Sie, warum hat dieser Arzt ihm verboten zu schreiben?
WEICHELT: Spontan würde ich sagen, daß Schreiben eine Art Verausgabung ist, die zur Erschöpfung führt und einen so schwächt, daß man krank wird.
GABRIELE JANZ: Aber Verausgabung und Schwächung können in jedem Beruf passieren.
WEICHELT: Ja, gut, wenn Dostojewski 100-m-Läufer gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich immer wieder versucht, 100-m-Läufe zu machen.
GABRIELE JANZ: Würden Sie das auch so sehen?
KLEINSCHMIDT: Ich kann die Frage nicht beantworten, es wäre reine Hochstapelei, wenn ich es täte, denn ich weiß zu wenig über Epilepsie. Platonisch betrachtet könnte man vielleicht sagen: Im geistigen Universum war eine Stelle unbesetzt, nämlich die, daß einer die Epilepsie von innen schildert, und zwar ein Schriftsteller, ein Sprachmeister, ein Denker. Dostojewski ist gleichsam der Phänomenologe dieser Krankheit. So gesehen durfte er nicht aufhören zu schreiben. Diese Stelle im Kosmos durfte nicht unbesetzt bleiben. Und Dostojewski wollte sie um jeden Preis besetzen, selbst wenn er dabei draufgegangen wäre.
GABRIELE JANZ: Ich glaube, daß Dostojewski mit Herzblut geschrieben hat. Wenn man das ohne Hilfe und ohne psychotherapeutische Begleitung tut, setzt man sich unglaublich aus. Man ist äußerst verletzbar und vollkommen ungeschützt. Und das ist es, was bei Dichtern und Schriftstellern generell der Fall ist. Das haben die Ärzte nicht bedacht. Sie haben nur gedacht, daß es besser für Dostojewski sei, wenn er überhaupt nicht schriebe. Dann könnte er ein ruhiges Leben führen.
KLEINSCHMIDT: Dann wäre er an etwas anderem erkrankt. Alle künstlerische Produktion speist sich aus seelischen Spannungen, die im Leben nicht auflösbar sind. Schreiben ist eine Art ständiges Gespräch zwischen Ich und Welt, um die rumorenden Dinge zum Ausgleich zu bringen. Das muß man natürlich von Fall zu Fall betrachten. Fest steht nur eins: Wenn man einen genuinen Autor am Schreiben hindert, wird er ganz gewiß krank, davon bin ich überzeugt. Und leider wird er umgekehrt oft auch vom Schreiben krank, denn das Schreiben ist ein Opfergang. Schreiben verzehrt das Leben.
DIETER JANZ: Jetzt sagen Sie es. Das ist bei Dostojewski so gewesen. Und Dostojewski hat tatsächlich diesen Opfergang angetreten, er hat das Opfer auf sich genommen. Denn es kam ihm wirklich darauf an, das hat er oft ausgedrückt, sein Volk, seine Nation geistig zu re-novieren, mit einem religiösen Impetus zu befeuern und geradezu zu heiligen. Er war wie besessen davon. Das ist das, was sowohl Westler wie Kommunisten an ihm nicht verstanden haben. Es klang christlich, aber es war national.
WEICHELT: Von der Epilepsie gibt es auch im »Idioten« eindrucksvolle Schilderungen. Fürst Myschkin ist ja quasi eine Jesusfigur, die Epilepsie hat bei ihm Züge von heiliger Ekstase. Was haben Sie von Dostojewski über die Krankheit gelernt? JANZ: Das Epileptologische im engeren Sinne hat mich stark interessiert, weil es fabelhaft beschrieben ist, in einer Weise, wie man es kaum oder nie von einem Patienten beschrieben bekommt. Ich habe ja 1969 mein Opus magnum, »Die Epilepsien. Spezielle Pathologie und Therapie«, drei Lehrern gewidmet, meinem klinischen Lehrer, meinem wissenschaftlichen Lehrer und meinen Patienten.
WEICHELT: Also Vogel, Weizsäcker und …
JANZ: Dostojewski. Weil er wirklich als Patient unglaublich ausführlich, genau und überzeugend war, und weil seine Beschreibung der Epilepsiegestalten in seinem Werk zusammengenommen eine im Weizsäckerschen Sinne ideale Krankengeschichte ausmacht.
KLEINSCHMIDT: Herr Janz, Sie sind jetzt über neunzig Jahre alt. Ich bin so naiv zu glauben, daß das Alter auch Vorzüge hat. Zum Beispiel den Vorzug zunehmender Freiheit.
JANZ: Absolut, und zwar in großem Maße. Es erweitern sich die Räume in Richtungen, die man sich immer gewünscht hat. Natürlich treten auch Mängel ein. Für mich besonders der Mangel, daß keine Patienten mehr zu mir kommen. Die neuen Freiheiten sind nicht so sehr die des ausgiebigen Reisens und auch nicht des späten Aufstehens, denn längeres Schlafen ist im Grunde verlorene Zeit. Oft denke ich mir: Mein Gott, was habe ich für einen Reichtum an Möglichkeiten. Ich kann lesen, wonach mir der Sinn steht, habe Zeit, mit Menschen zu sprechen, Freunde zu besuchen und Freunde zu empfangen, habe Muße, mein Archiv zu ordnen, Editionen zu planen und zu realisieren, mich an unserem Garten zu erfreuen, einen guten Wein zu trinken, ich fahre dann und wann zu einer Tagung, halte hin und wieder einen Vortrag, gelegentlich ein Seminar mit Studenten hier in meinem Haus, und pflege im übrigen die behagliche Geselligkeit. Obgleich im Hintergrund stets der Gedanke steht, hätte ich nur die Freiheit der vielen Möglichkeiten und müßte nicht auch etwas Bestimmtes tun, weil es von irgendwoher von mir verlangt wird, bekäme ich ein schales Gefühl von diesem Reichtum. Wenn man aufhört, im Beruf zu stehen, und wenn man ein solches Alter erreicht hat wie ich, hat man zunehmend das Gefühl, man überlebt andere. Und es kommt vor, daß man sich fragt, wie man das rechtfertigen will. Und gerechtfertigt ist es ja nur, wenn man etwas Sinnvolles damit anstellt.
KLEINSCHMIDT: Nun gut, es gibt die Pflichten, auch die familiären Pflichten, die lassen wir jetzt mal beiseite, das ist ja selbstverständlich. Man tut sie übrigens gern. Sie sind der Grundstock des Sinnvollen, obwohl es, wie jeder weiß, auch sinnlose Pflichten gibt. Was wäre denn generell das Sinnvolle, sagen wir in der geistigen Beschäftigung? Daß man sich anregen läßt durch Bücher und Gespräche und auf diese Weise versucht eine produktive Existenz zu haben, daß man versucht, auch bei nachlassenden Kräften ein schöpferischer Mensch zu bleiben? Oder ist es mehr etwas Thematisches, nach dem Motto, vor zehn Jahren habe ich mich noch für dies und das interessiert, jetzt interessiert mich was ganz anderes. Was bedeuten würde, daß das Alter selbst neue, ihm gemäße Themen anbietet. Und daß sich je nach Lebensstufe neue Wahlverwandtschaften bilden, auch im Gespräch, das die Seele mit sich selbst führt.
JANZ: Produktiv bleiben ist ein guter Begriff, aber es muß nicht schriftstellerisch gemeint sein. Ich beneide im Augenblick meine Frau, die hier in der Kirchengemeinde in einem Kreis mitmacht, wo sie zu Geburtstagen ältere Leute besuchen und Gespräche mit ihnen führen. Und dann kommt sie zurück und erzählt mir davon. Wir haben Jahrzehnte in Nikolassee gewohnt, ohne irgendeine Notiz zu nehmen von den Menschen um uns herum, und das ändert sich jetzt, und ich werde auch mit einbezogen, und das ist schön. Und es bietet auch neue Möglichkeiten für mich, produktiv zu sein. Da sind ja Menschen, die krank werden, abbauen, man bekommt einerseits einen gewissen Spiegel vorgehalten, andererseits kann man aus seiner langen ärztlichen Erfahrung einiges freundschaftlich zum Gespräch beitragen.
KLEINSCHMIDT: Mir gefällt, was Sie sagen. Ich hatte im stillen gerade gedacht, daß Sie ein zur Freundschaft begabter Mensch sind. Und auch begabt zur Freundschaft mit sich selbst. Das merkt man ja. Das heißt ja nicht, daß Sie nicht gelegentlich auch Selbstzweifel haben, aber es heißt, daß Sie alles in allem mit sich auf gutem Fuße stehen.
JANZ: Ja, das ist richtig, auch was die Selbstzweifel betrifft. Ich vermittle diesen Eindruck, das weiß ich. Meine Mutter hat mich immer als Sonntagskind bezeichnet.
KLEINSCHMIDT: Und Sie sind eins?
JANZ: Ich glaube, ich bin eins. Mit der Freundschaft, da haben Sie ganz recht. Mein eigentlicher Urfreund ist vor acht Jahren gestorben. Wir hatten eine sehr enge Beziehung und gehörten über Jahrzehnte zu einem Kreis von Freunden. Einer davon war übrigens Wolfgang Frommel, der Stefan-George-Bewunderer und Gründer der Zeitschrift »Castrum Peregrini«. Dieser Kreis war maßstabsetzend, nicht nur in Sachen Freundschaft, auch was Gespräch und Geselligkeit betrifft. Ich habe mich immer daran zu halten versucht, auch Jüngeren gegenüber. Wenn ich auf meine alten Tage mit Studenten ein häusliches Seminar mache, fragen die mich hinterher, warum machen Sie das eigentlich? Die verstehen das zunächst gar nicht. Oder sie wundern sich. Und dann freuen sie sich. Und daran merke ich, daß es richtig ist, was ich tue. Ich bin erstaunt, daß es nicht mehr Ältere tun. Sich in Beziehung setzen zu Jüngeren und mit ihnen ins Gespräch kommen, ich weiß, daß ich das kann, und das würde ich auch gerne fortsetzen.
KLEINSCHMIDT: Das versteht man ja gut. Es ist auch nicht nur Selbstloses dabei. Ich bin nicht so alt wie Sie, aber weiß natürlich auch schon, daß das eigene Lebensgefühl austrocknet, wenn man nur mit Gleichaltrigen verkehrt. Man erlebt gar nicht mehr, zu welchen Sachen man eigentlich noch in der Lage ist. Aber wenn man mit Jüngeren in einem guten, offenen Verhältnis steht, dann entlocken sie einem Dinge, von denen man gar nicht ahnte, daß man die draufhat. Und so regen nicht nur die Jungen die Alten, sondern gelegentlich auch Gespräch mit Dieter Janz 201 die Alten die Jungen an, so daß auch sie Dinge sagen, die ihnen unter ihresgleichen nicht eingefallen wären. Die Existenz der Menschheit in Generationen, die Gleichzeitigkeit der Lebensalter, ist etwas sehr Schönes und Wertvolles, eine Konstruktion, die ihren Schöpfer ehrt. Leider kommen ihre produktiven Seiten unter dem allgemeinen Zeitdruck viel zu wenig zum Zuge.
WEICHELT: Als Sie von den Freiheiten des Alters sprachen, Herr Janz, habe ich als Gegenmodell an diejenigen denken müssen, die immer sagen, es gibt nichts Gutes am Alter. Alles, was man Gutes über das Alter sagt, ist Lüge. Das Alter – das sind Lasten, Trübsal und das Ende. Mich hat überrascht, daß Sie nicht von der Gesundheit gesprochen haben. Die ist doch bei vielen alten Menschen das Beherrschende.
JANZ: Das belastet mich etwas, daß Sie mich jetzt als Modell nehmen. Aber ich bin ja nicht allein, bei mir muß man meine Frau mit dazunehmen. Allgemein gesprochen: Dieses Lebensmodell, mit jemandem zusammen zu leben, auch wenn es privat öfters mal knirscht, aber eben zusammen zu sein und vor allem zusammen zu bleiben, also zu seiner Wahl zu stehen, das geht nur, wenn man, wie vorhin gesagt, mit sich selbst befreundet ist und bleiben will. Die Psychoanalyse sieht darin vielleicht ein Bezähmen der Angst des Scheiterns durch gewaltsame Positivität. Aber ich glaube nicht, daß es so ist. Man ist doch irgendwie geeicht auf ein gelingendes Leben. Man hat es schon als Kind erlebt, daß das Gelingen mehr Freude macht als das Mißlingen, und deshalb will man kein Scheitern. Aber es gibt so viele Fallen. Die Welt der Reize, erotische, sexuelle, jederzeit neu und lebendig, stets wirksam, von der Jugend bis ins hohe Alter, immer wieder wird man in die Lage versetzt, damit umzugehen und damit fertig zu werden. Das ist eine der Konstanten des Lebens. Und wenn es in den alten Kirchenliedern heißt, man soll Versuchungen widerstehen, dann weiß ich schon, wovon die Rede ist.
WEICHELT: Die ja auch ihren Sinn haben als belebendes Element.
JANZ: Ja, natürlich haben sie das. Aber je mehr einer erlebt, desto mehr wird er auch bedroht. Belebung und Bedrohung sind sich da sehr nah.
WEICHELT: Alles andere wäre ja reine Abschottung, Kasteiung und auch eine Form von Lebensschwäche.
KLEINSCHMIDT: Wir wollen nicht hoffen, daß Belebung und Bedrohung immer Hand in Hand gehen, sondern daß es auch Momente von Belebung gibt, die nicht bedrohlich sind. Oder? Ich habe im stillen gerade gedacht, aha, und wenn man dem Heiligen Geist begegnet? Das belebt doch, nicht wahr? Und ist das auch eine Bedrohung? Da könnten Sie natürlich antworten, allerdings, das wäre auch eine Bedrohung, und was für eine. So gesehen würde ich Ihnen zustimmen. Ich finde Ihre Formel sehr anregend. Es gibt einen Text von Botho Strauß, der heißt »Theorie der Drohung«. Da geht es um drohen, bedrohen, bedroht werden und bedroht sein. Das ist keine Theorie, sondern eine Erzählung. Und Sie haben uns jetzt eine »Theorie der Belebung« vorgeschlagen, der geradewegs eine »Theorie der Bedrohung« entspricht. Sie sind ein Freund dialektischer Pointen.
JANZ: Nun ja, einen ganz so ausschließlichen Charakter hat das vielleicht nicht, jedenfalls nicht in meiner Biographie. Und doch. Wenn es da ist, das Belebende, das Entflammende, geht es auch in Richtung des Bedrohlichen. Das ist so. Alles in Anspruch nehmen, sich von allem in Anspruch nehmen lassen, kann bedrohlich werden.
KLEINSCHMIDT: Es gibt das schöne Wort von Freud »die Seele altert nicht«. Würden Sie das auch so sehen?
JANZ: Ja, das ist sehr gut. Auch da gibt es viele schöne stellvertretende Erfahrungen, etwa wenn ich an meine Enkel denke. Das ist gegenseitig. Der eine, der verabschiedete sich heute morgen und sagte, also du weißt ja, wir brauchen uns.
KLEINSCHMIDT: Wie echte Schiffskameraden. Sie sind ja Marinesoldat gewesen.
JANZ: Ja, es hat dieses Flair des Umarmens. Die älteste Enkelin ist zwanzig. Sie ist ein sensibles und sympathisches Wesen, sehr sublimiert in ihrer ganzen Lebensart. Auf der anderen Seite sehr sportlich, sehr ehrgeizig. Für mich ist sie äußerst anziehend. Und mit ihr habe ich, wie soll ich sagen, so was wie eine poetische Beziehung. Ich sage ihr, sie solle mir doch mal Gedichte schicken, ein oder zwei von einem italienischen Dichter, den sie liebe. Und dann hat sie mir Gedichte geschickt, wunderschöne Sachen. Ich habe mühsam eine Übersetzung gemacht. Die habe ich ihr geschickt und dazu gesagt, nun schreib mir mal, wie du das übersetzen würdest. Sie ist zweisprachig. Da hat sie eine Übersetzung gemacht, die viel besser war als meine, sehr viel besser, das habe ich ihr auch gesagt. So was macht mich glücklich. Denn da ist keine Bedrohung dabei. Das sind eben, würde ich sagen, poetische Beziehungen.
KLEINSCHMIDT: Das ist eine sehr gute Konkretisierung. Die Kategorie des Belebenden hat jetzt eine erste Unterabteilung bekommen, die poetischen Belebungen, die sind nicht bedrohlich. Erotische sind bedrohlich. Auch philosophische können bedrohlich sein, oder? Ich weiß nicht, ob man mit neunzig noch mal seine Philosophie wechselt. Halten Sie so was für möglich?
JANZ: Ich glaube es nicht. Ich glaube nur, daß man seine Philosophie im Alter besser durchschaut.
KLEINSCHMIDT: Es gibt einen Satz von Ernst Jünger, der sinngemäß lautet: Keiner stirbt, bevor er nicht seine Aufgabe erfüllt hat. Ich könnte also auf die Frage, warum Sie so alt geworden und dabei so frohgemut und lebensverbunden geblieben sind, antworten: weil Sie weiterhin eine Aufgabe haben, die Sie gerne erfüllen, die Sie nicht als Last empfinden, die Sie nicht loslassen. Obwohl Sie inzwischen vieles losgelassen haben, Patienten, Assistenten, Studenten, Vorlesungen, Seminare, Vorträge – das Loslassenkönnen gehört ja zur Freiheit. Es gibt viele Menschen, die das nicht können und darüber unglücklich werden, denn loslassen müssen sie ja doch irgendwann. Das ist schon eine große Fähigkeit, nicht nur im Beruf, auch im Leben. In der Biographie eines jeden gibt es das Kapitel Trennungen, und Trennungen sind meist ein erzwungenes Loslassen, ein hartes, schmerzhaftes. Beim freiwilligen Loslassen kommt es auf den Zeitpunkt an, nicht zu früh, nicht zu spät. Man kann gewiß leichter loslassen, wenn man das Gefühl hat, daß die einem anvertraute Sache in gute Hände übergeht. Sein Verbundenheitsgefühl kann man ja nicht einfach abwerfen wie einen abgetragenen Mantel, wenn man sich Jahrzehnte engagiert hat. Und das wäre auch kein gutes Loslassen, wenn man sagt: Nach mir die Sintflut!
WEICHELT: Wenn man Jüngers Satz zum ersten Mal hört, erschrickt man ein wenig, weil er etwas von Schicksalsergebenheit hat. Aber vielleicht kann man ihn auch so verstehen, daß man die Aufgaben als selbstgestellte begreift, anders gesagt, daß man sich immer wieder selbst Aufgaben stellen muß. Und erst wenn das aufhört, ist es mit dem Leben vorbei.
JANZ: Jetzt haben wir die Frage, wie man die Unsterblichkeit erlangt, beantwortet. Es ist ganz einfach: Man muß sich selbst Aufgaben stellen. Schön wäre es ja. In Wahrheit ist es so, daß die Aufgaben auf einen zukommen. Und wann das endet, liegt nicht in unserem Beschluß.
SINN UND FORM 2/2011, S. 184-204