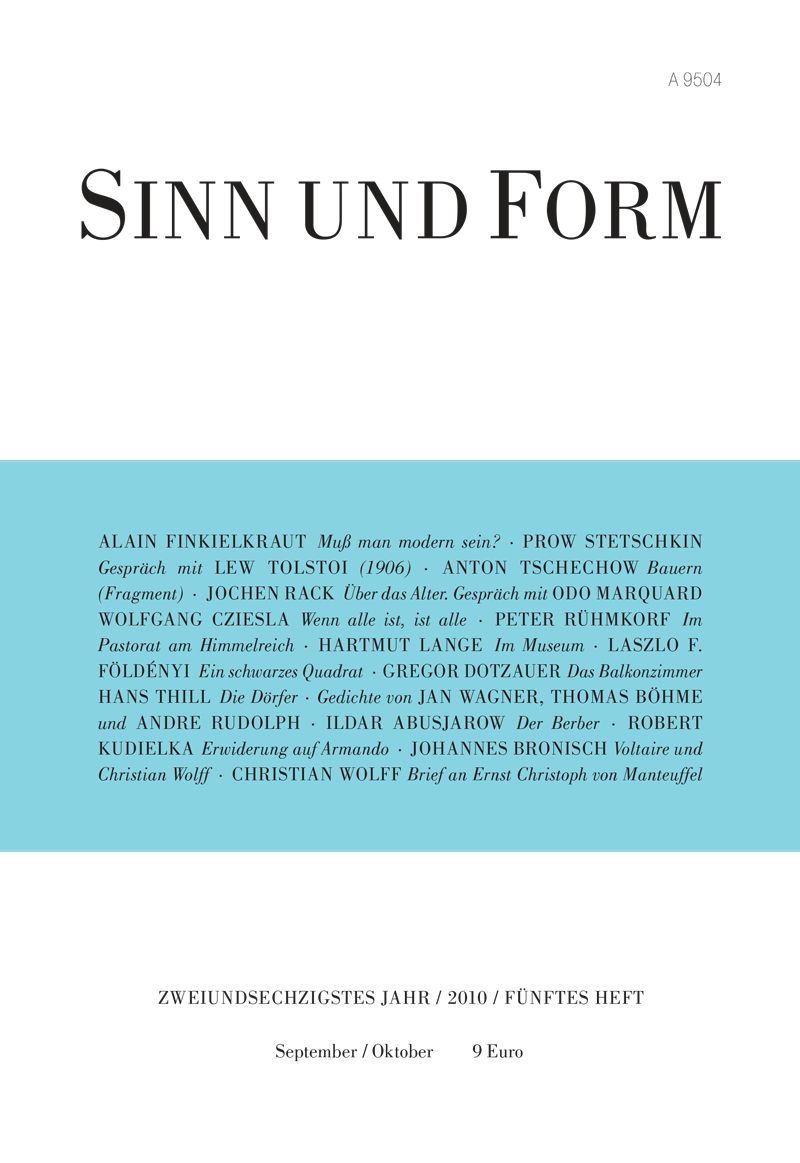Leseprobe aus Heft 5/2010
Finkielkraut, Alain
Muß man modern sein?
Die beiden Forderungen der Avantgarde
Am 13. August 1977 notiert Roland Barthes in seinem Tagebuch: »Auf einmal ist es mir gleichgültig geworden, daß ich nicht modern bin.« Ein verblüffender Satz, wenn man ihn recht bedenkt. Damals war es tatsächlich ratsam, ja sogar von vitaler Bedeutung, modern zu sein, und in ästhetischen Fragen vergab Barthes dieses wertvolle Gütezeichen. Der Autor von »Am Nullpunkt der Literatur« gehörte zu den paar Handverlesenen, die in Sachen Modernität gut oder schlecht Wetter machten. Er war einer von denen, die die Mannschaft aufstellten. Barthes trennte souverän zwischen Altem und Neuem, schied unablässig Zeitgemäßes von Unzeitgemäßem, Aktuelles von Überholtem. Und hier nun, mit sich allein, bekennt er, daß der Riß mitten durch sein Herz ging. Er war Richter und Angeklagter zugleich. Das Scharfgericht, das er in geistigen Dingen ausübte, traf ihn selbst. Er schloß aus, was er liebte; die Werte, die er proklamierte, verdammten manche seiner tiefempfundenen Neigungen. Sein Geschmack litt unter seinen Verdikten, doch das gab er nicht zu, aus Angst, nicht modern zu sein. Eine seltsame und zähe Furcht machte ihn zum heimlichen Dissidenten der eigenen Lehre. Plötzlich fällt die Einschüchterung weg. Er hat keine Angst mehr. Sein anderes Ich verläßt das Versteck und kann endlich frei atmen. Eine paradoxe Freiheit: Ist Befreiung nicht die moderne Geste schlechthin? Was wäre denn modern, wenn nicht die Ablösung von der Autorität der Alten nach dem immer noch wirksamen Vorbild Charles Perraults, der sich mit diesen unerschrockenen Versen über Mimetismus und Akademismus hinwegsetzte:
Stets verdiente die schöne Antike Verehrung
Doch anbetungswürdig erschien sie mir nie
Ich betrachte die Alten nicht auf den Knien
Groß sind sie gewiß, doch Menschen wie wir.
Mehr noch: Hat nicht der Mensch, seit er modern ist, den Gedanken von der menschlichen Natur aufgegeben, um sich als freies Subjekt zu verstehen und zu definieren? Der moderne Mensch, der Mensch als Moderner, hatte seinen ersten, glanzvollen Auftritt 1482 in der »Oratio de hominis dignitate« von Pico della Mirandola. Diese bewundernswerte Rede beginnt mit einer Erzählung, und nicht mit irgendeiner, sondern mit der Genesis. Gott erschafft die Welt, und nachdem er sie als »den erhabensten Tempel der Gottheit« errichtet, den Raum über den Himmeln mit Geistern geschmückt, die Sphären des Äthers mit ewigen Seelen belebt und die schmutzigen Teile der unteren Welt mit einer Schar von Lebewesen aller Art gefüllt hat, verspürt der allerhöchste Baumeister plötzlich den Wunsch, »es gäbe jemanden, der die Gesetzmäßigkeit eines so großen Werkes genau erwöge, seine Schönheit liebte und seine Größe bewunderte«.
Erst in dem Augenblick, in dem er diesen Betrachter des Universums schaffen will, bemerkt Gott verlegen, daß seine Ressourcen erschöpft sind. Sein Vorrat an Archetypen ist aufgebraucht. Alles ist bereits den oberen, mittleren und unteren Ordnungen zugeteilt. Doch es entspräche nicht der göttlichen Weisheit, vor einem so notwendigen Werk unschlüssig zu zögern. Der allerhöchste Schöpfer macht also aus der Notwendigkeit eine Tugend: Er begreift den Menschen als »Geschöpf von unbestimmter Gestalt«, und nachdem er ihn in die Mitte der Welt gestellt hat, spricht er ihn folgendermaßen an: »Wir haben dir keinen festen Wohnsitz gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen noch irgendeine besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die du dir selbst ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch und Entschluß habest und besitzest. Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selber bestimmen. (…) Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du, wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Du kannst zum Niedrigen, zum Tierischen entarten; du kannst aber auch zum Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn deine Seele es beschließt.«
Durch diese Erzählung von den Ursprüngen, diese wahrhafte Bibel des modernen Zeitalters, erhält die Aufhebung des heiligen Textes etwas Religiöses, und die Definition des Menschen als völlig autonomes Wesen erscheint fremdbestimmt (als eine Entscheidung von oben). Der Schöpfer der Dinge setzt Adam als Schöpfer ein. Doch offenbart wird ihm nicht das Gesetz, das ihn begründet, sondern daß er selbst Quelle seiner Gesetze ist. Dieses Geschöpf unterscheidet sich von allen anderen dadurch, daß es sich selbst schafft und gestaltet und daß keine Autorität, keine Transzendenz, keine höhere Instanz ihm verbieten, sich die göttlichen Eigenschaften Allwissenheit und Allmacht anzueignen. Der Bruch mit der christlichen Tradition und der Weisheit der Alten tarnt sich als Kontinuität: Pico della Mirandola legt Gott eine herrliche Erklärung der Unabhängigkeit des Menschen in den Mund.
Die Würde des Menschen hängt nicht mehr von der Stellung ab, die ihm ein für allemal im Weltengebäude zugewiesen wurde. Seine Würde liegt vielmehr darin, daß nichts für ihn, nichts in ihm ein für allemal feststeht. Das Endgültige ist abgeschafft. Der Mensch ist das Wesen, dessen Handeln nicht aus dem Sein, sondern dessen Sein aus dem Handeln erwächst. Er ist im Grunde nichts. In »Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance« schreibt Ernst Cassirer, »daß der Mensch sein Sein nicht, gleich dem der übrigen Wesen, fertig von der Natur erhält und es gleichsam von ihr dauernd zu Lehen trägt, sondern daß er es sich erwerben, daß er es durch virtus und ars gestalten muß«. Nicht mehr Substanz, sondern Freiheit macht das Phänomen Mensch aus, und der Wille zur Künstlichkeit siegt über die Neigung, sich einem Modell oder einer normativen Autorität zu fügen.
Doch wo liegt dann die Wahrheit, wenn es keine Natur mehr gibt, die sie umschreibt, und keine kanonischen Schriften, die sie verkünden? Etwa hundertfünfzig Jahre nach Pico della Mirandola gibt Francis Bacon in seinem »Novum Organon« die Antwort darauf: Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit und nicht der Autorität. Da die Würde des Menschen nicht mehr in der Erfüllung seiner Natur, sondern in seinen unendlichen Möglichkeiten besteht, ist er gezwungen, unaufhörlich voranzuschreiten und über sich hinauszuwachsen. Unter dem Eindruck der ersten Erfolge des wissenschaftlichen Denkens verliert das Sein seinen ontologischen Vorrang an das Werden, und die Menschheit kippt ins geschichtliche Element. Nicht mehr Geschichten, sondern GESCHICHTE; keine Sammlung von Menschheitsfabeln mehr, sondern der Weg, den die menschliche Gattung einschlägt, um einer Berufung zu folgen, die von keinen Grenzen eingeengt wird, keiner Definition verhaftet bleibt. »Was ist Geschichte?«, fragt jemand in »Doktor Schiwago«. Und seine Antwort lautet: »Sie ist der Beginn einer jahrhundertelangen systematischen Arbeit, die dazu bestimmt ist, das Geheimnis des Todes aufzuklären und endlich den Tod selber zu überwinden.«
Dem Ansehen und Einfluß der Alten folgt also die Faszination der Bewegung. Wer sich nicht bewegt, wer trödelt, bummelt, zurückblickt, meint zu leben; in Wirklichkeit versäumt er das Leben. Er klammert sich an etwas, das man nicht mehr sein kann. Alles, was er liebt, alle Verhaltensweisen, die er übernimmt, alle Urteile, die er äußert, sind nicht mehr in Gebrauch. Das ist eine Anomalie, ein has-been, eine tote Last, ein metaphysischer Skandal. Barthes’ Satz zeugt von einer Zeit, in der man zeitgemäß sein muß, um im vollen Sinne zu leben.
Und was ist ein wirklich moderner, im vollen Sinne lebender Schriftsteller? Er ist eben ein Schriftsteller (écrivain) und kein Schreiber (écrivant). Während der Schreiber Zeugnis ablegt, protestiert, erklärt, lehrt, kurz gesagt: etwas schreibt, schreibt der Schriftsteller ganz einfach. Seine Tätigkeit ist intransitiv. Wie Michel Foucault in der »Ordnung der Dinge« sagt, bricht er mit einer Beredsamkeit, die ganz auf einen außersprachlichen Zweck gerichtet ist, zugunsten eines Diskurses, der »nichts anderes mehr zu sagen hat als sich selbst, nichts anderes zu tun hat, als im Glanz [seines] Seins zu glitzern«.
Modernität paßt hier zu Reinheit, denn was modern ist, ist nicht nur Entgrenzung, sondern Abgrenzung, ist nicht nur Entthronung des Seins durch das Werden oder der Perfektion durch unendliche Perfektionierbarkeit, sondern ist auch die Logik, die sämtliche Tätigkeiten, sämtliche Beschäftigungen zu selbstbezogenen, um ihrer selbst willen betriebenen macht und sie in der Erscheinung oder Entfaltung ihresWesens konzentriert. »Für den mittelalterlichen Kaufmann«, heißt es in Hermann Brochs Roman »Die Schlafwandler«, »galt kein ›Geschäft ist Geschäft‹, der Konkurrenzkampf war ihm etwas Verpöntes, der mittelalterliche Künstler kannte kein l’art pour l’art, sondern bloß den Dienst am Glauben, der mittelalterliche Krieg nahm nur dann die Würde der Absolutheit in Anspruch, wenn er im Dienste des einzigen absoluten Wertes, im Dienste des Glaubens geführt wurde. Es war ein im Glauben ruhendes, ein finales, kein kausales Weltganzes, eine Welt, die sich durchaus im Sein, nicht im Werden begründete, und ihre soziale Struktur, ihre Kunst, ihre soziale Verbundenheit, kurzum ihr ganzes Wertgefüge waren dem umfassenden Lebenswert des Glaubens unterworfen.« Als Gott den Platz verläßt, von dem aus Er das Universum gelenkt hatte, und die Neuzeit entsteht, trennen sich die Tätigkeitsbereiche voneinander und suchen ihre Legitimation zunehmend in sich selbst. Von der Bevormundung durch die Religion befreit, entwickeln sich Kunst, Ökonomie, Politik, Sport, Krieg gewissermaßen je für sich. Vom Absoluten befreit, werden sie professionell. Der Geist, der sie beseelt, sagt Broch, »ist von jener auf die Sache und nur auf die Sache gerichteten grausamen Logizität, die nicht nach rechts, nicht nach links schaut«. Mit unerschütterlicher Konsequenz ziehen diese Sparten aus den sie beherrschenden Postulaten die Folgerungen, die keine äußere Erwägung, kein äußeres Bedenken aufhält. Wie es zur Logik des Geschäftsmanns gehört, Geschäfte zu machen, so gehört es zur Logik des Malers, »die malerischen Prinzipien mit äußerster Konsequenz und Radikalität bis zum Ende zu führen, auf die Gefahr hin, daß ein völlig esoterisches, nur mehr dem Produzenten verständliches Gebilde entstehe«.
In der Tat, so schreibt man die Geschichte der Malerei: von Manet, der gepriesen wird, weil er sichtbar zu machen verstand, was die Darstellung vergessen ließ – die Materialität der Leinwand –, bis zu Kandinsky und Malewitsch, die gewürdigt werden, weil sie die Kunst zugunsten einer reinen Komposition von Linien, nichtidentifizierbaren Figuren und Farben aus ihrer figürlichen Schlacke herausgelöst haben. »Die Maler müssen die Sujets und die Gegenstände aufgeben, wenn sie reine Maler sein wollen«, verkündet Malewitsch. »Erst wenn das Bewußtsein die Gewohnheit verloren haben wird, im Bild die Darstellung von Eckchen der Natur, Madonnen- oder Venusdarstellungen zu sehen, werden wir das rein malerische Werk erkennen.«
Derselbe Wunsch nach Reinheit, derselbe Hang zur Subtraktion, derselbe Wille, alles zu ignorieren, was nicht auf die eigentlichen Kategorien seiner Kunst zurückzuführen ist, findet sich bei Claude Simon. In seiner Stockholmer Rede antwortet er dem Kritiker, der meinte, mit dem Nobelpreis habe man das Gerücht bestätigen wollen, der Roman sei wirklich tot: »Dieser Kritiker scheint nicht bemerkt zu haben, daß der ›Roman‹, wenn er darunter das literarische Modell versteht, das im Laufe des 19. Jahrhunderts erblüht ist, in der Tat mausetot ist, trotz der Tatsache, daß man in Bahnhofsbuchhandlungen oder anderswo noch immer und noch für lange Zeit zu Tausenden liebenswerte oder furchterregende Abenteuergeschichten mit hoffnungsfrohem oder verzweifeltem Schluß verkaufen und kaufen wird, Geschichten, die im Titel die Offenbarung von Wahrheiten ankündigen, wie zum Beispiel ›So lebt der Mensch‹, ›Die Hoffnung‹ oder ›Die Wege der Freiheit‹.«
Bahnhofsroman paßt zu überholt, wie Moderne zu Reinheit. Doch der Vorwurf richtet sich auch gegen den Begründer der Zeitschrift »Les Temps modernes«. Er nannte sie nicht zufällig so. Der Name war nicht beliebig. Er war die Standarte eines Engagements, und für Sartre eine Art, sich unzweideutig auf die Seite der Modernität zu stellen. Der Direktor der »Temps modernes« trieb die Forderung an den Schriftsteller, sich seiner Zeit anzuschmiegen, so weit, daß er den Verzicht auf Unsterblichkeit zur ästhetischen, politischen und moralischen Maxime erhob. Schreiben war für ihn ein Modus des Handelns. Es konnte also nicht den Anspruch erheben, sich der Geschichte zu widersetzen oder zu entziehen. Es gehörte dazu wie alles andere. Und Sartre in seiner Radikalität verstand es sehr gut, diesen Religionsersatz, diese letzte Bastion frommer Seelen – die Literatur – zu säkularisieren. Gegen die treuen Anhänger des unsterblichen Werkes bekräftigte er, daß »das Heil in dieser Welt liegt, daß es eine ganz und gar menschliche Angelegenheit bleibt und daß die Kunst eine Betrachtung des Lebens, nicht des Todes ist«. Die Meditation über den Tod spekuliert auf das künftige Leben. Die Meditation über das Leben widmet sich rückhaltlos dem hic et nunc, den Ansprüchen und Forderungen der Stunde. Sie konstituiert die Gegenwart als unüberschreitbaren Horizont, und weil sie modern, das heißt atheistisch ist, macht sie ihr eigenes Veralten zum Programm: »Ein Buch hat in der Epoche seine absolute Wahrheit. Es ist erlebt wie ein Aufruhr oder eine Hungersnot. Zugegeben, mit viel weniger Intensität und von einer geringeren Zahl von Menschen, aber doch auf die gleiche Weise. Es ist eine Ausstrahlung der Intersubjektivität, ein lebendiges Band aus Zorn, Haß oder Liebe zwischen denen, die es geschaffen haben, und denen, die es entgegennehmen. (…) Man hat mir oft von Datteln und Bananen erzählt: ›Sie können gar nicht mitreden. Um zu wissen, was an ihnen ist, muß man sie frisch gepflückt an Ort und Stelle essen.‹ Und so habe ich die Bananen stets als tote Früchte angesehen, deren frischer, eigentlicher Geschmack mir entging. Bücher, die von einer Epoche in die nächste hineinragen, sind wie tote Früchte; sie haben zu einer anderen Zeit einen anderen Geschmack gehabt, einen herben, lebhaften. Man muß Rousseaus ›Émile‹ oder die ›Lettres persanes‹ von Montesquieu lesen, wenn sie eben gepflückt worden sind.«
Indem er sich an die Gegenwart hält, indem er bewußt und ausschließlich für seine Zeit schreibt, entscheidet sich Sartre also für die Modernität, das heißt das Momentane, und gegen alle Formen von Ewigkeit, darunter die Nachwelt. Er ist nicht der erste. »Wenn wir den Fortschritt hassen, hassen wir unseren Tod«, sagte schon Renan: »Früher galt alles als seiend. Man sprach von Recht, Religion, Politik, Dichtung als etwas Absolutem. Jetzt wird alles als werdend betrachtet.« Und der Autor von »L’Avenir de la science« war insofern modern, als er die Auflösung oder gar Liquidierung sämtlicher Monumente – »einschließlich seiner eigenen Werke« – in der allgemeinen Bewegung billigte, ja sogar rühmte.
Doch im Unterschied zu Renan betrachtet Sartre die Geschichte als einen langen unruhigen Fluß. Er erwartet nicht, daß aus der Entwicklung der Wissenschaft ganz von allein das Reich des Humanen entsteht. Für Sartre verläuft der Fortschritt nicht linear, sondern stürmisch: Er entsteht aus dem Zusammenprall der Gegensätze. Das Neue folgt nicht dem Alten. Es steht ihm feindlich gegenüber. Die Gegenwart ist Schauplatz dieser Schlacht, bei der die Verwirklichung des Ideals auf dem Spiel steht: »Wir möchten, daß das Werk zugleich eine Tat sei, daß es ausdrücklich aufgefaßt werde als eine Waffe für den Kampf, den die Menschheit gegen das Schlechte führt.«
Das Pathos der Moderne nimmt hier eine dramatische Wendung. Modern sein, das ist keine Feststellung, sondern ein Kampf. Die gesamte Wirklichkeit ist auf diesen Kampf zwischen den Lebenden und den Übriggebliebenen ausgerichtet, zwischen denen, die die Verheißungen der Geschichte verwirklichen, und denen, die alles tun, damit sie sich nicht erfüllen. Der Sinn der Aktualität liegt in dem gnadenlosen Zweikampf, den sich das moderne Gute und das rückschrittliche Schlechte liefern. Wie kommt es zu dieser Dramatisierung? Sie entsteht dadurch, daß der Humanismus genötigt ist, für die Gewalt, Entfremdung und Unterdrückung in einer Geschichte, die nicht mehr von Gott gemacht ist, eine Erklärung zu finden. Sobald anerkannt wird, daß der Mensch die Fähigkeit besitzt, selbst die Fundamente seines Schicksals zu legen, schreibt Odo Marquard, muß »die vormals transzendent adressierte Unzufriedenheit mit der Welt (…) ans Immanente, ans Binnengeschichtliche umadressiert werden «. Wenn es schlecht läuft, entdeckt die Geschichtsphilosophie, die dafür ja nicht mehr Gott verantwortlich machen kann, als entscheidende Figur die anderen: diejenigen, die das von den Menschen gewollte Gute verhindern, das heißt die Gegner, die Feinde.
[...]
Aus dem Französischen von Horst Brühmann
SINN UND FORM 5/2010, S. 581-597