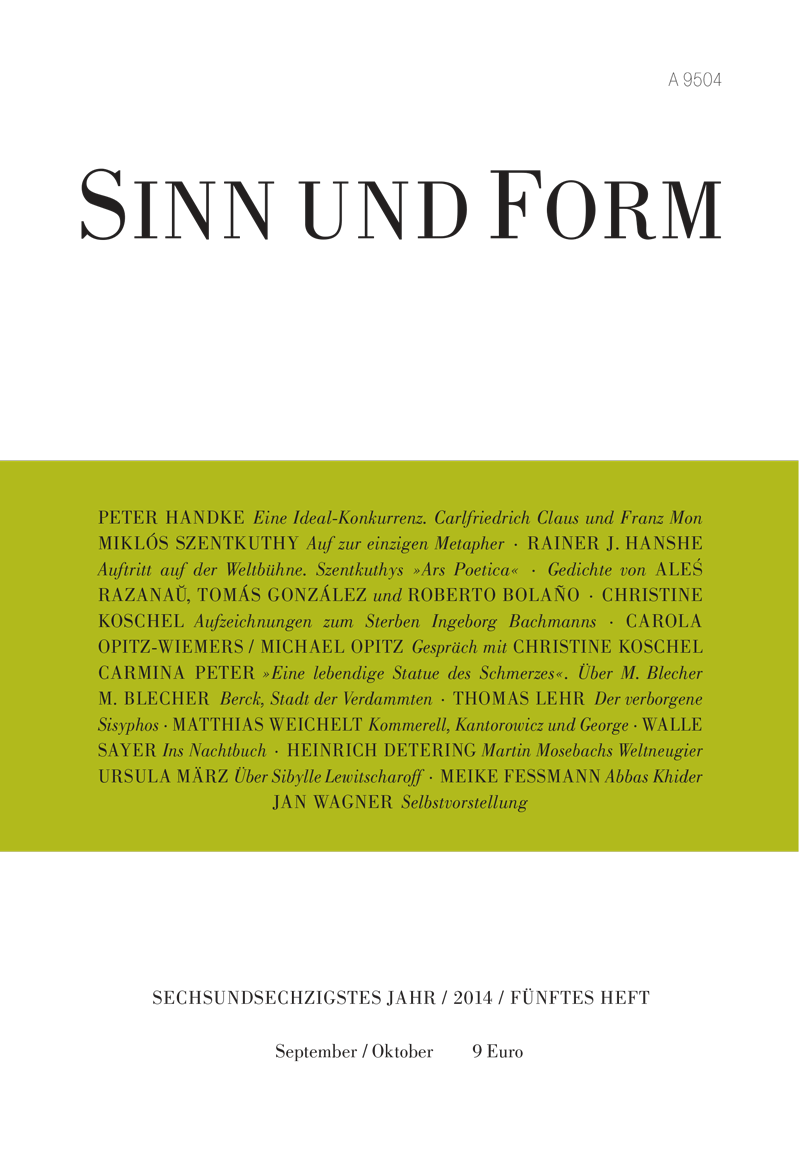Heft 5/2014 enthält:
Handke, Peter
Eine Ideal-Konkurrenz. Zum Briefwechsel zwischen Carlfriedrich Claus und Franz Mon, S. 581
Ist’s nicht etwas Merkwürdiges, daß die Gestalten, die Gestalter, die Menschen, die Gestalter-Menschen, welche mich in der letzten Zeit in einer, (...)
Szentkuthy, Miklós
Auf zur einzigen Metapher, S. 593
Hanshe, Rainer J.
Auftritt auf der Weltbühne. Miklós Szentkuthys »Ars Poetica«, S. 607
[…] Szentkuthys zweites Buch »Az egyetlen metafora felé« (Auf zur einzigen Metapher), das 1935 erschien und 1985 wieder aufgelegt wurde, (...)
Razanau, Ales
Wo die Strömung zur Ruhe kommt. Versetten, S. 622
Koschel, Christine
Tagebuchaufzeichnungen zum Sterben Ingeborg Bachmanns. September - Oktober 1973, S. 624
Opitz-Wiemers, Carola, und Michael Opitz
»Der Bachmann glaube ich, was sie schreibt«. Gespräch mit Christine Koschel, S. 638
MICHAEL OPITZ, CAROLA OPITZ-WIEMERS: Sie haben 1961, im Alter von fünfundzwanzig Jahren, mit dem Lyrikband »Den Windschädel tragen« debütiert. (...)
González, Tomás
All die toten Tiere. Gedichte, S. 647
Bolano, Roberto
Die romantischen Hunde. Gedichte. Mit einer Nachbemerkung von Pere Gimferrer, S. 651
Peter, Carmina
»Eine lebendige Statue des Schmerzes«. Über M. Blecher, S. 658
I Als der Militärarzt und Dichter Saşa Pană im Frühjahr 1936 in die moldauische Provinz versetzt wird, nutzt er die Gelegenheit zu (...)
Blecher, M.
Berck, Stadt der Verdammten, S. 664
Lehr, Thomas
Der verborgene Sisyphos, S. 678
Weichelt, Matthias
Das Kleinste und der Chevalier. Kommerell, Kantorowicz und George, S. 682
Sayer, Walle
Ins Nachtbuch, S. 692
Detering, Heinrich
Weltneugier. Lobrede auf Martin Mosebach, S. 695
März, Ursula
Das Feuerwerk der Metaphysik. Lobrede auf Sibylle Lewitscharoff, S. 700
Feßmann, Meike
Die Freiheit, sein Leben noch einmal zu erzählen. Laudatio auf Abbas Khider, S. 705
Wagner, Jan
Selbstvorstellung. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, S. 711