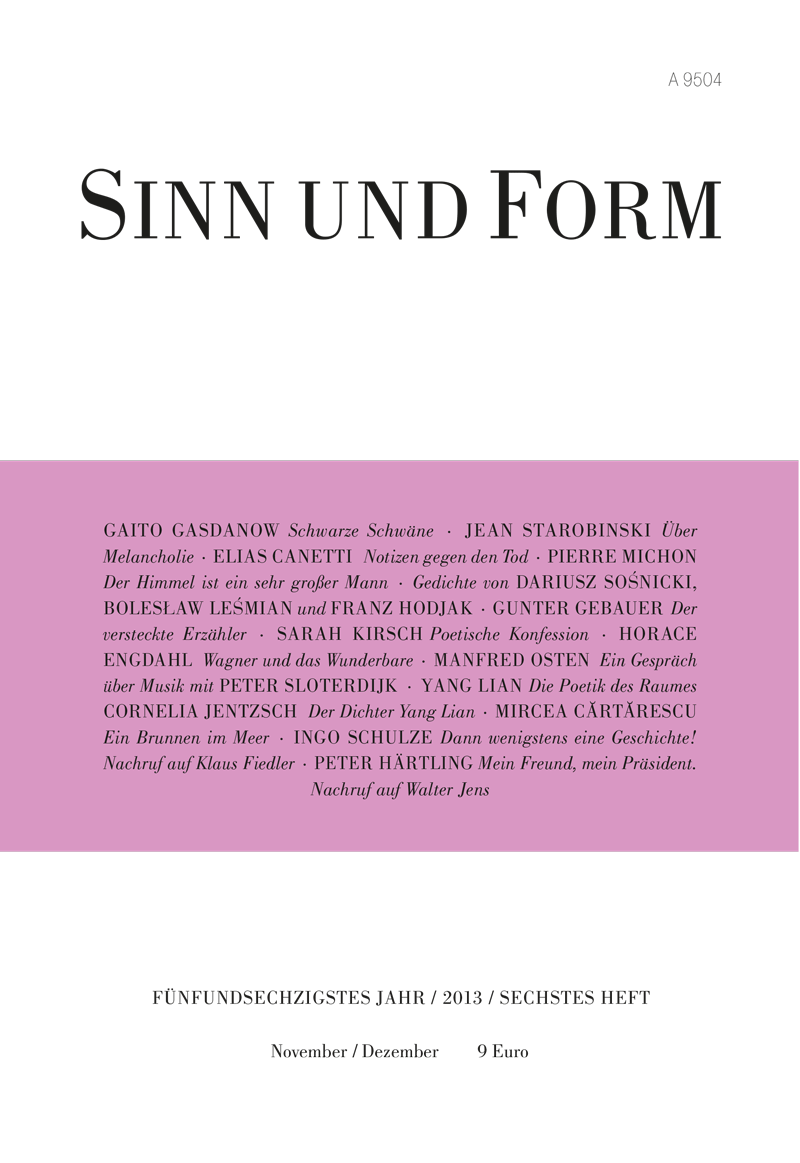Heft 6/2013 enthält:
Gasdanow, Gaito
Schwarze Schwäne, S. 773
Sośnicki, Dariusz
Stadt der Selbstmörder. Gedichte, S. 788
Starobinski, Jean
»In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.« Über Melancholie, S. 791
Canetti, Elias
Notizen gegen den Tod, S. 795
Michon, Pierre
Der Himmel ist ein sehr großer Mann, S. 812
Übrigens hatte schon Swedenborg,
der eine weitaus größere Seele besaß,
uns gelehrt: Der Himmel ist ein sehr großer Mann.
Leśmian, Bolesław
Pfade, die ich als Kind durchlief. Gedichte, S. 826
Hodjak, Franz
Die Adern der Blätter. Gedichte, S. 829
Gebauer, Gunter
Der versteckte Erzähler. Entwurf einer Theorie in Literatur und Philosophie, S. 831
Kirsch, Sarah
Im Spiegel. Poetische Konfession. Mit einer Vorbemerkung von Isabelle Lehn, Sascha Macht und Katja Stopka, S. 848
Vorbemerkung »Ich hatte mehrere Leben, die sich voneinander stark unterschieden«, schreibt Sarah Kirsch in ihrer Chronik »Allerlei-Rauh«. Im (...)
Engdahl, Horace
Wagner und das Wunderbare, S. 856
Sloterdijk, Peter
Das glückliche Ohr. Ein Gespräch über Musik mit Manfred Osten, S. 864
MANFRED OSTEN: Vielleicht sollten wir mit der Rehabilitierung eines Stiefkinds der europäischen Geistesgeschichte beginnen, mit der (...)
Lian, Yang
Die Poetik des Raumes. Eine zeitgenössische Antwort auf die Herausforderungen des klassischen chinesischen Gedichts, S. 878
Jentzsch, Cornelia
Zwischen gestern und morgen. Der Dichter Yang Lian, S. 887
Cărtărescu, Mircea
Ein Brunnen im Meer, S. 889
Schulze, Ingo
Wenn schon keine Freundschaft oder Liebe, dann wenigstens eine Geschichte! Nachruf auf Klaus Fiedler, S. 891
Härtling, Peter
Mein Freund, mein Präsident. Nachruf auf Walter Jens, S. 895