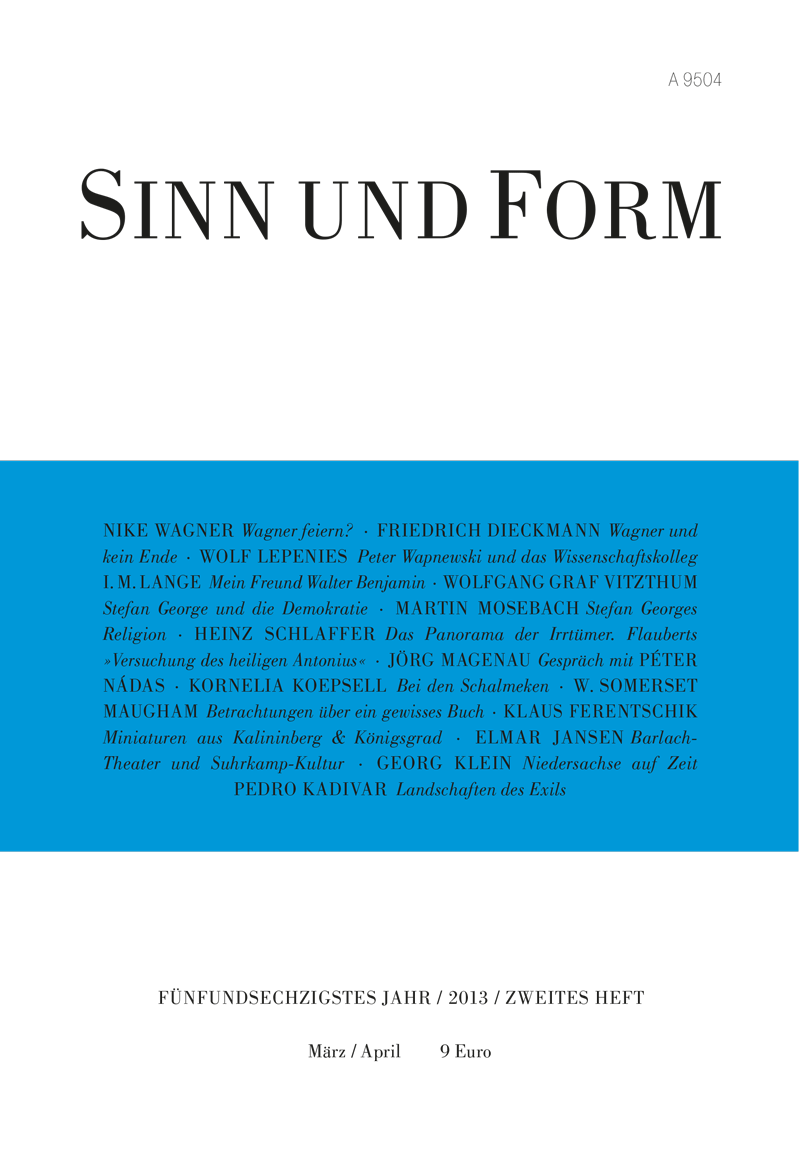Heft 2/2013 enthält:
Wagner, Nike
Wagner feiern?, S. 149
Dieckmann, Friedrich
Wagner und kein Ende, S. 157
Lepenies, Wolf
Royaldemokratie und Gründercharisma. Peter Wapnewski und das Wissenschaftskolleg, S. 166
Lange, I. M.
Mein Freund Walter Benjamin. Mit einer Vorbemerkung von Erdmut Wizisla, S. 175
Vorbemerkung Immer wieder tauchen unbekannte Quellen zu Walter Benjamin auf. In den letzten zehn Jahren gehörten Briefe aus der (...)
Vitzthum, Wolfgang Graf
»Schon eure zahl ist frevel«. Stefan George und die Demokratie, S. 189
Mosebach, Martin
Stefan Georges Religion, S. 199
Schlaffer, Heinz
Das Panorama der Irrtümer. Zu Flauberts »Versuchung des heiligen Antonius«, S. 212
Nádas, Péter
»Wir versuchen, mit dem Chaos zu leben«. Gespräch mit Jörg Magenau, S. 219
Koepsell, Kornelia
Bei den Schalmeken. Gedichte, S. 233
Maugham, William Somerset
Betrachtungen über ein gewisses Buch. Kants »Kritik der Urteilskraft«, S. 237
I. Pünktlich um fünf vor fünf wurde Professor Kant von seinem Diener Lampe geweckt, und um fünf setzte er sich, angetan mit Pantoffeln, (...)
Ferentschik, Klaus
Miniaturen aus Kalininberg & Königsgrad, S. 260
Jansen, Elmar
»Seelenverwandtschaft, eine bleibende«. Ein etwas anderer Blick auf das Barlach-Theater und die Suhrkamp-Kultur, S. 267
»Immer noch leichter Nebel – eigentlich gar nicht unsympathisch, … es kann mehr dahinter stecken als man denkt, kann anders kommen als (...)
Klein, Georg
Niedersachse auf Zeit. Dankrede zur Verleihung des Niedersächsischen Staatspreises 2012, S. 272
Kadivar, Pedro
Landschaften des Exils, S. 274