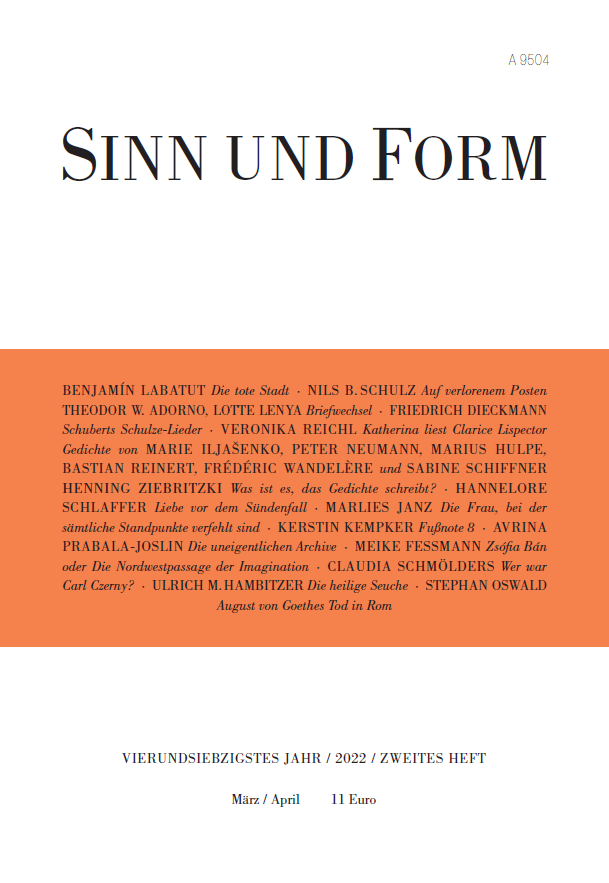
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 2/2022
Labatut, Benjamín
Die tote Stadt
Vor einigen Jahren, im Oktober 2008, gestand der englische Physiker Freeman Dyson in einer Vorlesung, daß er ein bestimmtes Lied von Monique Morelli – »La ville morte« – nicht hören könne, ohne von heftigsten Gefühlen überwältigt zu werden, ein ihm selbst unerklärliches Phänomen. Die mit schmerzvoller Stimme gesungene Ballade, begleitet von den Klagelauten eines Akkordeons, besticht durch ergreifende Bilder: Als wir in die tote Stadt einzogen / Hielt ich Margot an der Hand / Ein Morgen, der nicht endete / schenkte uns sein totes Licht / Wir liefen durch die Straßen, von Trümmern / zu Ruinen und von Tür zu Tür / Was einmal Türen waren / grenzte an ein seltsam fremdes Land. Egal wie oft Dyson die Aufnahme abspielte, jedesmal zerfloß er in Tränen, er schämte sich, das Lied in Gesellschaft zu hören; nur von Zeit zu Zeit, allein und wenn ihm danach war, gab er sich der Musik hin. Seine emotionale Reaktion war um so verstörender, als er praktisch kein Französisch konnte und nur eine äußerst vage Vorstellung davon hatte, worum es in dem Chanson ging. Selbst als ein Freund den Text für ihn übersetzte, war ihm das kein Trost. Nach jahrelangem Grübeln kam er zu der Überzeugung, daß diesen Strophen des französischen Dichters und Romanciers Pierre Mac Orlan etwas innewohnte, was in den tiefsten Schichten seiner unbewußten Erinnerung widerhallte, als sänge Monique nicht für die Lebenden, sondern für die zahllosen Seelen der Verstorbenen, deren Überreste sich, unsichtbar und vergessen, unter unseren Füßen sammeln. Eine plausible Erklärung für seine Anfälle von Melancholie fand Dyson schließlich in einem kurzen Artikel des russischen Mathematikers Yuri I. Manin, »Der Archetyp der leeren Stadt« aus seinem Essayband »Mathematik als Metapher«. Die leere Stadt ist hier die »Form einer Gesellschaft, der ihre Seele entzogen wurde und die nicht auf eine Eingabe wartet, eine Leiche, die nie ein lebender Körper war, ein Golem, dessen Leben selbst der Tod ist«. Die Wirkung dieses Archetyps auf unsere Psyche vergleicht Manin mit den diffusen Verlustgefühlen, die uns überkommen, wenn wir zufällig auf einen verlassenen Bienenstock schauen oder auf das endlos strömende Wasser in den Filmen des genialen russischen Regisseurs Andrei Tarkowski, der so besessen davon war, Bilder unserer Träume festzuhalten, daß er mit seiner Frau und seiner Crew in Flüsse voll giftiger Chemikalien stieg, um »Stalker« zu drehen, den Film, der ihn schließlich das Leben kostete. Die funkelnden Schlieren an der Oberfläche, in flüchtigen Bildern auf Zelluloid gebannt, stammten von giftigen Abfällen aus stillgelegten Fabriken und waren wahrscheinlich auch die Ursache für das Krebsgeschwür, das seine Lunge zerstörte und ihn 1986, mit gerade einmal 54 Jahren, umbrachte, und nicht nur ihn, sondern auch seine Frau Larissa und seinen Stammschauspieler Anatoli Solonizyn, die beide an derselben Krankheit starben. In »Stalker« ist ein weiter Landstrich – bekannt nur als »die Zone« – verseucht und unbewohnbar aufgrund von Kräften, die nicht nur den Körper und den Geist der Menschen infizieren, sondern vielleicht sogar ihre Seelen. Bewaffnete Truppen haben die Region abgeriegelt, doch eine kleine Gruppe verzweifelter Männer und Frauen wird unwiderstehlich von ihr angezogen wie Motten von einer radioaktiven Flamme, denn einem Gerücht zufolge gibt es tief im Inneren der Zone, im befremdlichsten Teil dieses Gebiets, einen kleinen und dem Anschein nach ganz gewöhnlichen Raum, in dem all jenen, die es hineinschaffen, ihre innigsten Wünsche erfüllt werden. Um den Fallen und Gefahren der Zone zu entgehen, müssen die Suchenden professionelle Führer anheuern, Stalker genannt, die sie durch die wüste Landschaft mit ihren verlassenen Ruinen und zerfallenden Gebäuden lotsen, wo die Vegetation das Land längst zurückerobert hat. Die Kettenspuren aufgegebener Panzer sind überwuchert, ebenso die Fassaden von Fabriken, Schulen und Krankenhäusern, andere leerstehende Gebäude sind halb verfallen und nicht wiederzuerkennen. Irgendwie sind die Gesetze der Wirklichkeit hier außer Kraft gesetzt, die Zeit fließt in seltsamen Schleifen, Erinnerungen und Träume nehmen Konturen an, Alpträume sind so real und schrecklich, als würden sie im Wachzustand erlebt. Die Szenerie ist erfüllt von einer berauschenden Melancholie, sie ergreift sowohl die Stalker als auch diejenigen, die sich die Verwirklichung ihrer Sehnsüchte erhoffen. Die Zone ist nämlich, obwohl unbewohnt und feindlich, eindeutig belebt und Teil von etwas, was dem menschlichen Bewußtsein ähnelt, ein hartnäckiger Wiedergänger, der sich dem unbarmherzigen Lauf der Zeit zu widersetzen vermag und einfach nicht vergeht, so wenig wie die Bilder vergangener Schrecken, die der Archetyp der leeren Stadt heraufbeschwört. Für Manin erklärt sich die Allgegenwärtigkeit dieses Archetyps in unserem kollektiven Gedächtnis aus den gesammelten Erfahrungen zahlloser Völker, die schon in grauer Vorzeit auf die Überreste alter vergessener Tempel stießen, zu Staub zerfallend im Wüstensand, begraben unter dem üppigen Grün undurchdringlicher Dschungel oder versteckt in den unzugänglichsten Hochtälern der Berge, Ruinen von solch kolossalen Ausmaßen, daß sie Göttern, wenn nicht Wesen von einem anderen Planeten als Wohnstatt gedient haben mußten. Es waren gespenstische Orte, man fürchtete und mied sie, wie auch die Angelsachsen sich fernhielten von den steinernen Mauern römischer Häuser, die sie als das Erbe sagenhafter Riesen betrachteten und niemals bewohnten. Die tote Stadt gibt es seit unvordenklichen Zeiten; sie geht zurück auf die Anfänge der Zivilisation, als die ersten Menschen begannen, sich in Siedlungen zusammenzuschließen, die immer größer wurden, blühten und gediehen und anderen Menschen ein Ansporn waren, Armeen aufzustellen, um diese Siedlungen zu überfallen, zu plündern und zu zerstören. Der Archetyp der leeren Stadt ist ein gedankliches Konstrukt, ein Destillat der Untergangserfahrungen zahlloser realer Gemeinschaften. Er steht für den nagenden Hunger in Zeiten der Dürre und die Nachglut der Brände, die die Häuser dem Erdboden gleichmachten, für die immer noch spürbaren Erschütterungen der Erdbeben, die ihre Fundamente auseinanderrissen, für die Narben, die die Seuchen hinterließen, die sie über Nacht entleerten. Doch Manin weist auch darauf hin, daß solche Phantombilder, egal wie schwach und verblassend, weder passiv noch neutral sind. Im Gegenteil, sie nähren unsere dunkelsten und ungestümsten Wünsche. Eine tiefe Sehnsucht nach Auflösung. Ein leidenschaftliches Verlangen, die Zerstörung all dessen zu erleben, was wir kennen. Ein Bedürfnis, die Welt vom Makel der Menschheit zu reinigen und unseren Planeten nicht nur von den Dämonen des Fortschritts zu befreien, sondern von allen Übeln, die unserer verfluchten Natur entspringen. Das kollektive Unbewußte ist kein bloßes geistiges Gepäck, sondern ein irrationaler Drang zu Tod und Zerstörung. Gleichgültig gegenüber den Träumen der Vernunft, ist das Unbewußte nicht eine Kraft, die zu Gemeinschaft oder Ganzheit führt, sondern etwas Irres, Verrücktes, Chaotisches, ein Sirenengesang, dem wir mit Nachdruck widerstehen müssen. »Diesem Potential«, schreibt Manin, »kann man nur die Erziehung des kollektiven Bewußtseins gegenüberstellen. Sonst wird die leere Stadt unsere letzte Heimstätte sein.«
Der Protagonist des Chansons, das Freeman Dyson so in seinen Bann schlug, ist ein älterer Soldat und Angehöriger einer Besatzungsarmee. Der namenlose Kämpfer ist nicht wach, sondern träumt: Er sieht sich selbst, wie er durch die Trümmer und den Staub einer eroberten Stadt geht und seine Frau an der Hand hält, beide betrachten die dunklen Ruinen ringsum. Sie kommen an ausgebombten Häusern vorbei, an ausgebrannten Autos, offenen Gräbern und dem verbogenen Metall eines zusammengeschmolzenen Spielplatzes, Szenen einer kaum vorstellbaren, von ihm selbst und seinen Kameraden angerichteten Verwüstung. Zwar weiß der Soldat, daß das, was er sieht, nur ein Traum ist und daß er in Wirklichkeit in der Kaserne schläft, fern des Gemetzels und allen Blutvergießens, doch kann er den Gedanken nicht ertragen, die Hand seiner Frau loszulassen, denn er ist fest davon überzeugt – mit einer Gewißheit, wie nur Träume sie schenken –, daß er sie niemals wiedersehen wird, weder in diesem noch in einem nächsten Leben. Und dennoch schultert er, als er die fernen Rufe eines Hornsignals hört, das Gewehr, küßt seine Frau auf den Mund und kehrt zurück in den Kampf.
(…)
Aus dem Englischen von Thomas Brovot
SINN UND FORM 2/2022, S. 149-157, hier S. 149-152
Monique Morelli, »La Ville Morte« auf YouTube
