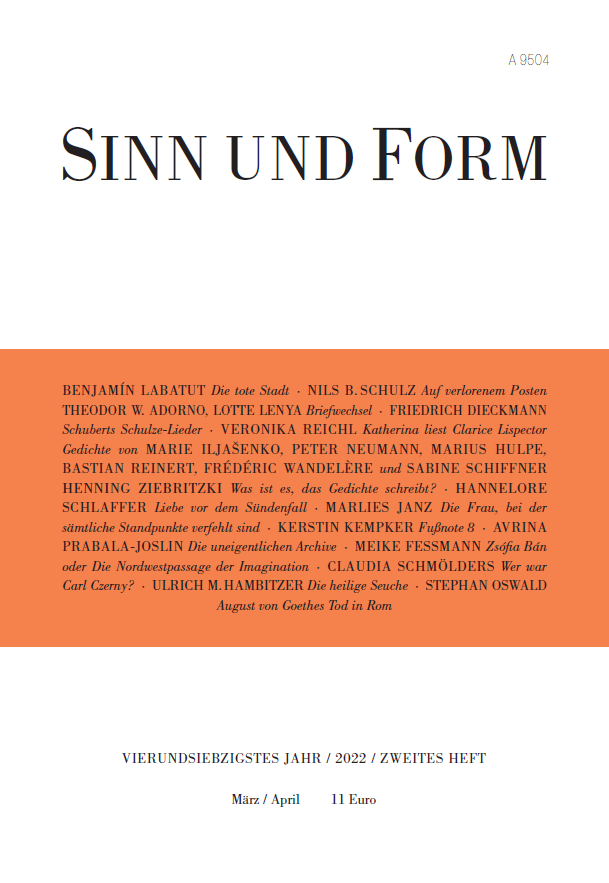
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 2/2022 enthält:
Labatut, Benjamín
Die tote Stadt, S. 149
Vor einigen Jahren, im Oktober 2008, gestand der englische Physiker Freeman Dyson in einer Vorlesung, daß er ein bestimmtes Lied von Monique Morelli (...)
Iljašenko, Marie
Aerodynamik. Gedichte, S. 158
Schulz, Nils B.
Auf verlorenem Posten. Überlegungen zu einer existentiellen Grundstimmung, S. 161
Neumann, Peter
Alles stürzt gemeinsam, S. 178
Adorno, Theodor W.
»Ich habe die Hosen voll, wenn ›ich an Deutschland denke in der Nacht‹«. Briefwechsel mit Lotte Lenya. Mit einer Vorbemerkung von Jens Rosteck, S. 180
Vorbemerkung Kurt Weills plötzlicher Tod im einundfünfzigsten Lebensjahr, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, am 3. April 1950 warf seine Ehefrau (...)
Dieckmann, Friedrich
Ausdruck als Befreiung. Schuberts Schulze-Lieder, S. 196
Hulpe, Marius
Rosige Hand. Gedichte, S. 212
Reichl, Veronika
Die Hummeln summen lauter. Katherina liest Clarice Lispector, S. 215
Katherina hatte schon als Kind die Schönheit schwergenommen: Sie hielt es nicht aus, wenn etwas Schönes verging, ohne ganz gesehen worden zu sein. (...)
Reinert, Bastian
Ein Wort, dem man noch trauen könnte. Gedichte, S. 220
Ziebritzki, Henning
Was ist es, das Gedichte schreibt? Zu Peter Huchel und Thomas Kling , S. 223
Wandelère, Frédéric
Geheimnis des Regens. Gedichte, S. 236
Schlaffer, Hannelore
Liebe vor dem Sündenfall oder Das Paradies im Roman, S. 238
Eine Sammlung von Szenen wäre aus der Weltliteratur, aus Romanen und Erzählungen zusammenzutragen, die vergessen sind und doch nicht hätten (...)
Janz, Marlies
Die Frau, bei der sämtliche Standpunkte verfehlt sind. Walter Serners »Tigerin« im Kontext der Moderne, S. 248
Schiffner, Sabine
Immer geben nur die Armen. Gedichte, S. 255
Kempker, Kerstin
Fußnote 8, S. 258
Prabala-Joslin, Avrina
Das Paradox der uneigentlichen Archive, S. 265
Feßmann, Meike
Zsófia Bán oder Die Nordwestpassage der Imagination, S. 269
Schmölders, Claudia
Wer war Carl Czerny? Nachrichten von Grete Wehmeyer, S. 273
Hambitzer, Ulrich M.
Die heilige Seuche. Meditationen zu einem Gedicht von Stefan George, S. 276
Oswald, Stephan
Das Grabmal als Merkzeichen. August von Goethes Tod in Rom, S. 278
