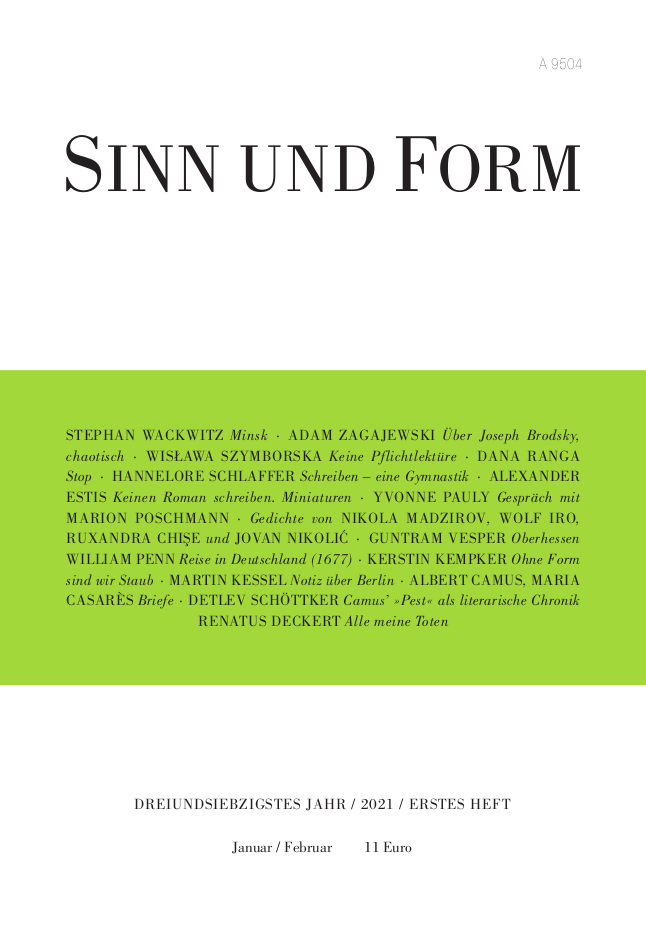
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-57-7
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 1/2021 enthält:
Wackwitz, Stephan
Minsk. Widersprüche der Utopie, S. 5
Wer ehemalige Sowjetrepubliken, die jetzt ihren eigenen politischen Weg gehen, besucht oder für einige Zeit dort lebt, denkt unwillkürlich darüber (...)
Madzirov, Nikola
Das Gewicht des Staubs auf den Augen. Gedichte, S. 21
Zagajewski, Adam
Über Joseph Brodsky, chaotisch, S. 25
Iro, Wolf
Bulgakow revisited. Gedichte, S. 39
Szymborska, Wisława
Keine Pflichtlektüre. Feuilletons, S. 42
Ranga, Dana
Stop. Gedichte, S. 52
Schlaffer, Hannelore
Schreiben. Eine Gymnastik, S. 59
Estis, Alexander
Keinen Roman schreiben. Miniaturen, S. 66
Keinen Roman schreiben Die erste Voraussetzung, um keinen Roman zu schreiben, ist eine rege Phantasie. Ein Mensch mit schwacher Vorstellungskraft (...)
Poschmann, Marion
Unterscheidungskunst. Ein Gespräch mit Yvonne Pauly über poetische Taxonomien, S. 73
YVONNE PAULY: Seit Ihrem Debüt 2002 sind Sie als Romanautorin und Lyrikerin hervorgetreten und für Ihr Werk vielfach ausgezeichnet worden. Ich (...)
Chişe, Ruxandra
Ausbruch aus dem großen Festsaal. Gedichte, S. 86
Vesper, Guntram
Oberhessen, S. 90
Seit vergangenem September, seit ich im Wald am Winterstein, hinter Ockstadt, jenseits der A5, auf der Suche nach Heidruns und meiner versteckten (...)
Nikolić, Jovan
Zirkus. Gedichte, S. 102
Penn, William
Ein Bericht von meiner Reise in Deutschland (1677). Mit einer Vorbemerkung von Jürgen Overhoff , S. 108
Kempker, Kerstin
Ohne Form sind wir Staub. Aus einem Berliner Nachtstück, S. 118
Kessel, Martin
Notiz über Berlin / Von Schauplätzen überhaupt, S. 125
Camus, Albert
Albert Camus, Maria Casarès, »Und doch habe ich gewaltige Pläne«. Drei Briefe, S. 127
Schöttker, Detlev
Zeugenschaft statt Selbstdarstellung. Albert Camus’ »Pest« als literarische Chronik, S. 132
Deckert, Renatus
Alle meine Toten – samt einigen Krokodilen. Schreibanfänge, Lebensenden: Wie aus Krümeln vom Schreibtisch Goldstaub wird, S. 136
