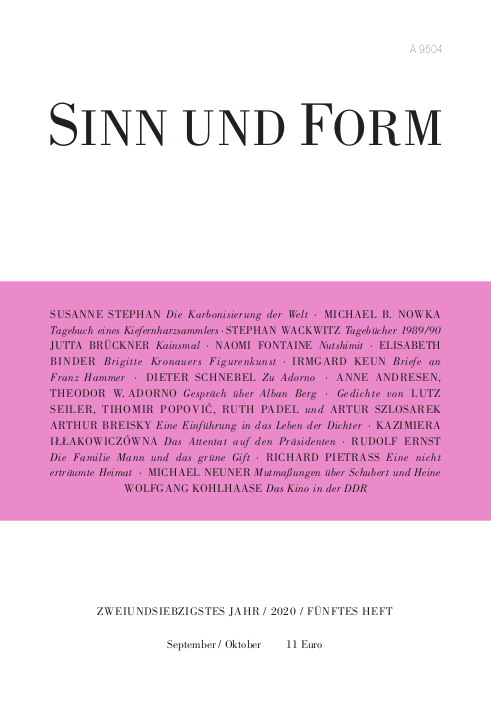
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-55-3
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 5/2020 enthält:
Stephan, Susanne
Novalis und die Karbonisierung der Welt, S. 581
Seiler, Lutz
Prometheus als Kind. Gedichte, S. 593
Nowka, Michael B.
Zweige verwandelt in Hände. Aus dem Tagebuch eines Kiefernharzsammlers (1983 –1990), S. 597
Beschreibung eines geheimen Berufs Wir Harzer in der DDR waren Leistungslöhner. Und Langstreckengeher. Zehn bis zwanzig Kilometer pro Tag und (...)
Wackwitz, Stephan
»Don’t be sadder than necessary«.Tagebücher 1989/90, S. 614
Brückner, Jutta
Kainsmal, S. 629
Fontaine, Naomi
Nutshimit, S. 636
Nutshimit ist das Landesinnere, das Land meiner Vorfahren. Jede Familie kennt ihr Waldstück. Die Seen sind Straßen. Die Flüsse zeigen den Norden (...)
Binder, Elisabeth
Auf Goldgrund. Brigitte Kronauers Figurenkunst, S. 647
Keun, Irmgard
»Sie wollen mich nun mal nicht in Berlin«. Fünf unbekannte Briefe an Franz Hammer. Mit einer Vorbemerkung von Michael Bienert, S. 656
Popović, Tihomir
Drei Préludes. Gedichte , S. 666
Schnebel, Dieter
Zu Adorno, S. 668
Andresen, Anne
»Er hat in keiner Weise an den Erfolg geglaubt«. Gespräch mit Theodor W. Adorno über Alban Berg (1955), S. 670
Padel, Ruth
Mit Beethoven aufwachsen. Gedichte, S. 679
Szlosarek, Artur
Kafka und die Puppe. Prosa und Gedichte, S. 686
Breisky, Arthur
Harlekin – kosmischer Clown. Eine Einführung in das Leben der Dichter. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Gerd Koch, S. 689
Der verschollene Arthur Breisky. Eine Vorbemerkung Amerika war für den jungen Franz Kafka ein verlockendes Ziel. Reiseberichte und Erzählungen (...)
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Das Attentat auf den Präsidenten. Mit einer Vorbemerkung von Lothar Quinkenstein 696, S. 696
Ernst, Rudolf
Die Familie Mann und das grüne Gift , S. 703
Pietraß, Richard
Eine nicht erträumte Heimat. Vorstellungsrede an der Darmstädter Akademie, S. 705
Neuner, Michael
Noch ein Wanderer. Mutmaßungen über Franz Schubert und Heinrich Heine, S. 707
Kohlhaase, Wolfgang
Nachrichten aus der Welt. Das Kino in der DDR, S. 711
