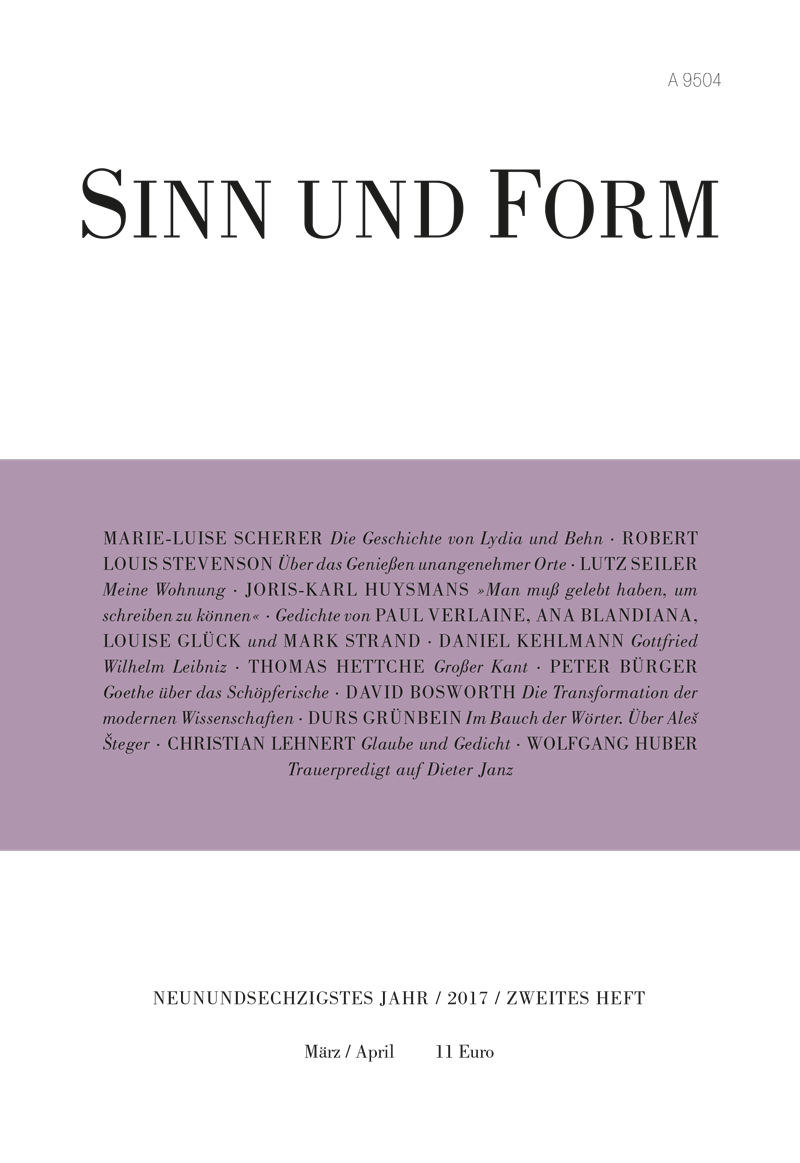Heft 2/2017 enthält:
Scherer, Marie-Luise
Die Geschichte von Lydia und Behn, S. 149
Lydia Proske verbrachte die Wochenenden mit Hubertus Behn auf dem Lande. Sie hatten die Klappräder dabei, die einzige gemeinsame Anschaffung, zu (...)
Glück, Louise
Abenteuer. Gedichte, S. 174
ERINNERUNGSTHEORIE Vor langer Zeit, lang bevor ich zu einer leidenden Künstlerin wurde, die vor Sehnsucht vergeht, aber unfähig zu dauerhaften (...)
Stevenson, Robert Louis
Über das Genießen unangenehmer Orte, S. 181
Aus einem beliebigen Ort das Beste zu machen ist schwierig, und vieles liegt in unserer Macht. Was man geduldig Seite für Seite betrachtet, zeigt am (...)
Blandiana, Ana
Mysterien. Gedichte, S. 187
Seiler, Lutz
Meine Wohnung, S. 190
Strand, Mark
Gedicht nach den sieben letzten Worten, S. 201
Huysmans, Joris-Karl
»Man muß gelebt haben, um schreiben zu können«. Paul Verlaines religiöse Gedichte, S. 204
Ich habe auf diesen wenigen Seiten keineswegs vor, das Werk Verlaines aus literarischer Sicht zu behandeln. Diese Arbeit ist schon oft geleistet (...)
Verlaine, Paul
Fröhliche Heilige und traurige Sünder. Gedichte, S. 213
Kehlmann, Daniel
Der Palast der Perspektiven. Über Gottfried Wilhelm Leibniz, S. 220
Hettche, Thomas
Großer Kant. Überlegungen zur aktuellen Verbindung von Denken und Erzählen, S. 230
Bürger, Peter
Konzentration und Expansion. Goethe über das Schöpferische, S. 241
Bosworth, David
Gewissenhaftes Denken und die Transformation der modernen Wissenschaften, S. 251
Eine gleichsam post-moderne Denkweise hat unsere Wissenschaften reformiert, mit Folgen, die wir uns noch vor Augen führen müssen. Trotz der (...)
Grünbein, Durs
Im Bauch der Wörter. Laudatio auf Aleš Šteger zum Horst-Bienek-Preis, S. 271
Lehnert, Christian
Glaube und Gedicht. Dankrede zum Eichendorff-Literaturpreis, S. 279
Huber, Wolfgang
»Seid männlich und seid stark«. Trauerpredigt auf Dieter Janz, S. 282