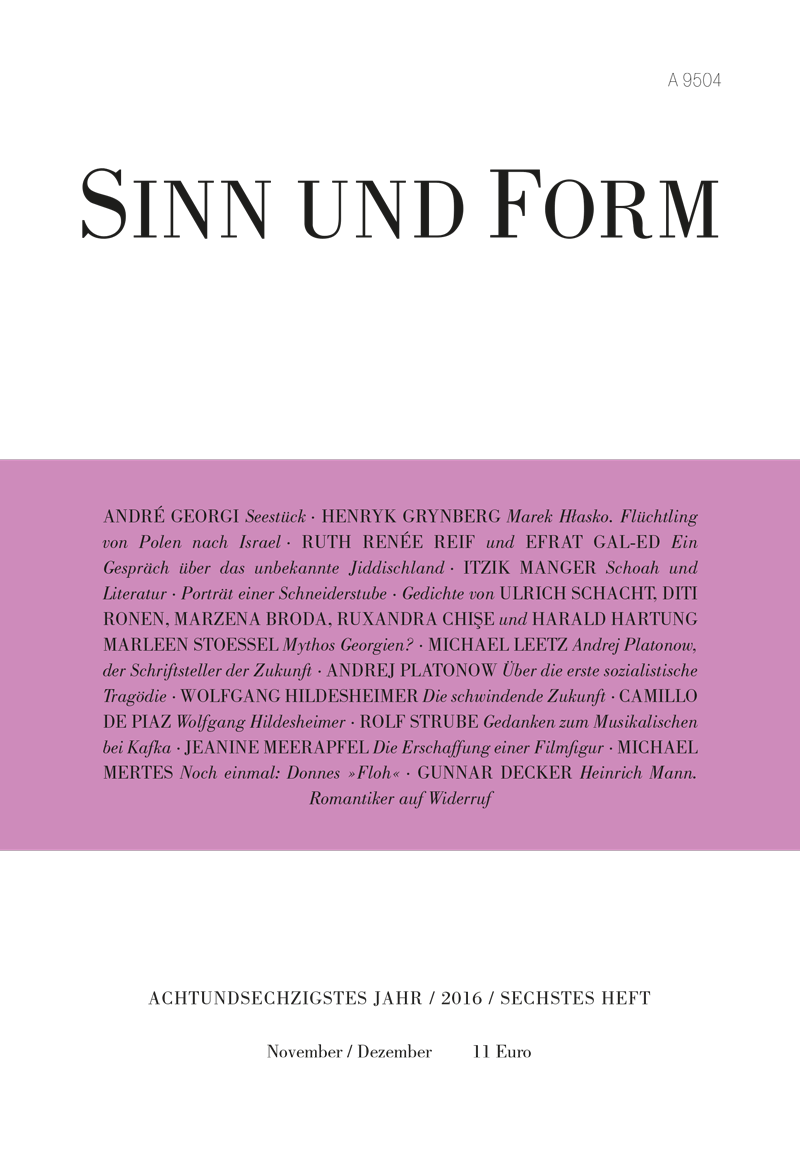Heft 6/2016 enthält:
Georgi, André
Seestück, S. 725
Sand wie verdreckter Schnee, darüber ein Meer, das seine weißen Schaumkronen dem Strand entgegenspült, tiefblau, die Farbe des Todes, der Himmel (...)
Schacht, Ulrich
Vom Licht über Skagen. Drei Balladen, S. 732
Grynberg, Henryk
Mahetschko. Marek Hłasko, Flüchtling von Polen nach Israel, S. 735
Ronen, Diti
Kleines Drossel, S. 745
Gal-Ed, Efrat
Das unbekannte Jiddischland. Ein Gespräch mit Ruth Renée Reif über Itzik Manger, S. 753
RUTH RENÉE REIF: Der »Prinz der jiddischen Ballade« wurde Itzik Manger genannt. Isaac Bashevis Singer sah in ihm einen »jiddischen Baudelaire«, (...)
Manger, Itzik
Schoah und Literatur, S. 762
Manger, Itzik
Porträt einer Schneiderstube, S. 765
Broda, Marzena
Jetzt kann alles geschehen, S. 775
Stoessel, Marleen
Mythos Georgien?, S. 779
Dies sind nur tastende Worte der Annäherung an ein Land, eine Stadt, Tbilisi, die sich mir vor allem im Hitzeschleier zeigte, in einer Dunstglocke, (...)
Leetz, Michael
»Der erste, der wirklich alles verstanden hat«. Andrej Platonow, der Schriftsteller der Zukunft, S. 790
Im Dezember 1934 bereitet den Redakteuren des Almanachs »Zwei Fünfjahrpläne« ein Beitrag großes Kopfzerbrechen. Er umfaßt nur wenige Seiten, (...)
Platonow, Andrej
Über die erste sozialistische Tragödie, S. 800
Chişe, Ruxandra
Heute wird die Nacht in den Gräsern bleiben. Gedichte, S. 804
Hildesheimer, Wolfgang
Die schwindende Zukunft. Vierte verworfene Fassung. Mit einer Vorbemerkung von Franka Köpp, S. 808
de Piaz, Camillo
Nachruf auf Wolfgang Hildesheimer, S. 820
Hartung, Harald
Vaters Musik. Gedichte, S. 824
Strube, Rolf
Warum schweigen die Sirenen? Gedanken zum Musikalischen bei Kafka, S. 827
Meerapfel, Jeanine
Über Phantasie und Biographie. Die Erschaffung einer Filmfigur, S. 839
Mertes, Michael
Noch einmal: Donnes »Floh«, S. 844
Decker, Gunnar
Ein Romantiker auf Widerruf. Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis 2016, S. 846