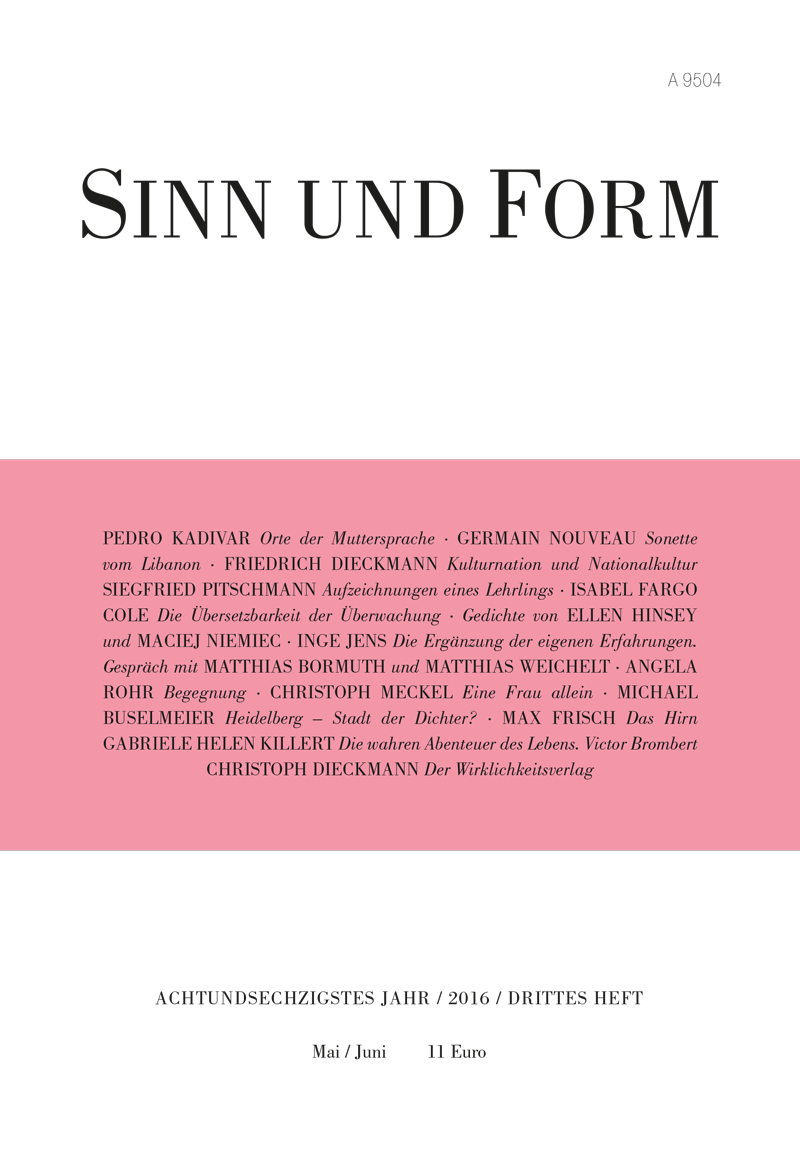Heft 3/2016 enthält:
Kadivar, Pedro
Orte der Muttersprache. Aus dem Kleinen Buch der Migrationen, S. 293
Nouveau, Germain
Sonette vom Libanon und andere Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Frank Stückemann, S. 302
Dieckmann, Friedrich
Kulturnation und Nationalkultur. Von alten und neuen Herausforderungen, S. 312
Pitschmann, Siegfried
Aufzeichnungen eines Lehrlings. Mit einer Vorbemerkung von Kristina Stella, S. 323
Vorbemerkung Siegfried Daniel Pitschmann, ein kaum bekannter ostdeutscher Meister der Short story, wurde am 12. Januar 1930 im niederschlesischen (...)
Cole, Isabel Fargo
Die Übersetzbarkeit der Überwachung. Zu Wolfgang Hilbigs Roman »Ich«, S. 332
Jens, Inge
Die Ergänzung der eigenen Erfahrungen. Ein Gespräch über Schriftsteller und Editionen mit Matthias Bormuth und Matthias Weichelt, S. 341
MATTHIAS WEICHELT: Frau Jens, Sie haben sich vor allem als Herausgeberin einen Namen gemacht, seit Sie in den frühen sechziger Jahren die Briefe (...)
Niemiec, Maciej
Skizze der Flut. Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Renate Schmidgall, S. 353
Rohr, Angela
Begegnung. Mit einer Nachbemerkung von Gesine Bey, S. 359
Meckel, Christoph
Eine Frau allein, S. 372
Hinsey, Ellen
Über den Kampf mit dem Engel. Gedichte, S. 391
Buselmeier, Michael
Heidelberg - Stadt der Dichter?, S. 399
Das Thema erlaubt, ja verlangt es, wie jedes andere hinterfragt zu werden. »Heidelberg – Stadt der Dichter«, ohne Fragezeichen hingesetzt – (...)
Frisch, Max
Das Hirn. Eine Notiz. Mit einer Vorbemerkung von Margit Unser, S. 415
Killert, Gabriele Helen
Die wahren Abenteuer des Lebens. Über Victor Brombert, S. 418
Dieckmann, Christoph
Der Wirklichkeitsverlag. Laudatio zur Verleihung des Kurt-Wolff-Preises an den Ch. Links Verlag, S. 421