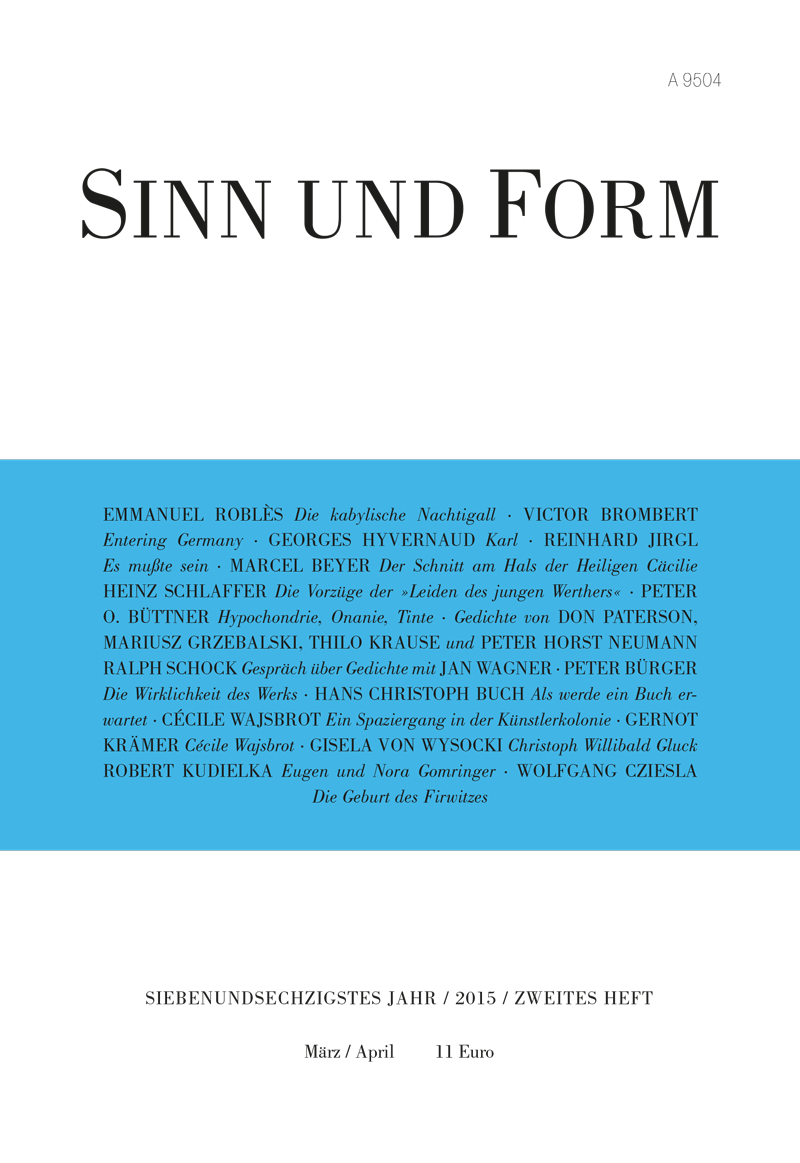Heft 2/2015 enthält:
Roblès, Emmanuel
Die kabylische Nachtigall, S. 149
Paterson, Don
Der Schauder in der linken Hand. Gedichte, S. 156
Brombert, Victor
Entering Germany. Die Schlacht im Hürtgenwald 1944, S. 159
Hyvernaud, Georges
Karl, S. 168
Grzebalski, Mariusz
Der grüne Schnee. Gedichte, S. 173
Jirgl, Reinhard
Es mußte sein, S. 175
Beyer, Marcel
Der Schnitt am Hals der Heiligen Cäcilie, S. 185
Schlaffer, Heinz
Die Vorzüge der »Leiden des jungen
Werthers«, S. 195
Leicht ist es, Goethes »Werther« ein vorzügliches Buch zu nennen, schwer jedoch, diese Vorzüge zu bestimmen. ›Vorzüge‹ soll wörtlich (...)
Büttner, Peter O.
Federschreiben in Zeiten der Aufklärung. Hypochondrie, Onanie, Tinte, S. 205
Krause, Thilo
Nur ein paar Vögel. Gedichte, S. 211
Schock, Ralph
»Eine andere Wahrnehmung der Welt«.
Ein Gespräch über Gedichte mit Jan Wagner, S. 214
RALPH SCHOCK: Ihr neuer Gedichtband »Regentonnenvariationen« ist vor einigen Monaten erschienen. Ich habe Sie in Frankfurt während der Buchmesse (...)
Neumann, Peter Horst
In Muzot bei Rilke. Gedichte, S. 229
Bürger, Peter
Die Wirklichkeit des Werks. Zur Ästhetik Rainer Maria Rilkes und Lou Andreas-Salomés, S. 232
Buch, Hans Christoph
Als werde ein Buch erwartet. Erinnerungen an den Literaturbetrieb (I), S. 242
1 »Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet.« Diese Definition der (...)
Wajsbrot, Cécile
Echos eines Spaziergangs in der Künstlerkolonie, S. 253
Krämer, Gernot
Literatur als geteilte Erfahrung. Laudatio auf Cécile Wajsbrot, S. 267
Wysocki, Gisela von
Einer, dem der Kragen zu eng wurde. Über Christoph Willibald Gluck, S. 270
Kudielka, Robert
Sternbilder, Atem und Stimme. Über Eugen und Nora Gomringer, S. 275
Cziesla, Wolfgang
Die Geburt des Firwitzes, S. 278