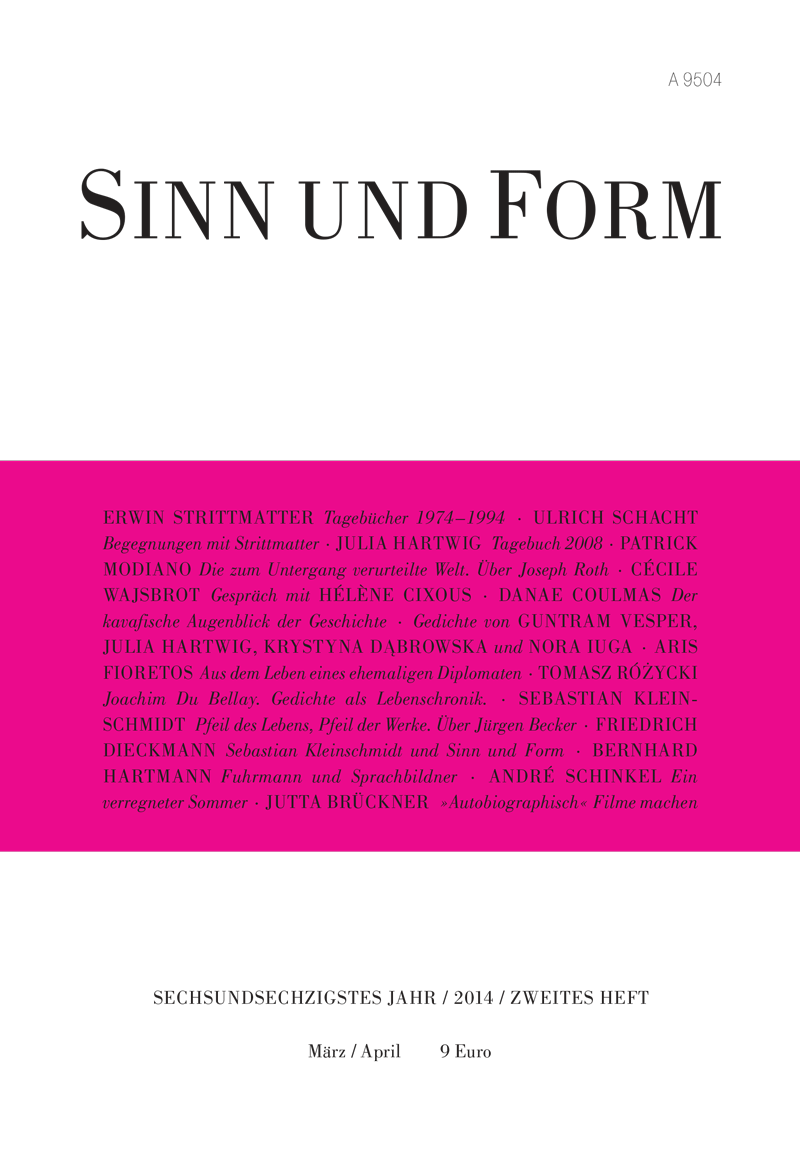Heft 2/2014 enthält:
Strittmatter, Erwin
»Ich denke, es war so.« Aus den Tagebüchern 1974 - 1994, S. 149
Schacht, Ulrich
Dem Geheimnis der Glaubwürdigkeit auf die Spur kommen. Begegnungen mit Erwin Strittmatter, S. 170
I Warum einer Bäcker werden will? In meinem Fall erinnere ich mich an den Grund genau. Ich war gerade mal vierzehn, die Lust am Spielen war immer (...)
Vesper, Guntram
Wandertag, S. 182
Hartwig, Julia
»Es gibt eine Poesie der Ordnung und eine Poesie des Wahns«. Aus dem Tagebuch 2008, S. 189
Hartwig, Julia
Wohin gehöre ich. Amerikanische Gedichte, S. 196
DIESER SONNENUNTERGANG
Dieser unvergleichliche Sonnenuntergang, dargebracht im täglichen Opfer.
Ite missa est. Der Tag ist vorüber. Der (...)
Modiano, Patrick
Die zum Untergang verurteilte Welt. Über Joseph Roth, S. 203
Wajsbrot, Cécile
»Osnabrück ist das verlorene Paradies, nur nicht für mich.« Gespräch mit Hélène Cixous, S. 214
Vorbemerkung Ich hatte in den siebziger Jahren einiges von Hélène Cixous gelesen, vor allem »Angst«, aber auch ihre Essays, ich wußte von (...)
Coulmas, Danae
Der kavafische Augenblick der Geschichte. Eine Prosopographie, S. 223
Dąbrowska, Krystyna
Das Bett von Kavafis. Gedichte, S. 237
Fioretos, Aris
Termiten. Aus dem Leben eines ehemaligen Diplomaten, S. 239
Iuga, Nora
Eine Reise ans Ende der Welt. Gedichte, S. 244
Różycki, Tomasz
Gedichte als Lebenschronik. Über Joachim Du Bellay, S. 247
Ich weiß nicht, warum ich diese Gedichte gefunden habe, die Frage ist sogar etwas absurd. Von allen möglichen Gründen, potentiellen und realen (...)
Kleinschmidt, Sebastian
Der Pfeil des Lebens und der Pfeil der Werke. Laudatio zum Günter-Eich-Preis auf Jürgen Becker, S. 256
Der polnische Dichter Adam Zagajewski hat vor vielen Jahren ein langes, wehmütiges Gedicht mit dem Titel »Elektrische Elegie« geschrieben. Es (...)
Dieckmann, Friedrich
»Insel in sehr unterschiedlichen Meeren.« Sebastian Kleinschmidt und Sinn und Form, S. 265
Hartmann, Bernhard
Ob Sprachbildner, ob Fuhrmann – ich bin Übersetzer. Dankrede zum Karl-Dedecius-Preis, S. 273
Schinkel, André
Topographie eines verregneten Sommers. Dankrede zum Walter-Bauer-Preis, S. 275
Brückner, Jutta
»Autobiographisch« Filme machen, S. 278