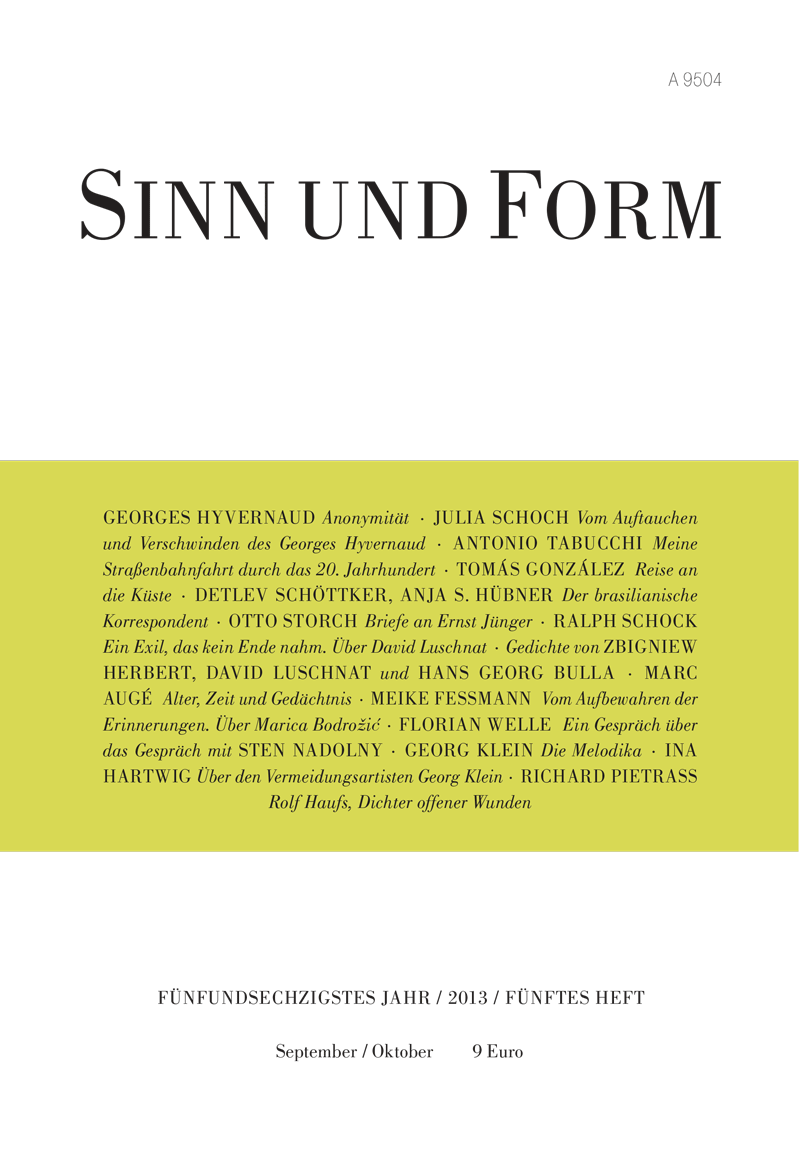Heft 5/2013 enthält:
Hyvernaud, Georges
Anonymität, S. 629
Schoch, Julia
Literatur als Rache. Vom Auftauchen und Verschwinden des Georges Hyvernaud, S. 636
I Die Aufmerksamkeit, die einem Schriftsteller zuteil wird, ist nicht nur von seinem literarischen Können abhängig. In beträchtlichem Maße (...)
Herbert, Zbigniew
Ein Fels der im Meere wächst und nicht benannt werden will. Gedichte, S. 643
Tabucchi, Antonio
Meine Straßenbahnfahrt durch das 20. Jahrhundert, S. 647
González, Tomás
Reise an die Küste, S. 657
Für Don Gabriel
diese Geschichte, die aus dem wenigen entstand, das ich weiß oder erinnere, und dem unendlich vielen, das ich nicht weiß (...)
Hübner, Anja S. und Schöttker, Detlev
Der brasilianische Korrespondent. Auf der Suche nach Otto Storch, S. 672
In einer der Aufzeichnungen über den Begriff der Geschichte, an denen Walter Benjamin bis kurz vor seinem Tod im September 1940 arbeitete, steht (...)
Storch, Otto
Briefe an Ernst Jünger 1936-1939. Mit Kommentaren von Detlev Schöttker und Anja S. Hübner, S. 685
Schock, Ralph
Ein Exil, das kein Ende nahm. Über David Luschnat, S. 707
Am 19. November 1934 schickte Joseph Roth einen verzweifelten Bittbrief in die Schweiz. Ein Kollege war in Not: »Lieber Herr Carl Seelig, (...)
Luschnat, David
Die Nacht schmilzt wie Wachs. Gedichte, S. 715
Bulla, Hans Georg
Die meergrauen Seiten. Gedichte, S. 718
Augé, Marc
Alter, Zeit und Gedächtnis, S. 721
Feßmann, Meike
Vom Aufbewahren der Erinnerungen. Über Marica Bodrozic, S. 731
Nadolny, Sten
»Das Schweigen gehört dazu«. Ein Gespräch über das Gespräch mit Florian Welle, S. 739
Klein, Georg
Die Melodika, S. 751
Hartwig, Ina
Mit dem Kitsch gegen den Kitsch. Über den Vermeidungsartisten Georg Klein, S. 757
Pietraß, Richard
Dichter offener Wunden. Grabrede für Rolf Haufs, S. 762