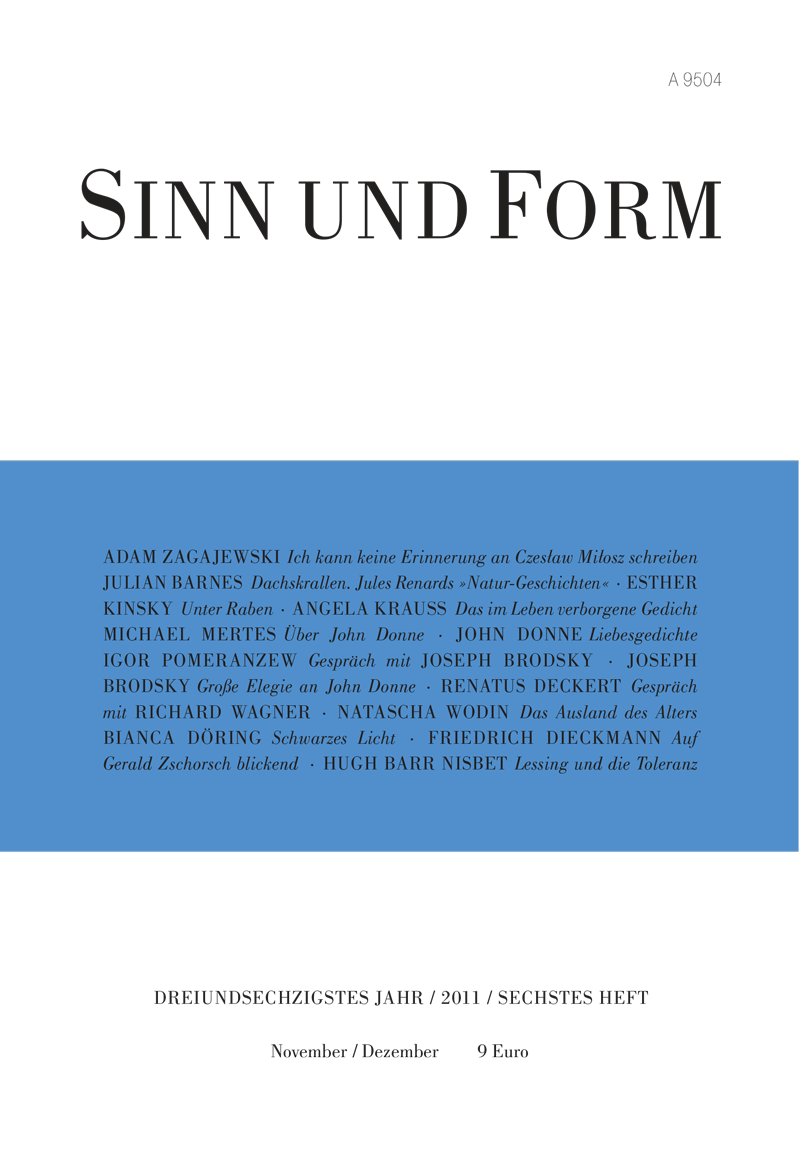Heft 6/2011 enthält:
Zagajewski, Adam
Ich kann keine Erinnerung an Czeslaw Milosz schreiben, S. 725
Barnes, Julian
Dachskrallen. Jules Renards »Natur-Geschichten«, S. 732
Kinsky, Esther
Unter Raben, S. 739
Krauß, Angela
Das im Leben verborgene Gedicht, S. 743
Im Frühling 2005 war es, als mich Paul Michael Lützeler im Rahmen des Max-Kade-Programms an die Washington University nach St. Louis einlud, mit (...)
Mertes, Michael
Geometrie, Himmelsmechanik und Kosmologie der Liebe. Über John Donne, S. 758
Donne, John
Liebesgedichte. Übertragen von Michael Mertes, S. 762
Pomeranzew, Igor
Gespräch mit Joseph Brodsky über John Donne, S. 782
Brodsky, Joseph
Große Elegie an John Donne, S. 787
Deckert, Renatus
»Das ist eine untergegangene Welt.« Gespräch mit Richard Wagner, S. 793
RENATUS DECKERT: Ihre Eltern haben Sie Richard Wagner genannt. Das kann ja kaum Zufall sein. Gehe ich recht in der Annahme, daß Ihre Eltern (...)
Wodin, Natascha
Das Ausland des Alters, S. 814
Zuerst hatte sie geglaubt, die Schwäche, mit der sie eines Morgens aufgewacht war, sei eine der ganz gewöhnlichen kleinen Unpäßlichkeiten, die (...)
Döring, Bianca
Schwarzes Licht, S. 838
Dieckmann, Friedrich
Auf Gerald Zschorsch blickend, S. 847
Nisbet, Hugh Barr
Lessing und die Toleranz, S. 851