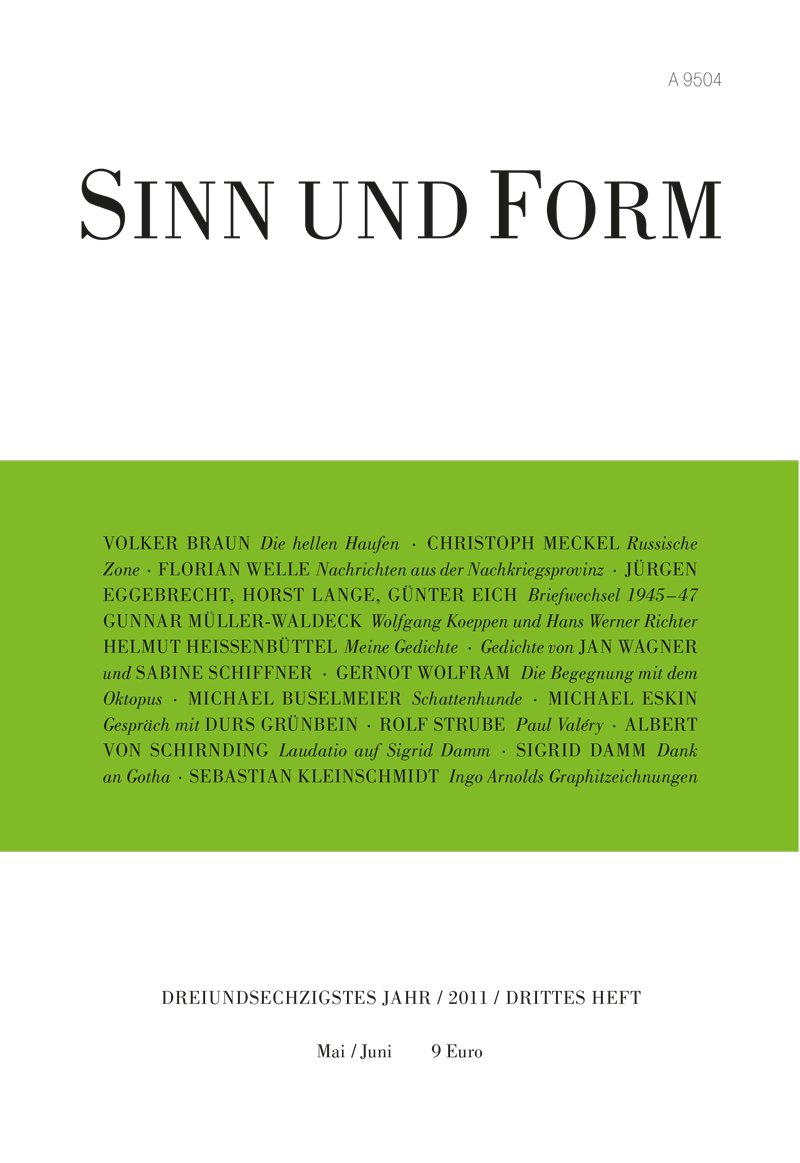Heft 3/2011 enthält:
Braun, Volker
Die hellen Haufen, S. 293
Meckel, Christoph
Russische Zone, S. 304
Die letzten Tage des Kriegs und die ersten des Nachkriegs glichen einander grau in grau. Für das Wort Frieden war die Zeit zu früh, ich hatte es (...)
Welle, Florian
Nachrichten aus der Nachkriegsprovinz. Günter Eich, Jürgen Eggebrecht, Horst Lange, S. 322
Jürgen Eggebrecht und Günter Eich kannten sich und kannten sich doch nicht: 1927, in der von Klaus Mann und Willi R. Fehse verantworteten (...)
Eich, Günter
Briefwechsel 1945-47, S. 330
Müller-Waldeck, Gunnar
Wolfgang Koeppen an Hans Werner Richter: »Wir hätten uns treffen sollen«. Zweimal Jugend in Pommern, S. 354
Heißenbüttel, Helmut
Meine Gedichte, S. 364
Wagner, Jan
Gedichte, S. 375
Schiffner, Sabine
Gedichte, S. 379
Wolfram, Gernot
Die Begegnung mit dem Oktopus, S. 382
Buselmeier, Michael
Schattenhunde / Nachträge zu Dante, S. 386
Grünbein, Durs
Tauchen mit Descartes. Gespräch mit Michael Eskin, S. 389
MICHAEL ESKIN: Sie haben einmal gesagt, »Der cartesische Taucher« sei Ihr vielleicht wichtigstes Buch. Könnten Sie das näher erläutern? DURS (...)
Strube, Rolf
Von der Musik der Ideen. Paul Valéry - Dichter, Philosoph, Europäer, S. 403
Paul Valéry hat zeitlebens über die Sprache nachgedacht. »Den Dichter«, sagt er einmal, erkennt man »an der einfachen Tatsache, daß er den (...)
Schirnding, Albert von
Nel gotha della letteratura contemporanea tedesca... Laudatio auf Sigrid Damm, S. 415
Damm, Sigrid
Dank an Gotha, S. 421
Kleinschmidt, Sebastian
Bleistift - Brücke nach Hause. Ingo Arnolds Graphitzeichnungen, S. 425