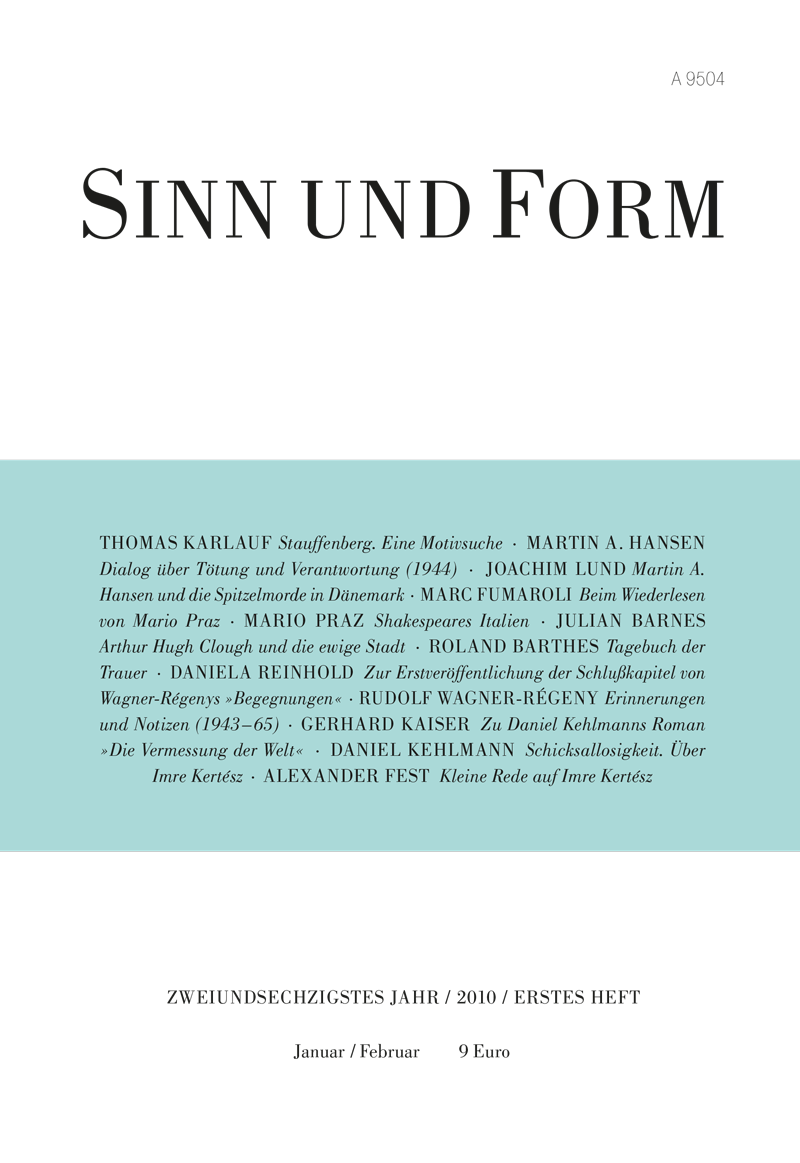Heft 1/2010 enthält:
Karlauf, Thomas
Stauffenberg. Eine Motivsuche, S. 5
Nichts unheimlicher im Leben der Völker als das
langsame Nachwirken der historischen Schuld.
Treitschke
Wie die meisten Autoren, die sich (...)
Hansen, Martin A.
Dialog über Tötung und Veranwortung (1944), S. 18
Lund, Joachim
Den Feind bekämpft man nicht mit Vaterlandsliedern. Martin A. Hansen und die Spitzelmorde in Dänemark, S. 27
Fumaroli, Marc
Beim Wiederlesen von Mario Praz, S. 35
Aber ich weiß auch, daß man oft meint, ich
sage etwas Neues, wenn ich etwas Altes sage,
das aber die meisten noch nie gehört haben. (...)
Praz, Mario
Shakespeares Italien, S. 55
Barnes, Julian
In Rom weilend... Arthur Hugh Clough und die ewige Stadt, S. 71
Barthes, Roland
Tagebuch der Trauer, S. 78
Reinhold, Daniela
Distanz und Unverständnis. Zur Erstveröffentlichung der beiden Schlußkapitel von Rudolf Wagner-Régenys »Begegnungen«, S. 83
Wagner-Régeny, Rudolf
Erinnerungen und Notizen (1943-65), S. 92
Aus dem Archiv der Akademie der Künste Es ist unwahrscheinlich, und nur der Erlebende vermag es zu bestätigen, daß eine restlose Zerstörung (...)
Kaiser, Gerhard
Erzählen im Zeitalter der Naturwissenschaft. Zu Daniel Kehlmanns Roman »Die Vermessung der Welt«, S. 122
Kehlmann, Daniel
Schicksallosigkeit. Rede auf Imre Kertész, S. 135
Fest, Alexander
Kleine Rede auf Imre Kertész, S. 139