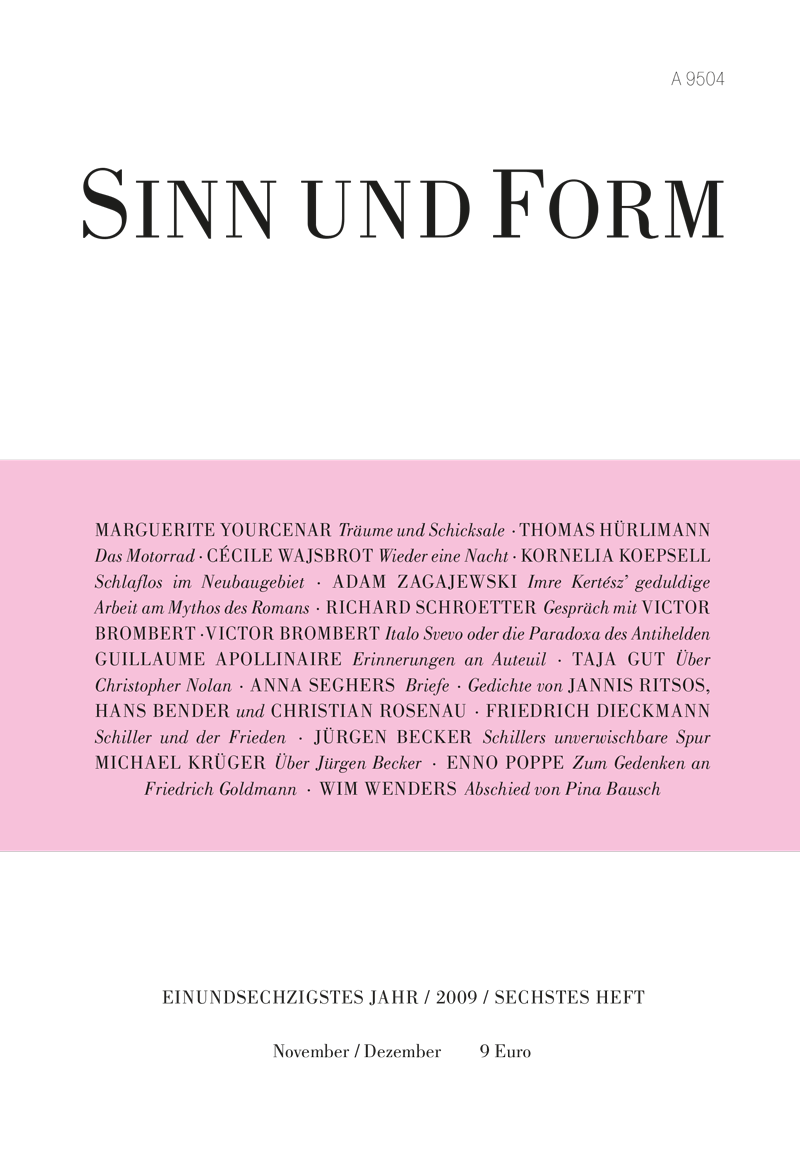Heft 6/2009 enthält:
Yourcenar, Marguerite
Träume und Schicksale, S. 725
Die Wachenden haben eine einzige und
gemeinsame Welt, die Schlafenden aber
wenden sich ihrer eigenen Welt zu.
Heraklit von Ephesus
(...)
Hürlimann, Thomas
Das Motorrad, S. 741
Wajsbrot, Cécile
Wieder eine Nacht, S. 745
Wieder eine Nacht, in der ich nicht schlafe. Ich hatte auf Schlaf gehofft; als ich ins Bett ging, konnte ich die Müdigkeit schon fast mit Händen (...)
Koepsell, Kornelia
Schlaflos im Neubaugebiet. Gedichte, S. 747
Zagajewski, Adam
Über die Treue. Imre Kertész' geduldige Arbeit am Mythos des Romans, S. 751
Im Prado hängt ein Bild von Francisco de Zurbarán, das Christus am Kreuz zeigt; zu seinen Füßen stehen aber nicht die traditionellen Figuren der (...)
Brombert, Victor
Gespräch mit Richard Schroetter. »Wir ahnten nicht, was kommen würde«, S. 757
RICHARD SCHROETTER: Man kennt Sie als einen der führenden amerikanischen Komparatisten, als Romanisten und Literaturkritiker, aber auch aus dem Film (...)
Brombert, Victor
Italo Svevo oder die Paradoxa des Antihelden, S. 768
Apollinaire, Guillaume
Erinnerungen an Auteuil, S. 783
Gut, Taja
In die Sprache gerettet. Über Christopher Nolan, S. 788
Seghers, Anna
Briefe, S. 798
Ritsos, Jannis
Aus den »Tanagra-Figuren« (Januar 1967), S. 804
Bender, Hans
Zwölf Vierzeiler, S. 807
Rosenau, Christian
Gedichte, S. 810
Dieckmann, Friedrich
Schiller und der Frieden, S. 814
Becker, Jürgen
Schillers unverwischbare Spur, S. 841
Krüger, Michael
»So war es, wie Du erzählst, aber dann sagtest Du: Alles war anders.« Über Jürgen Becker, S. 846
Poppe, Enno
Zum Gedenken an Friedrich Goldmann, S. 852
Wenders, Wim
Was Menschen mit ihren Bewegungen sagen. Die Kunst der Pina Bausch, S. 854
Festrede zum Frankfurter Goethepreis 2008
In unserer Gesellschaft ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben es immer häufiger mit (...)