Recherchierbar sind hier alle Beiträge von heute zurück bis einschließlich 1949.
Bestellbar sind, sofern nicht anders vermerkt, alle Hefte der letzten Jahre bis einschließlich 1992.
Als PDF-Download stehen alle Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute zur Verfügung.
-
1/2022
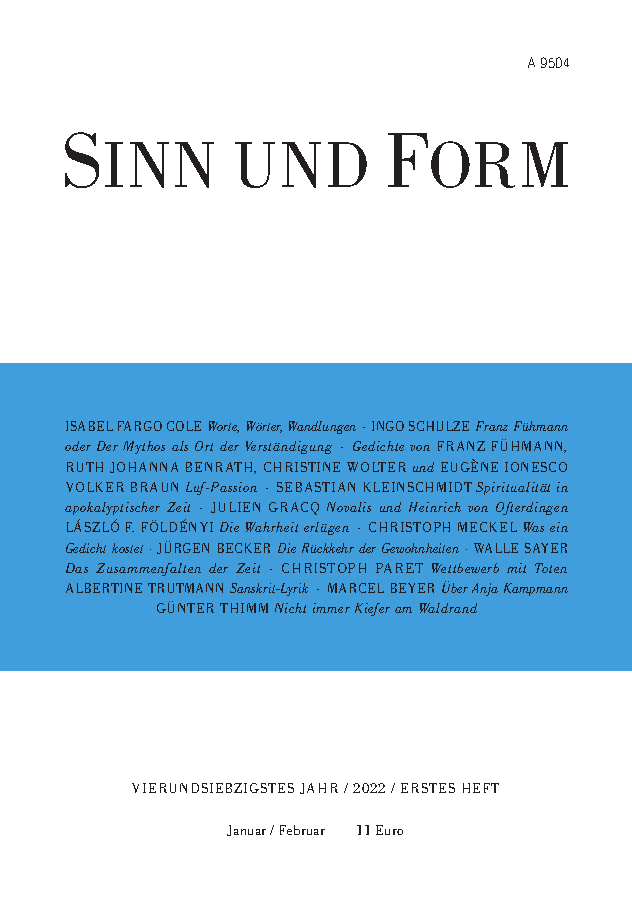
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-63-8
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 1/2022 enthält:
Cole, Isabel Fargo
Worte, Wörter, Wandlungen. Widerspruchseinheiten aus Franz Fühmanns Zettelkästen, S. 5Fühmann, Franz
Das Ungefähre gilt nicht mehr. Frühe Gedichte (1953 / 54), S. 15Schulze, Ingo
»Ich möchte Ihnen Hoffnung machen« Franz Fühmann oder Der Mythos als Ort der Verständigung, S. 20Anfang Juli 1984 wartete ich in der Sektion Altertumswissenschaften der Uni Jena darauf, zu meiner ersten mündlichen Prüfung (Grundkurs (...)
LeseprobeBraun, Volker
Luf-Passion, S. 32Kleinschmidt, Sebastian
Menschenferne und Gottesnähe. Spiritualität in apokalyptischer Zeit, S. 44[…]
Aber ist die Corona-Krise vielleicht nur ein Vorspiel, das Menetekel für etwas, das noch kommt und das weit schlimmer ausfällt? Ich (...)LeseprobeBenrath, Ruth Johanna
Psalm. Aus der Tieffen. Gedichte, S. 57Gracq, Julien
Novalis und Heinrich von Ofterdingen, S. 61Wolter, Christine
Dante, ein paar Anmerkungen. Gedicht, S. 75Földényi, László F.
Die Wahrheit erlügen. Über die Schwierigkeiten biographischen Schreibens, S. 79Ionesco, Eugène
Elegien für kleine Wesen. Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Alexandru Bulucz, S. 90Meckel, Christoph
Was ein Gedicht kostet. Mit einer Vorbemerkung von Marie-Luise Bott, S. 99Becker, Jürgen
Die Rückkehr der Gewohnheiten. Journalgedichte, S. 109Sayer, Walle
Das Zusammenfalten der Zeit, S. 114Paret, Christoph
Wettbewerb mit Toten. Über eine eigentümliche Rezeptionstheorie Boris Groys’, S. 124Ist es trotz oder wegen der Publikationsflut unserer Tage, daß die Ratgeber, die ich mir eigentlich wünschen würde, partout nicht erscheinen (...)
LeseprobeTrutmann, Albertine
Sanskrit-Lyrik auf deutsch? Von der Schwierigkeit, Murāris Gedichte zu übersetzen, S. 128Beyer, Marcel
»Und wie geht der Gesang«. Laudatio auf Anja Kampmann, S. 132Thimm, Günter
Nicht immer Kiefer am Waldrand, S. 137
Printausgabe bestellen
2/2022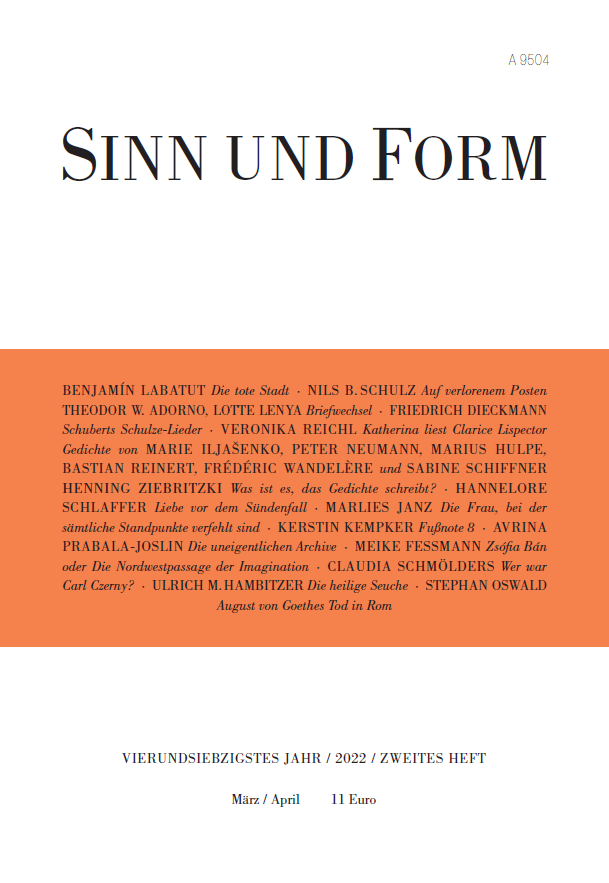
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 2/2022 enthält:
Labatut, Benjamín
Die tote Stadt, S. 149Vor einigen Jahren, im Oktober 2008, gestand der englische Physiker Freeman Dyson in einer Vorlesung, daß er ein bestimmtes Lied von Monique Morelli (...)
LeseprobeIljašenko, Marie
Aerodynamik. Gedichte, S. 158Schulz, Nils B.
Auf verlorenem Posten. Überlegungen zu einer existentiellen Grundstimmung, S. 161Neumann, Peter
Alles stürzt gemeinsam, S. 178Adorno, Theodor W.
»Ich habe die Hosen voll, wenn ›ich an Deutschland denke in der Nacht‹«. Briefwechsel mit Lotte Lenya. Mit einer Vorbemerkung von Jens Rosteck, S. 180Vorbemerkung Kurt Weills plötzlicher Tod im einundfünfzigsten Lebensjahr, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, am 3. April 1950 warf seine Ehefrau (...)
LeseprobeDieckmann, Friedrich
Ausdruck als Befreiung. Schuberts Schulze-Lieder, S. 196Hulpe, Marius
Rosige Hand. Gedichte, S. 212Reichl, Veronika
Die Hummeln summen lauter. Katherina liest Clarice Lispector, S. 215Katherina hatte schon als Kind die Schönheit schwergenommen: Sie hielt es nicht aus, wenn etwas Schönes verging, ohne ganz gesehen worden zu sein. (...)
LeseprobeReinert, Bastian
Ein Wort, dem man noch trauen könnte. Gedichte, S. 220Ziebritzki, Henning
Was ist es, das Gedichte schreibt? Zu Peter Huchel und Thomas Kling , S. 223Wandelère, Frédéric
Geheimnis des Regens. Gedichte, S. 236Schlaffer, Hannelore
Liebe vor dem Sündenfall oder Das Paradies im Roman, S. 238Eine Sammlung von Szenen wäre aus der Weltliteratur, aus Romanen und Erzählungen zusammenzutragen, die vergessen sind und doch nicht hätten (...)
LeseprobeJanz, Marlies
Die Frau, bei der sämtliche Standpunkte verfehlt sind. Walter Serners »Tigerin« im Kontext der Moderne, S. 248Schiffner, Sabine
Immer geben nur die Armen. Gedichte, S. 255Kempker, Kerstin
Fußnote 8, S. 258Prabala-Joslin, Avrina
Das Paradox der uneigentlichen Archive, S. 265Feßmann, Meike
Zsófia Bán oder Die Nordwestpassage der Imagination, S. 269Schmölders, Claudia
Wer war Carl Czerny? Nachrichten von Grete Wehmeyer, S. 273Hambitzer, Ulrich M.
Die heilige Seuche. Meditationen zu einem Gedicht von Stefan George, S. 276Oswald, Stephan
Das Grabmal als Merkzeichen. August von Goethes Tod in Rom, S. 278
Printausgabe bestellen
3/2022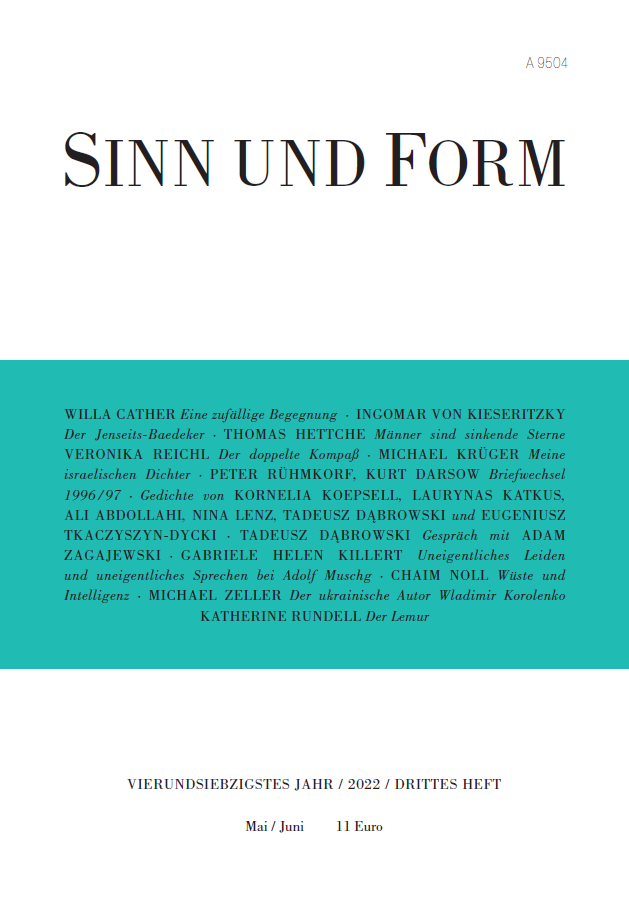
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-65-2
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 3/2022 enthält:
Cather, Willa
Eine zufällige Begegnung, S. 293Koepsell, Kornelia
Klage um Dostojewski. Gedichte, S. 309Kieseritzky, Ingomar von
Der Jenseits-Baedeker, S. 316Hettche, Thomas
Männer sind sinkende Sterne. Tübinger Poetikvorlesung, S. 325Katkus, Laurynas
Auf der Rolltreppe gegen die Laufrichtung. Gedichte, S. 338Reichl, Veronika
Der doppelte Kompaß, S. 341Abdollahi, Ali
Der gebrochene Blick. Gedichte, S. 346Krüger, Michael
Meine israelischen Dichter, S. 350Lenz, Nina
Salamander. Gedichte, S. 370Rühmkorf, Peter
Träume ausgeklinkt. Briefwechsel mit Kurt Darsow 1996/97. Mit einer Vorbemerkung von Kurt Darsow, S. 372Flugübungen. Eine Vorbemerkung
Hellwache Gegenwartsnähe und profunde Belesenheit schlossen sich für Peter Rühmkorf nie aus. Bis in die (...)LeseprobeDąbrowski, Tadeusz
Wie ein Komet am Himmel. Gedichte, S. 391Dąbrowski, Tadeusz
Demut und Geheimnis. Ein Gespräch mit Adam Zagajewski über polnische Dichtung, Bewunderung und Phantasie, S. 393Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz
Lieder und Ziegel. Gedichte, S. 403Killert, Gabriele Helen
Hypochondrie und Ironie. Uneigentliches Leiden und uneigentliches Sprechen im Werk von Adolf Muschg, S. 406Adolf Muschg ist seit Jahrzehnten schon ein Klassiker der Gegenwartsliteratur. Und wie es so manchem Klassiker ergeht: Er gilt viel und wird wenig (...)
LeseprobeNoll, Chaim
»Aus barer organischer Bedürftigkeit«. Die Wüste als Indikator menschlicher Intelligenz, S. 419Zeller, Michael
Alter europäischer Boden. Der ukrainische Erzähler Wladimir Korolenko, S. 423Der ukrainische Erzähler Wladimir Korolenko Es fing damit an, daß eine Freundin wegen eines Wohnungsumzugs ihre Bücherregale durchforstete. Unter (...)
4/2022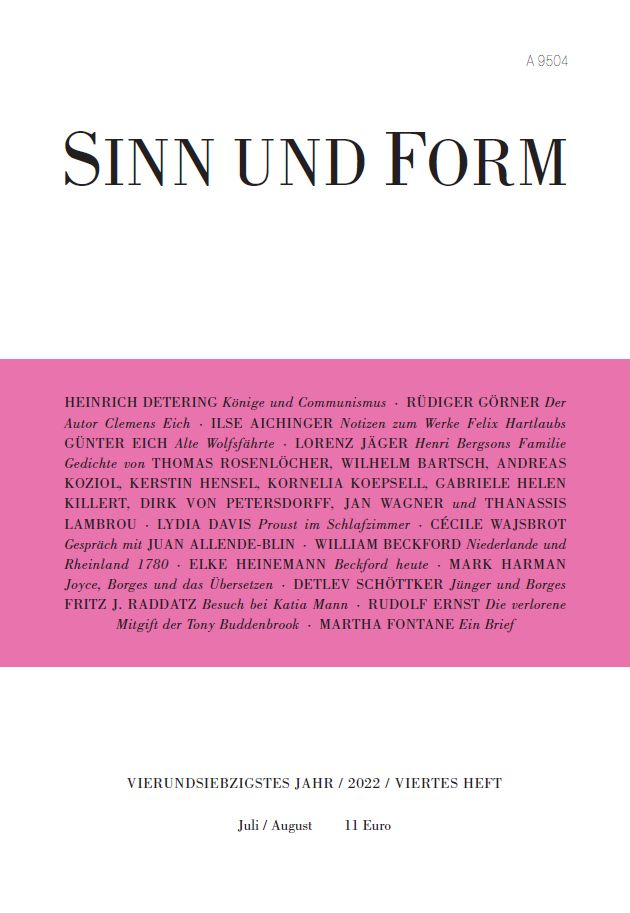
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-66-9
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 4/2022 enthält:
Detering, Heinrich
Könige und Communismus. Eine Erinnerung an Bettine von Arnim 437, S. 437Am offensichtlichsten ist der literarische Übergang von Romantik zu sozialkritischem Realismus im Werk Heinrich Heines, vom »Buch der Lieder« bis (...)
LeseprobeRosenlöcher, Thomas
Mäandertal, S. 450Görner, Rüdiger
»Ich beginne zu wollen, was ich bin« Zum Werk von Clemens Eich, S. 453Aichinger, Ilse
Notizen zum Werke Felix Hartlaubs. Mit einer Vorbemerkung von Andreas Dittrich und Jannis Wagner, S. 463Bartsch, Wilhelm
Die Zukunft geht am Stock. Gedichte, S. 470Eich, Günter
Alte Wolfsfährte. Hörstück. Mit einer Nachbemerkung von Roland Berbig, S. 479Koziol, Andreas
Vom Nebel verschlungen. Gedichte, S. 484Jäger, Lorenz
Henri Bergsons Familie, S. 489Killert, Gabriele Helen
Neue Xenien. Gedichte [Gabriele Helen Killert, Kornelia Koepsell, Kerstin Hensel, Dirk von Petersdorff], S. 497Davis, Lydia
Proust im Schlafzimmer, S. 500Wagner, Jan
Python. Gedichte, S. 512Wajsbrot, Cécile
Ein Gespräch mit Juan Allende-Blin übers Komponieren, über Literatur und Exil, S. 516Beckford, William
Reise durch die Vereinigten Provinzen und das Rheinland im Jahre 1780, S. 522Heinemann, Elke
Versuch über William Beckford im Jahr 2022, S. 5341
Social distancing, ein Schlagwort der Covid-19-Pandemie, läßt nicht von ungefähr an einen Mann denken, der 1760 in England geboren wurde (...)LeseprobeLambrou, Thanassis
Auf dem Hochseil. Gedichte, S. 540Harman, Mark
Borges’scher als Borges? – Joyce, Borges und das Übersetzen, S. 542Schöttker, Detlev
Ernst Jüngers Leser in Buenos Aires. Jorge Luis Borges und die erste Übersetzung der »Stahlgewitter«, S. 549Raddatz, Fritz J.
Besuch bei Katia Mann und Gespräche mit Lou Eisler-Fischer, Charlott Frank und Walter Mehring. Mit einer Nachbemerkung von Joachim Kersten, S. 552Ernst, Rudolf
Die verlorene Mitgift der Tony Buddenbrook, S. 559Tony Buddenbrook mit ihrer charmanten Naivität und ihrem ausgeprägten Standesbewußtsein ist für viele Leser von Thomas Manns »Buddenbrooks« die (...)
LeseprobeFontane, Martha
»Für Papa ist es sehr nöthig, daß er heraus kommt« Ein Brief an Anna Witte. Mit einer Nachbemerkung von Regina Dieterle, S. 562
Printausgabe bestellen
5/2022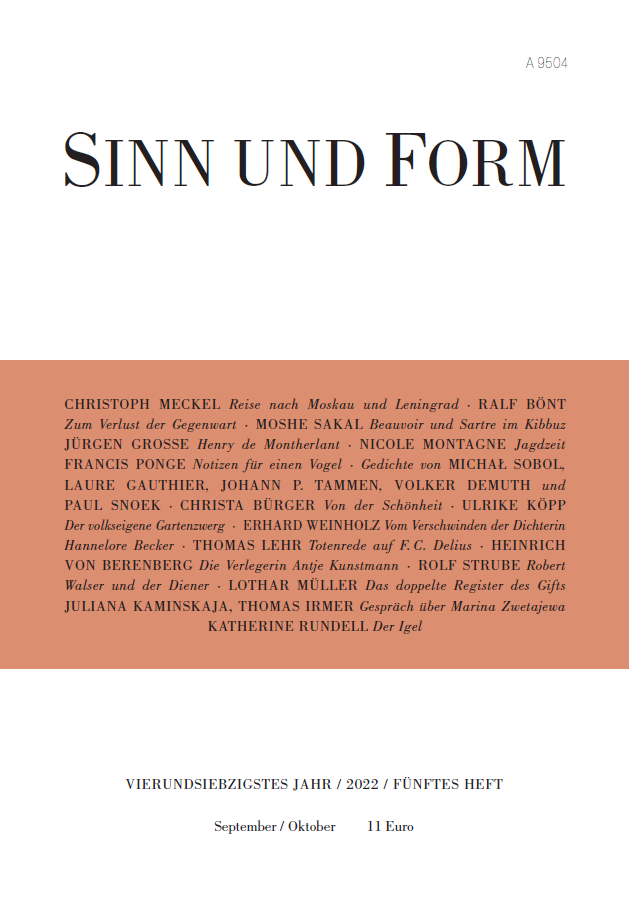
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-67-6
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 5/2022 enthält:
Meckel, Christoph
Reise nach Moskau und Leningrad (April 1972), S. 581Sobol, Michal
Schutzräume. Gedichte, S. 590Bönt, Ralf
Über Unwissende. Versuch zum Verlust der Gegenwart, S. 593Das Ende der Vormoderne:
Die Erosion der Kirche und die Notwendigkeit von Religion
Schon bevor der russische Präsident seinen (...)LeseprobeGauthier, Laure
Rodez-Blues. Gedicht, S. 609Sakal, Moshe
Beauvoir und Sartre im Kibbuz, S. 613Große, Jürgen
Der Dichter, das Mitleid und die Frauen. Über Henry de Montherlant, S. 618Tammen, Johann P.
Kanalwiesengras. Gedichte, S. 633Montagne, Nicole
Jagdzeit, S. 636Demuth, Volker
Sand oder Schnee. Gedichte, S. 643Ponge, Francis
Notizen für einen Vogel, S. 646Bürger, Christa
Von der Schönheit oder Die wirkende Macht des Eros, S. 656Köpp, Ulrike
Der volkseigene Gartenzwerg. Über den Kampf gegen Kitsch in der frühen DDR, S. 664Im Sommer 1947 warb ein Plakat für den Besuch einer Ausstellung im Weimarer Schloß: »Gegen die Ausbeutung des Volkes durch Kitsch«. Den (...)
LeseprobeSnoek, Paul
Blutend wie ein Echo. Gedichte, S. 679Weinholz, Erhard
Früh verloren. Vom Verschwinden der Dichterin Hannelore Becker, S. 682Lehr, Thomas
Der Freund, der zuhören konnte. Totenrede für Friedrich Christian Delius, S. 689Wenn ich mutig wie Christian wäre, würde ich seine Totenrede mit einem Geständnis beginnen: Ich habe nicht alle seine Bücher gelesen! Schon sehe (...)
LeseprobeBerenberg, Heinrich von
Langer Atem, großes Herz. Die Verlegerin Antje Kunstmann, S. 692Strube, Rolf
Randfigur im eigenen Leben. Robert Walser und der Diener 697, S. 697Müller, Lothar
Das doppelte Register des Gifts. Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis, S. 706Kaminskaja, Juliana
Verzweiflung und Widerstand. Ein Gespräch mit Thomas Irmer über Marina Zwetajewa, S. 711Rundell, Katherine
Der Igel, S. 713
Printausgabe bestellen
6/2022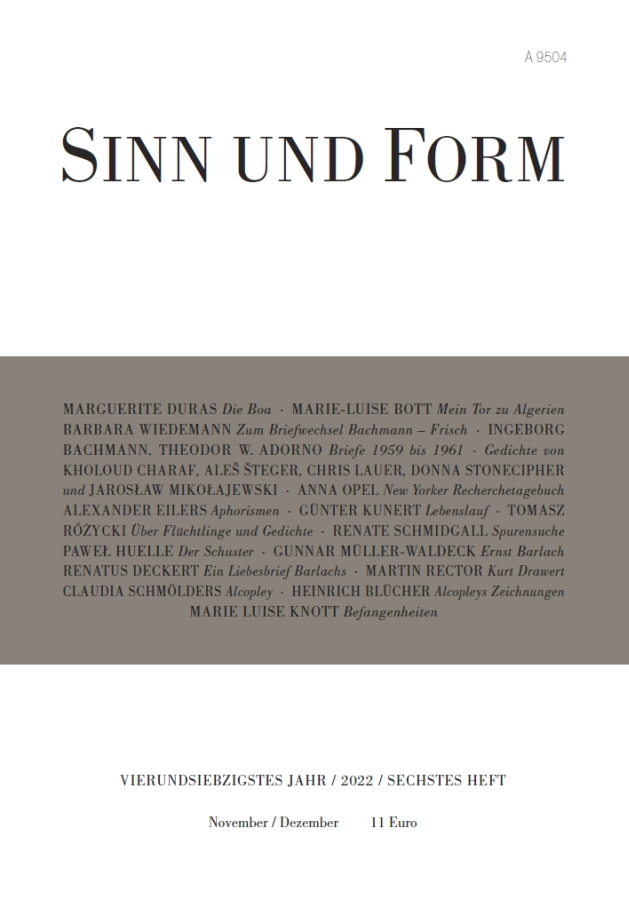
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-68-3
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für AbonnentenSie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/JahrHeft 6/2022 enthält:
Duras, Marguerite
Die Boa, S. 725Charaf, Kholoud
Eine Gabe von Ishtar. Gedichte, S. 733Bott, Marie-Luise
Mein Tor zu Algerien, S. 735Šteger, Aleš
Autobiographie von Č. Gedicht, S. 750Wiedemann, Barbara
»Wir sind halt ein berühmtes Paar gewesen, leider«. Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, S. 756»2011 wurde bekannt«, so ist noch im Sommer 2022 im Wikipedia-Eintrag zu Ingeborg Bachmann zu lesen, »daß sich im Max-Frisch-Archiv in Zürich (...)
LeseprobeLauer, Chris
Pandoras Wasserkrug. Gedichte, S. 768Bachmann, Ingeborg
»Ich muss mich drum auch hüten, mir Hoffnungen auf Arbeit zu machen«. Briefwechsel mit Theodor W. Adorno, S. 771Opel, Anna
New Yorker Recherchetagebuch, S. 775Vor den falschen Sachen Angst haben. Daß die Immigrationsbehörde am Flughafen JFK mich wegen irgendeines Formfehlers nicht einreisen läßt. Daß (...)
LeseprobeStonecipher, Donna
Musterstadt. Gedichte, S. 782Eilers, Alexander
Rußpartikel. Aphorismen, S. 787Kunert, Günter
Kurzfassung eines Lebenslaufes, S. 789Mikołajewski, Jarosław
An die Flüchtlinge. Gedichte, S. 796Różycki, Tomasz
Ein Transporter mit Aufschrift. Über die Gemeinsamkeiten zwischen dem Übersetzen von Gedichten und dem Aufnehmen von Flüchtlingen, S. 800Schmidgall, Renate
Paweł Huelle. Eine Spurensuche, S. 811Huelle, Paweł
Der Schuster, S. 817Müller-Waldeck, Gunnar
Vom Heidberghaus nach Sansibar. Ernst Barlachs Leben und Werk als literarisches Sujet, S. 829Deckert, Renatus
»Vielleicht wissen Sie gar nicht, was Liebe ist«. Ein unbekannter Brief Ernst Barlachs aus dem Dresdner Sommer 1892, S. 841Rector, Martin
Die Ordnung, der Text und der Körper. Laudatio auf Kurt Drawert, S. 844Schmölders, Claudia
Heinrich Blüchers Freund Alcopley. Nachrichten von Grete Wehmeyer, S. 847Blücher, Heinrich
Alcopleys Zeichnungen, S. 850Knott, Marie Luise
Über Befangenheiten, S. 852In den letzten Jahren stand viel bislang kaum Hinterfragtes auf dem Prüfstand. Auch Hannah Arendt ist in die Kritik geraten. Einige Stimmen (...)
