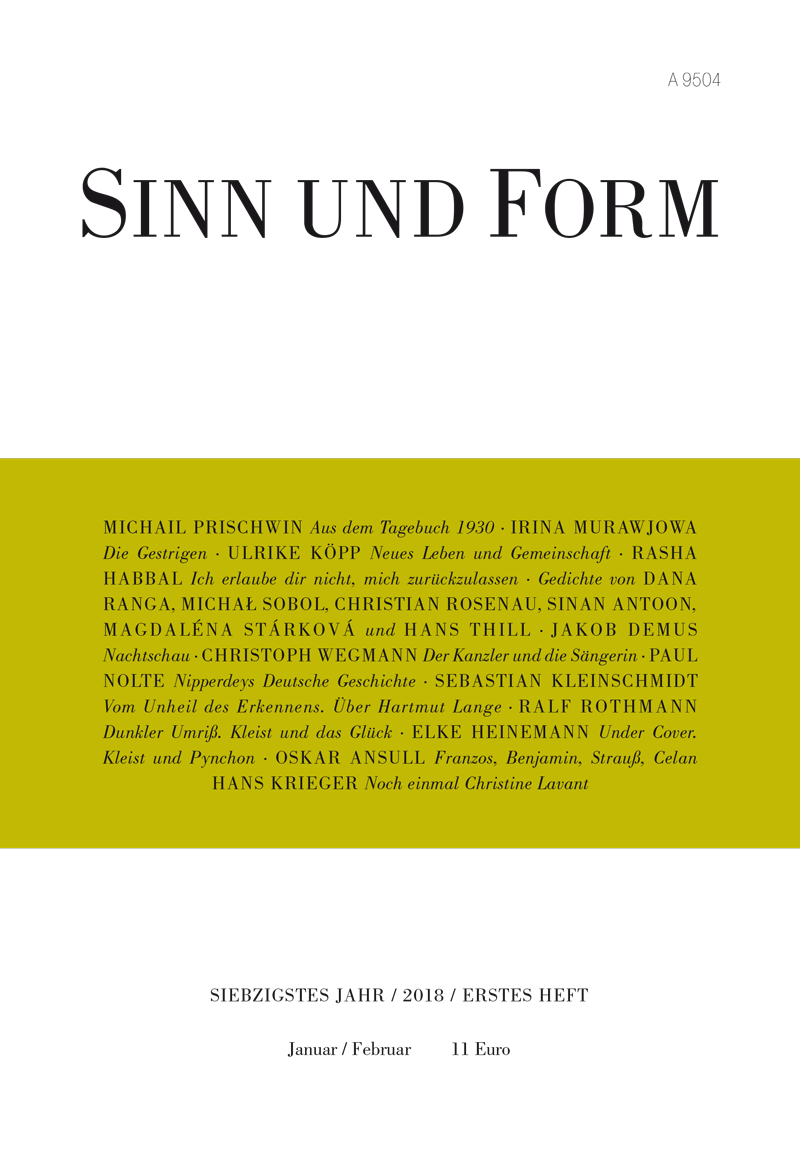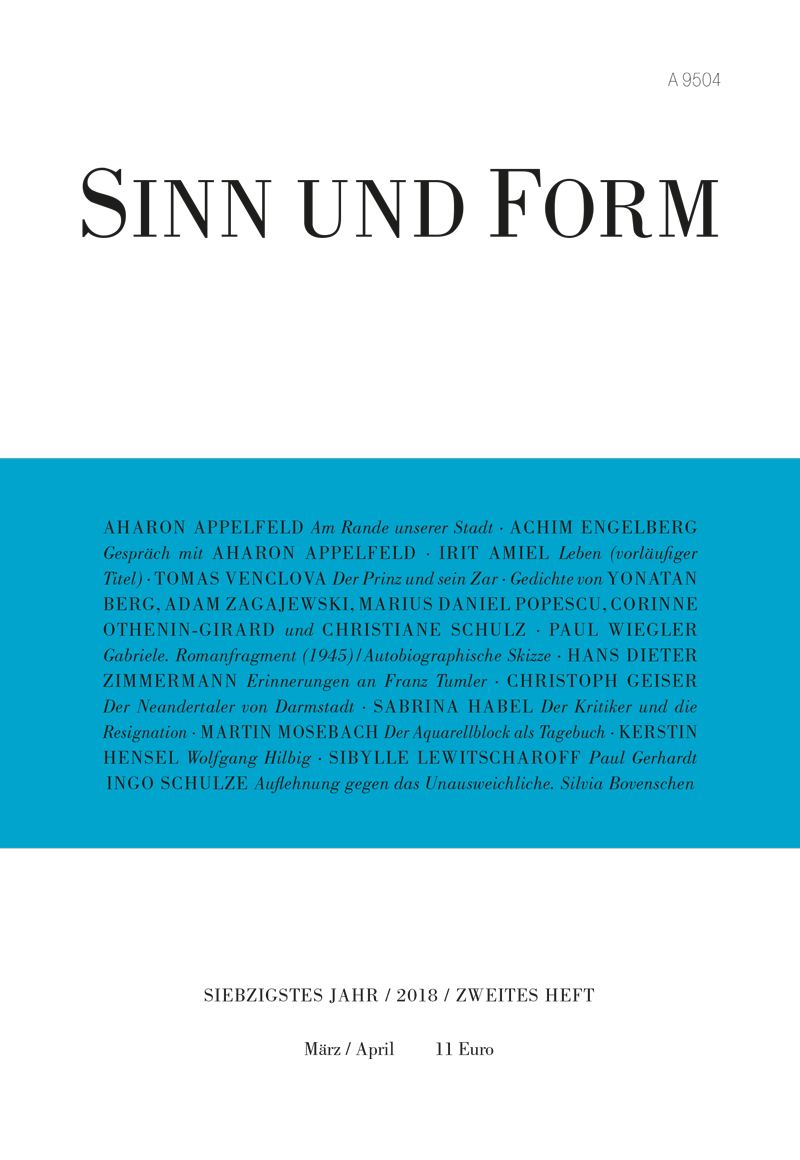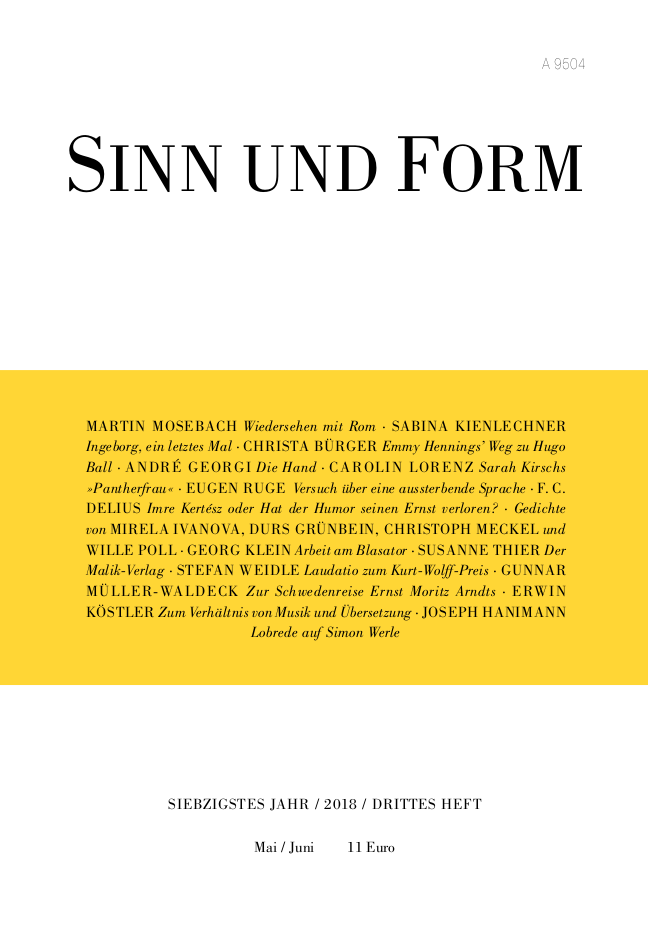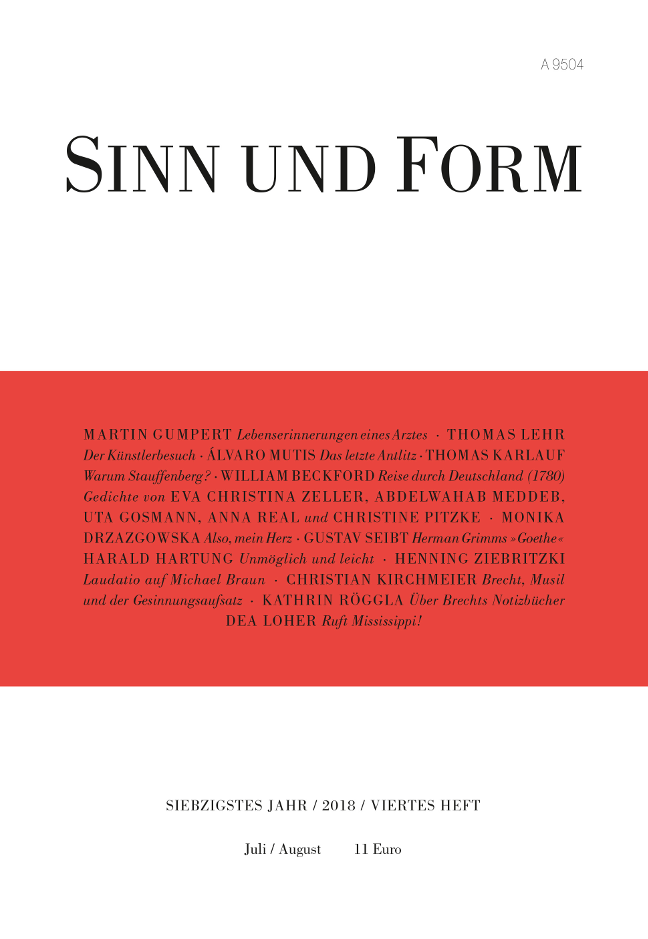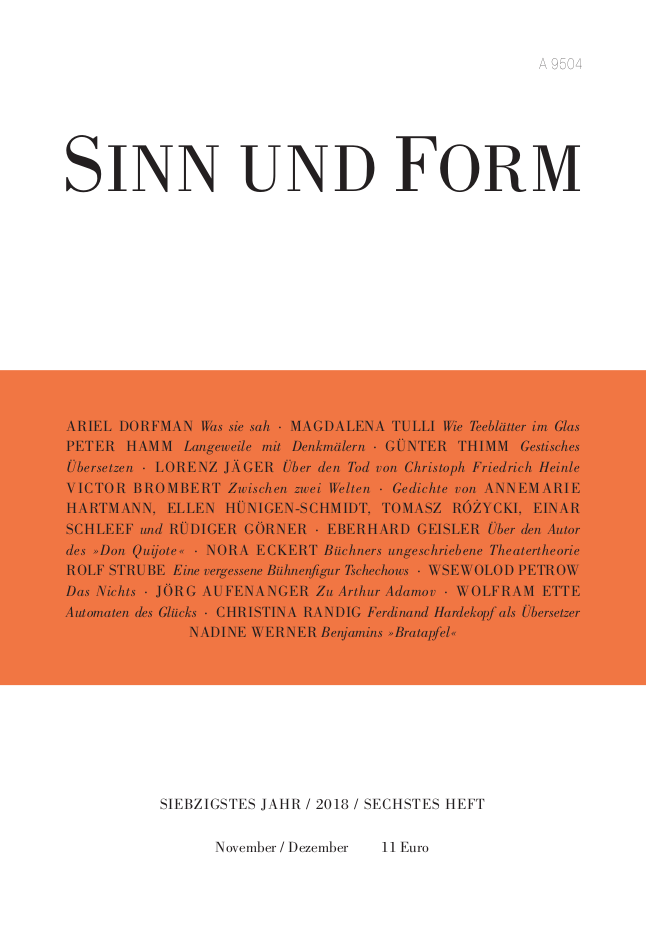Recherchierbar sind hier alle Beiträge von heute zurück bis einschließlich 1949.
Bestellbar sind, sofern nicht anders vermerkt, alle Hefte der letzten Jahre bis einschließlich 1992.
Als PDF-Download stehen alle Ausgaben von 2019 bis heute zur Verfügung.
-
1/2018
Heft 1/2018 enthält:
Prischwin, Michail
»Glücklich unsere Erben, die unsere Zeit nur lesen werden.« Aus dem Tagebuch 1930. Mit einer Vorbemerkung von Eveline Passet, S. 5Vorbemerkung Ich kann der Gesellschaft nur aus einem Abstand zu ihr in versunkenem Nachdenken nützlich sein.
1. Juni 1928 Wie soll man (...)LeseprobeRanga, Dana
Cosmos! Gedichte, S. 28Murawjowa, Irina
Die Gestrigen, S. 33Sobol, Michal
Herr Orkusz. Gedichte, S. 42Köpp, Ulrike
Neues Leben und Gemeinschaft. Zum Reformstreben in der Moderne, S. 46Die Stalinallee, jene für ihre Architektur bewunderte wie verhöhnte Prachtstraße in der östlichen Mitte Berlins, ist eine Chiffre für den (...)
LeseprobeRosenau, Christian
Helden sagen. Gedichte, S. 61Habbal, Rasha
Ich erlaube dir nicht, mich zurückzulassen, S. 65Antoon, Sinan
Die schmale Stelle am Tor. Gedichte, S. 75Demus, Jakob
Nachtschau, S. 78Stárková, Magdaléna
Die Nacht verteilt. Gedichte, S. 87Wegmann, Christoph
Der Kanzler und die Sängerin. Aus Theodor Fontanes »Musée imaginaire«, S. 90Theodor Fontane besaß nicht besonders viele Bilder, sein Kopf aber war voll davon. Voller Fresken, Graffiti, Denkmäler, Zeitungsillustrationen, (...)
LeseprobeNolte, Paul
Handschrift und Helfer. Thomas Nipperdeys »Deutsche Geschichte«, S. 98Thill, Hans
Schafwinter. Gedichte, S. 112Kleinschmidt, Sebastian
Vom Unheil des Erkennens. Hartmut Langes erster Novellenband, S. 115Rothmann, Ralf
Dunkler Umriß – Kleist und das Glück. Dankrede zum Kleist-Preis 2017, S. 125Heinemann, Elke
Under Cover. James Kirkups Erzählung über Heinrich von Kleist und Thomas Pynchon, S. 128Ansull, Oskar
Aspekt einer schwierigen Identitätsfindung. Karl Emil Franzos, Walter Benjamin, Ludwig Strauß, Paul Celan, S. 134Krieger, Hans
»Zieh den Mondkork aus der Nacht!« Noch einmal Christine Lavant: ein Nachtrag zu Werk und Rang, S. 136
Printausgabe bestellen
2/2018Heft 2/2018 enthält:
Appelfeld, Aharon
Am Rande unserer Stadt, S. 149Appelfeld, Aharon
»Deutsch sollte meine Sprache sein, sie wurde es leider nicht«. Ein Gespräch mit Achim Engelberg über Literatur, Vergangenheit und Gegenwart , S. 168ACHIM ENGELBERG: Etliche Autoren, die über den Völkermord an den europäischen Juden oder die Schrecken der Lagerwelt des 20. Jahrhunderts (...)
LeseprobeBerg, Yonatan
Totes Meer. Gedichte, S. 176Amiel, Irit
Leben (vorläufiger Titel), S. 180Zagajewski, Adam
Ein Tropenwald von Erinnerungen. Gedichte, S. 205Venclova, Tomas
Der Fürst und sein Zar. Briefe aus dem Exil, S. 209Manchmal denke ich, man sollte alle Länder der Welt in zwei Klassen einteilen – in Immigrations- und Emigrationsländer. Man könnte mir (...)
LeseprobePopescu, Marius Daniel
Der Fliegenfotograf. Gedichte , S. 219Wiegler, Paul
Gabriele. Romanfragment (Sommer 1945). Mit einer Vorbemerkung von Gernot Krämer, S. 222Wiegler, Paul
Autobiographische Skizze, S. 241Othenin-Girard, Corinne
Permanente Exilantin. Gedicht, S. 245Zimmermann, Hans Dieter
Eine Zeitlang ist man auf der Welt. Erinnerungen an Franz Tumler, S. 247Schulz, Christiane
Mit dem Fluß treten die Augen über das Ufer. Gedichte, S. 255Geiser, Christoph
Der Neandertaler von Darmstadt, S. 258Das Auge Gottes, übrigens, war auch noch nicht im Bus. Ja, vielleicht war das säumige Auge Gottes überhaupt der Grund, warum der Bus, der sich (...)
LeseprobeHabel, Sabrina
Der Kritiker und die Resignation, S. 269Mosebach, Martin
Der Aquarellblock als Tagebuch. Über die Malerin Elisabeth von Förster, S. 272Hensel, Kerstin
Der Einbruch der Nacht in den Morgen. Zu Wolfgang Hilbig, S. 274Lewitscharoff, Sibylle
»Menschliches Wesen / Was ist’s gewesen«. Über Paul Gerhardt, S. 276Schulze, Ingo
Die Auflehnung gegen das Unausweichliche. Nachruf auf Silvia Bovenschen, S. 279
Printausgabe bestellen
3/2018Heft 3/2018 enthält:
Mosebach, Martin
Wiedersehen mit Rom, S. 293Mit fünfzehn Jahren habe ich Rom zum ersten Mal betreten, eine Schwester meiner Mutter lud mich ein; wir wohnten in einem kleinen Hotel nahe der Via (...)
LeseprobeKienlechner, Sabina
Ingeborg, ein letztes Mal, S. 308I Drei- oder sogar viermal in ihrem Leben kam Ingeborg Bachmann nach Rom, um hier eine Weile zu leben. Wir waren immer schon da: in den fünfziger (...)
LeseprobeIvanova, Mirela
In den Augen des Windes. Gedichte, S. 320Bürger, Christa
Emmy Hennings' Weg zu Hugo Ball, S. 322»Nachdem ich dreißig Jahre lang gegangen war, bemerkte ich urplötzlich, daß ich mich in der Sackgasse des Irrtums befand.« Als Emmy Hennings (...)
LeseprobeGeorgi, André
Die Hand, S. 333Grünbein, Durs
Spreekanal. Gedichte, S. 340Lorenz, Carolin
Die Pantherfrau. Sarah Kirsch als Begründerin der Interviewliteratur in der DDR, S. 344Meckel, Christoph
Vor der Zukunft. Gedichte, S. 352Ruge, Eugen
Versuch über eine aussterbende Sprache. Dresdner Rede, S. 356Delius, Friedrich Christian
Hat der Humor seinen Ernst verloren? Imre Kertész und Jan Böhmermann, Jean Paul und die »heute-show«, S. 373Poll, Wille
Kunst war sowieso nie meine Stärke. Gedichte, S. 390Klein, Georg
Arbeit am Blasator, S. 393Thier, Susanne
Revolution des Inhalts und der Form. Hundert Jahre Malik-Verlag, S. 403Weidle, Stefan
Ein Netzwerk unterirdischer Verbindungen. Laudatio zur Verleihung der Kurt-Wolff-Preise an den Elfenbein Verlag und die Edition Rugerup, S. 407Müller-Waldeck, Gunnar
Von Lappländern und Hebräern. Zur Schwedenreise Ernst Moritz Arndts, S. 412Köstler, Erwin
Intensität und Bedeutung. Zum Verhältnis von Musik und Übersetzung, S. 418Hanimann, Joseph
Übersetzer, die schicksalhaften Treuebrecher. Lobrede auf Simone Werle, S. 423
Printausgabe bestellen
4/2018Heft 4/2018 enthält:
Gumpert, Martin
Lebenserinnerungen eines Arztes. Autobiographische Aufzeichnungen. Mit einer Vorbemerkung von Jutta Ittner, S. 437Augenzeuge der Wahrheit? Eine Vorbemerkung Erst ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod wurde der jüdische Arzt und Schriftsteller Martin Gumpert (...)
LeseprobeZeller, Eva Christina
Löwe und Seehund. Gedichte, S. 457Lehr, Thomas
Der Künstlerbesuch, S. 460Ich besuche mich wie einen Kranken, mit einem Blumenstrauß, einer Schachtel Pralinen, mit Äpfeln, Bananen, Orangen, einem neuen Buch. Doch nichts (...)
LeseprobeMutis, Álvaro
Das letzte Antlitz, S. 462Karlauf, Thomas
Warum Stauffenberg? Die Motive des Attentäters und das Problem der Quellen, S. 475Meddeb, Abdelwahab
Der Traum von Samarkand. Gedicht, S. 487Beckford, William
Träume, Taggedanken und Wechselfälle des Lebens. Reise durch Deutschland (1780). Mit einer Vorbemerkung von Gernot Krämer, S. 491Vorbemerkung Mit einem einzigen Buch ist William Beckford in die Literaturgeschichte eingegangen, dem 1786 veröffentlichten orientalischen Roman (...)
LeseprobeGosmann, Uta
Isles of Skye. Gedichte, S. 508Drzazgowska, Monika
Also, mein Herz, S. 511Real, Anna
Litanei von der Kindererholung. Gedicht, S. 525Seibt, Gustav
Herman Grimms »Goethe«, S. 533Pitzke, Christine
Überstunden in Weimar. Gedichte, S. 543Hartung, Harald
Unmöglich und leicht. Aufzeichnungen, S. 545Ziebritzki, Henning
»Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander«. Laudatio auf Michael Braun zum Alfred-Kerr-Preis 2018, S. 551Kirchmeier, Christian
Brecht, Musil und der Gesinnungsaufsatz, S. 557Röggla, Kathrin
Brechts Notizbücher, S. 559Loher, Dea
Ruft Mississippi! Dankrede zur Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises 2017, S. 564
Printausgabe bestellen
5/2018Heft 5/2018 enthält:
Strauß, Botho
Joë Bousquet oder Die ungezügelte Passivität, S. 581Bousquet, Joë
Das Abendweh, S. 586Koepsell, Kornelia
Liebesgedichte, S. 596Kappacher, Walter
August in Rom, S. 599Wagner, Jan
Aus dem Munde des Altertums. Gedanken zu Winckelmann, Freiheit und Kunst, S. 608Buselmeier, Michael
Rote Steine. Gedichte, S. 617Weichelt, Matthias und Gernot Krämer
Ein Gespräch mit Cécile Wajsbrot über Stimmen, Erinnerungen und Literatur, S. 619Wajsbrot, Cécile
Tag und Nacht, S. 634Hensel, Kerstin
Rollfeld. Gedichte, S. 640Stroińska, Dorota
»Zu groß für die Deutschen«. Berlin als Ort der polnischen Literatur, S. 642Różewicz, Janusz
Słowacki in Versailles. Eine wahre Begebenheit. Mit einer Vorbemerkung von Bernhard Hartmann, S. 651Vorbemerkung: Janusz Różewicz – ein polnisches Leben (und Nachleben) Vor fast einem Vierteljahrhundert veröffentlichte der 72jährige (...)
LeseprobeRóżewicz, Stanisław
Wie ein graues Basrelief, S. 657Reinert, Bastian
Lauter lautloses Jetzt. Gedichte, S. 665Kempker, Kerstin
Einer muß wachen. Nachtstück, S. 667Rivière, Alain
Also ist alles gesagt. Gedichte, S. 672Stölzel, Thomas
Die Länge der Kürze, S. 673Ford, Ford Madox
Arbeiten mit Conrad, S. 674I Ich möchte ein für allemal mit dem Mythos aufräumen, ich hätte Anteil daran gehabt, Conrad Englisch beizubringen, auch wenn es auf den ersten (...)
LeseprobeSweeney, Matthew
Die Eule. Gedichte, S. 678Kinsky, Esther
Weiße Räume – Lichtes Maß. Unsagbar und Ungesagt in der Übersetzung, S. 686Winkels, Hubert
Die kaum spürbare Umarmung der Toten. Laudatio zum Düsseldorfer Literaturpreis für Esther Kinsky, S. 699Grünbein, Durs
Das Pferdemassaker an der Autobahnmeisterei, S. 703Bormuth, Matthias
Der Maler Michael Triegel, S. 706Loschütz, Gert
Herburgers Lachen, S. 709Seit langem überlege ich, was das ist: ein glückliches Leben. Oder ein geglücktes. Sagt man: Ein Leben war glücklich, wenn einer erreicht hat, (...)
LeseprobeZischler, Hanns
Die zurückgebliebene Spur. Nachruf auf Karl-Ernst Herrmann, S. 712
Printausgabe bestellen
6/2018Heft 6/2018 enthält:
Dorfman, Ariel
Was sie gesehen hat, S. 725Hartmann, Annemarie
Eine Winterreise. Gedichte, S. 734Tulli, Magdalena
Wie Blätter im Teeglas, S. 737Ihre Krankheit war wie das Ende eines Imperiums. Die Armee zog sich zurück und verließ die in Zeiten vergangener Herrlichkeit besetzten (...)
LeseprobeHünigen-Schmidt, Ellen
Wie ein sich tröstendes Kind. Gedichte, S. 749Hamm, Peter
Langeweile mit Denkmälern. Ein unbekanntes Gedicht von Günter Grass und eine Erinnerung an den Dichter, S. 753Różycki, Tomasz
Der Typ, der die Welt gekauft hat. Gedichte, S. 760Thimm, Günter
Gestisches Übersetzen, S. 764Schleef, Einar
Herzkammern. Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Ulrich Müller-Schwefe, S. 775Vorbemerkung 1. »Stinkstiefel!« Mit diesem Ausdruck bedachte der zornige Jürgen Holtz einmal im Interview den Regisseur Einar Schleef. Die (...)
LeseprobeJäger, Lorenz
Die Bewegung der Jugend. Über den Tod von Christoph Friedrich Heinle, S. 782Görner, Rüdiger
Beim Wiederlesen von »The Waste Land«. Gedicht, S. 788Brombert, Victor
Zwischen zwei Welten, S. 793Geisler, Eberhard
»Cervantes ist eigentlich immer jünger geworden«. Über den Autor des »Don Quijote« und seine geistesgeschichtliche Bedeutung, S. 804Eckert, Nora
Büchners ungeschriebene Theatertheorie, S. 816Strube, Rolf
»Meine Sache ist nur, Talent zu haben«. Eine vergessene Bühnenfigur Tschechows und die Folgen, S. 826Petrow, Wsewolod
Das Nichts. Drei Erzählungen, S. 835Aufenanger, Jörg
Arthur Adamov oder der Blick ins Nichts, S. 843Ette, Wolfram
Automaten des Glücks, S. 846I. Es gab in der Kindheit diese Kaugummiautomaten. Sie waren auf unserer Augenhöhe angebracht, dort, wo die Erwachsenen selten hinsahen, weil sich (...)
LeseprobeRandig, Christina
Ferdinand Hardekopf als Übersetzer, S. 850Werner, Nadine
Benjamins »Bratapfel«. Einblicke in die Arbeit an der »Berliner Kindheit um neunzehnhundert«, S. 853
Printausgabe bestellen