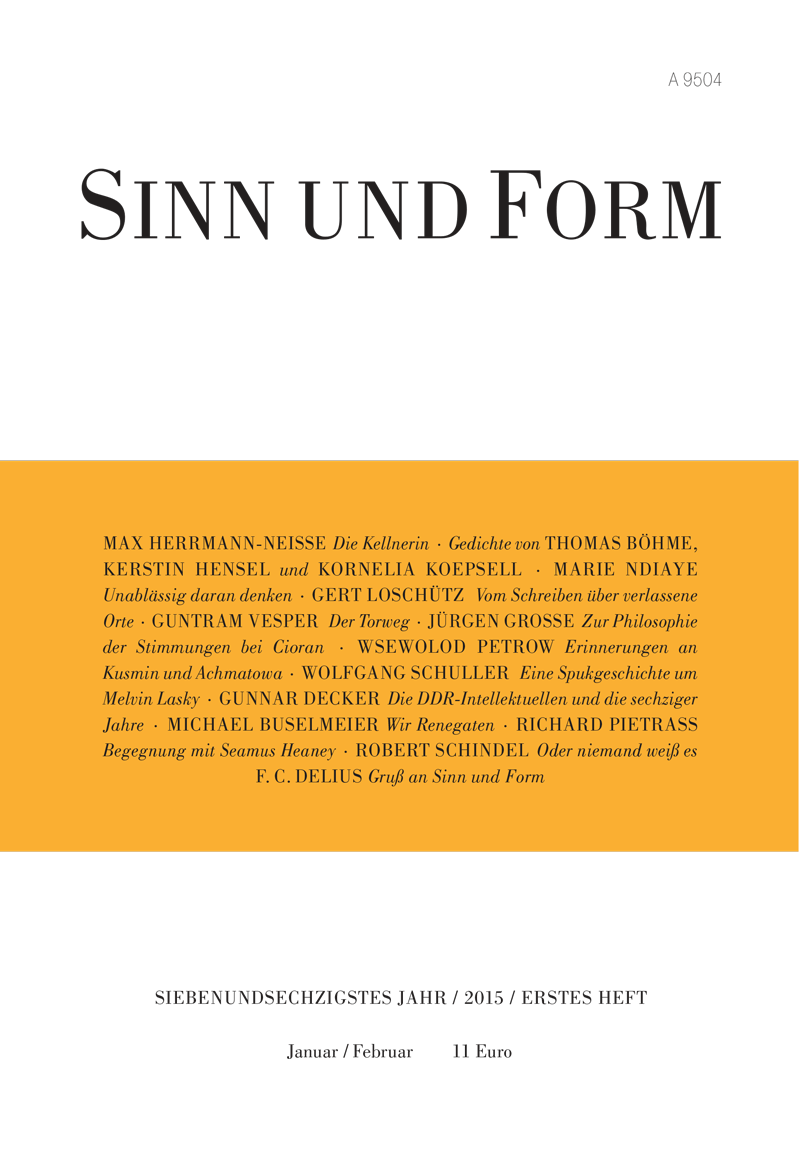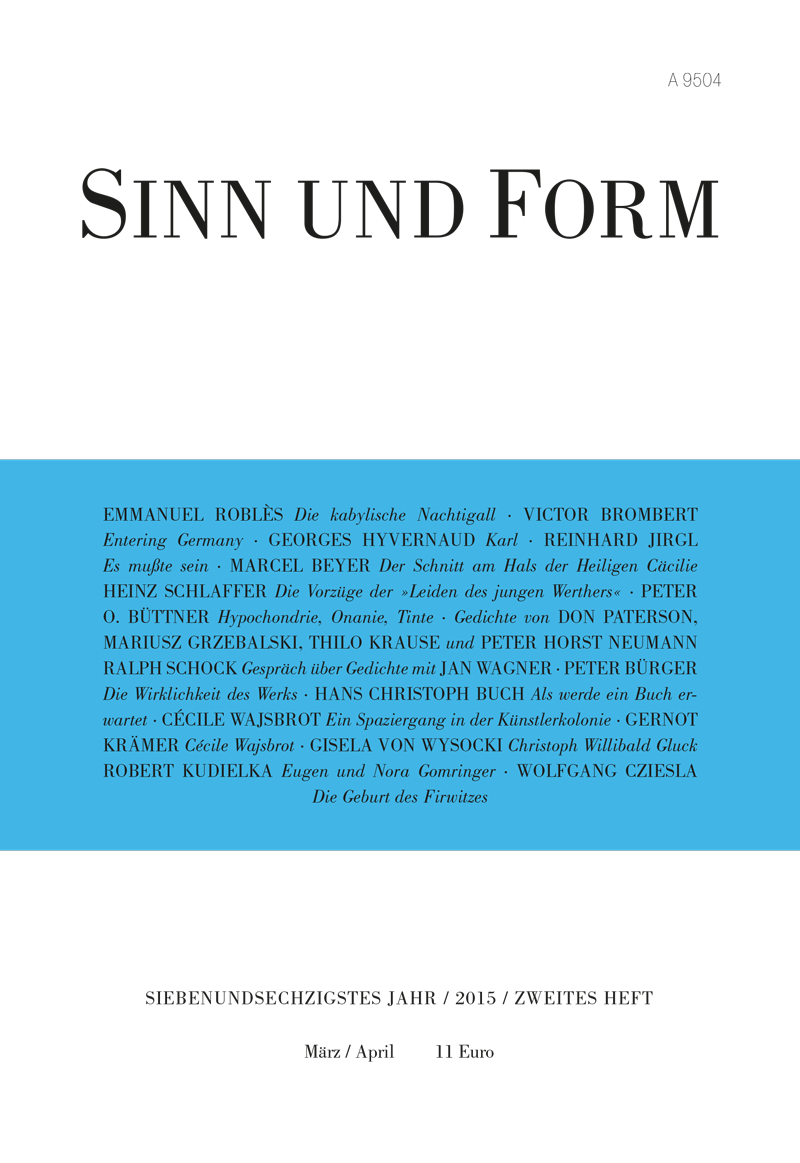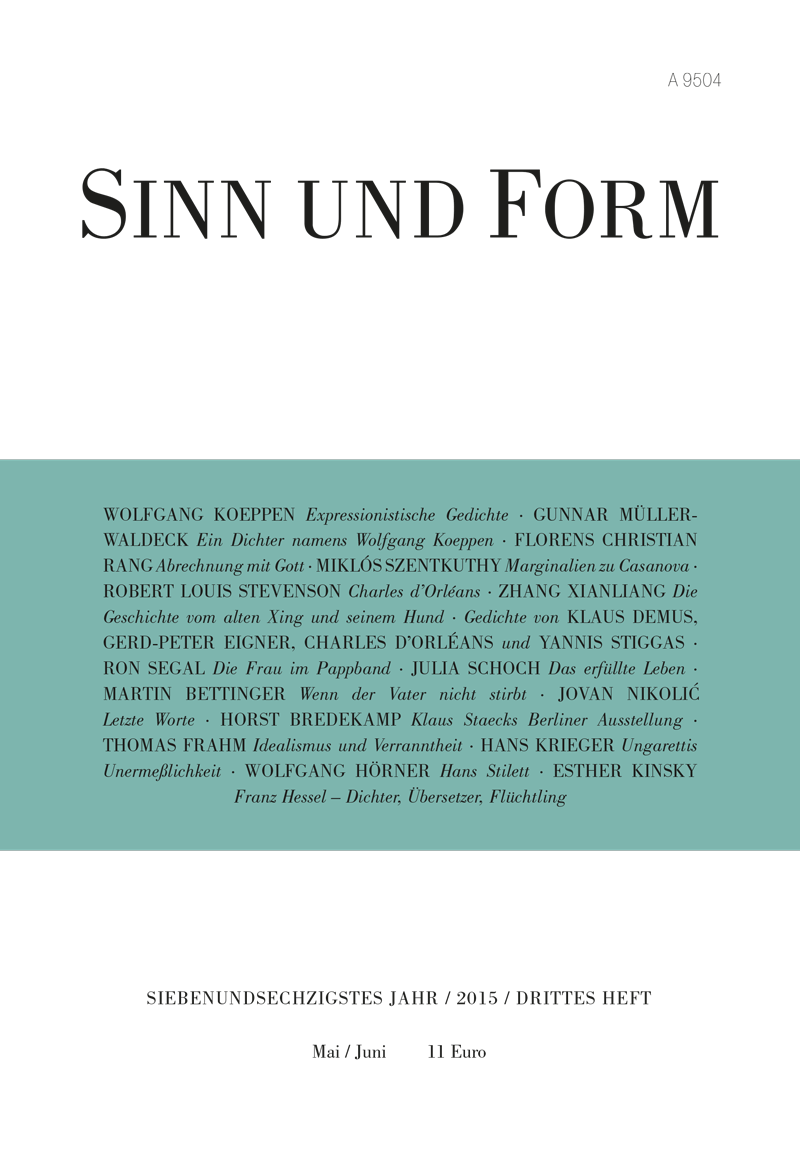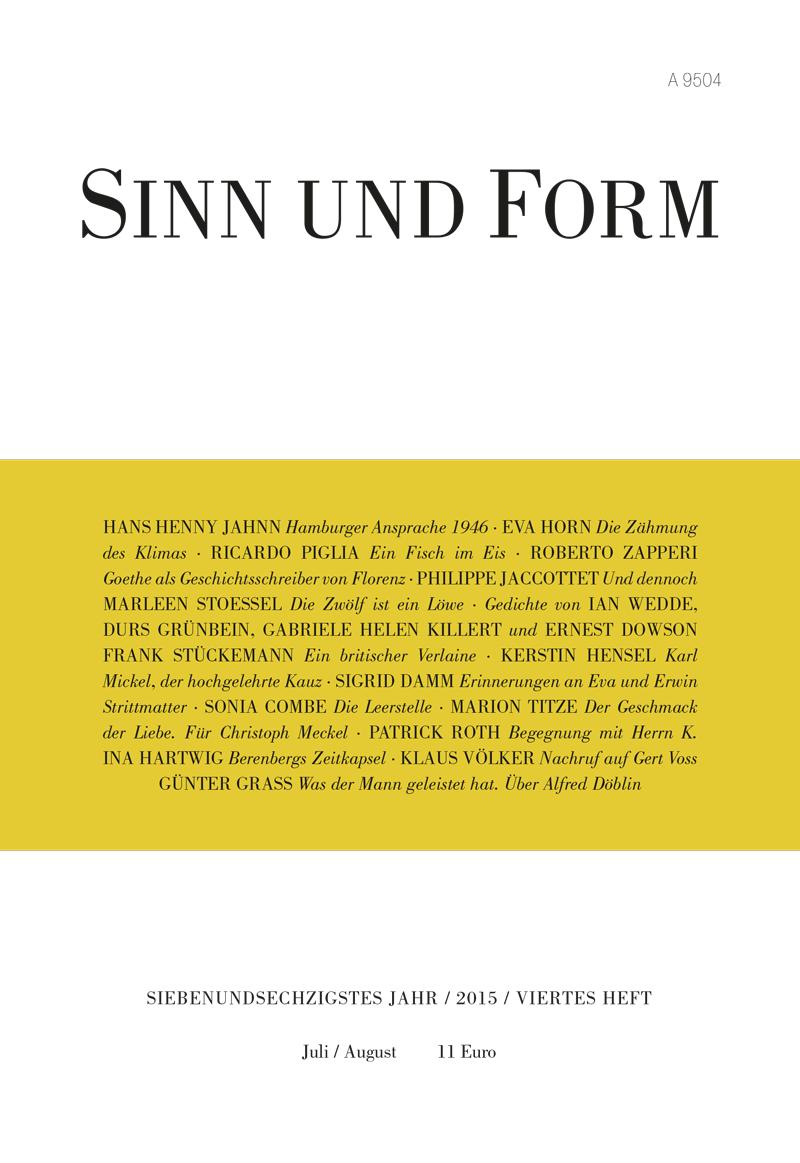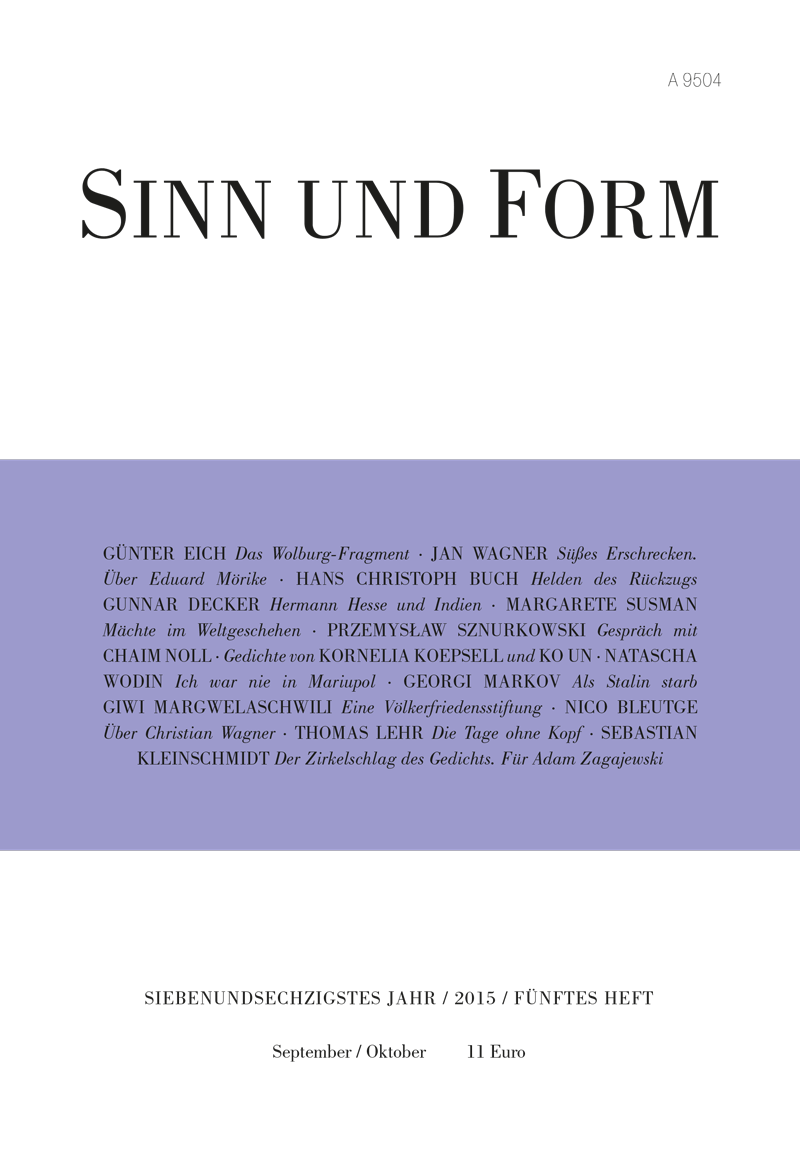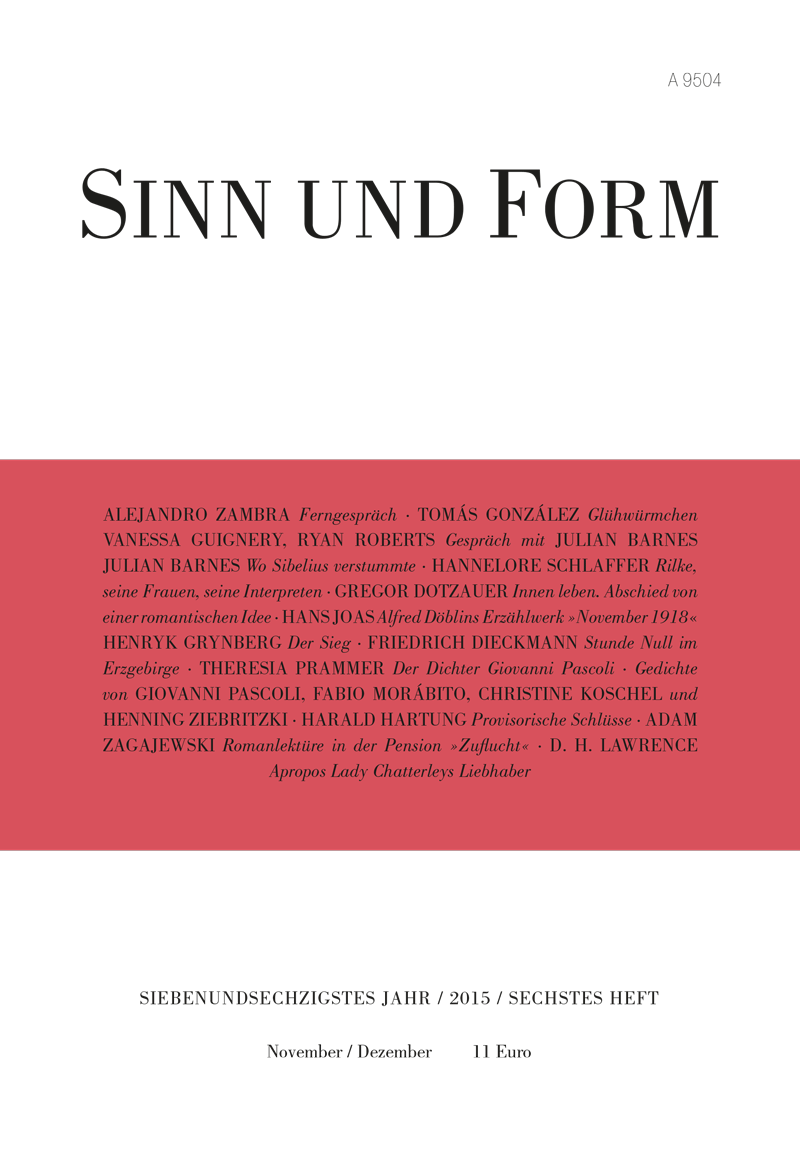Recherchierbar sind hier alle Beiträge von heute zurück bis einschließlich 1949.
Bestellbar sind, sofern nicht anders vermerkt, alle Hefte der letzten Jahre bis einschließlich 1992.
Als PDF-Download stehen alle Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute zur Verfügung.
-
1/2015
Heft 1/2015 enthält:
Herrmann-Neiße, Max
Die Kellnerin.
Mit einer Vorbemerkung von Klaus Völker, S. 5I. Am Samstag Vormittag ging der Lokomotivführer Gustav Finger wieder in den Dienst. Zuerst hatte man beim Frühstück tüchtig Grund gelegt, wenig (...)
LeseprobeBöhme, Thomas
Der Erinnerung geht der Sauerstoff aus.
Gedichte, S. 41Redaktion »Sinn und Form«
Berichtigung zu »Der arme Spitzel« (3 /2014, S. 307 ff.), S. 43NDiaye, Marie
Unablässig daran denken, S. 44Loschütz, Gert
Vom Schreiben über verlassene Orte, S. 54Zwei Schreib-Orte Einmal wohnte ich auf einer Insel in einem wunderschönen Haus, das ein Freund gemietet und mir für die Zeit, in der er es (...)
LeseprobeVesper, Guntram
Der Torweg, S. 66Hensel, Kerstin
Die toten Aromen der Zeit. Gedichte, S. 81Große, Jürgen
Melancholie und Trauer.
Zur Philosophie der Stimmungen im Werk Ciorans, S. 83Koepsell, Kornelia
Melancholische Sonette, S. 97Petrow, Wsewolod
Erinnerungen an Michail Kusmin und
Anna Achmatowa. Mit einer Nachbemerkung von Oleg Jurjew, S. 100Cagliostro Man mußte in den vierten Stock eines großen Petersburger Hauses in der ruhigen Spasskaja-Straße, die allerdings schon lange (...)
LeseprobeSchuller, Wolfgang
Melvin Lasky und die Kultur im
Kalten Krieg. Eine Spuk- und Skandalgeschichte, S. 113Decker, Gunnar
Hoffnung ist Gefahr.
Die DDR-Intellektuellen und die sechziger Jahre, S. 119Buselmeier, Michael
Wir Renegaten.
Dankrede zum Gustav-Regler-Preis, S. 127Pietraß, Richard
Der verwaiste Spaten.
Meine Begegnung mit Seamus Heaney, S. 130Schindel, Robert
Oder niemand weiß es.
Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis, S. 135Delius, Friedrich Christian
Der Stolz der Akademie.
Gruß an »Sinn und Form«, S. 138Ein Abend von und mit »Sinn und Form«. Es ist also auch eine, ja, was eigentlich, eine Institution zu begrüßen, die nicht leicht zu fassen (...)
2/2015Heft 2/2015 enthält:
Roblès, Emmanuel
Die kabylische Nachtigall, S. 149Paterson, Don
Der Schauder in der linken Hand. Gedichte, S. 156Brombert, Victor
Entering Germany. Die Schlacht im Hürtgenwald 1944, S. 159Hyvernaud, Georges
Karl, S. 168Grzebalski, Mariusz
Der grüne Schnee. Gedichte, S. 173Jirgl, Reinhard
Es mußte sein, S. 175Beyer, Marcel
Der Schnitt am Hals der Heiligen Cäcilie, S. 185Schlaffer, Heinz
Die Vorzüge der »Leiden des jungen
Werthers«, S. 195Leicht ist es, Goethes »Werther« ein vorzügliches Buch zu nennen, schwer jedoch, diese Vorzüge zu bestimmen. ›Vorzüge‹ soll wörtlich (...)
LeseprobeBüttner, Peter O.
Federschreiben in Zeiten der Aufklärung. Hypochondrie, Onanie, Tinte, S. 205Krause, Thilo
Nur ein paar Vögel. Gedichte, S. 211Schock, Ralph
»Eine andere Wahrnehmung der Welt«.
Ein Gespräch über Gedichte mit Jan Wagner, S. 214RALPH SCHOCK: Ihr neuer Gedichtband »Regentonnenvariationen« ist vor einigen Monaten erschienen. Ich habe Sie in Frankfurt während der Buchmesse (...)
LeseprobeNeumann, Peter Horst
In Muzot bei Rilke. Gedichte, S. 229Bürger, Peter
Die Wirklichkeit des Werks. Zur Ästhetik Rainer Maria Rilkes und Lou Andreas-Salomés, S. 232Buch, Hans Christoph
Als werde ein Buch erwartet. Erinnerungen an den Literaturbetrieb (I), S. 2421 »Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet.« Diese Definition der (...)
LeseprobeWajsbrot, Cécile
Echos eines Spaziergangs in der Künstlerkolonie, S. 253Krämer, Gernot
Literatur als geteilte Erfahrung. Laudatio auf Cécile Wajsbrot, S. 267Wysocki, Gisela von
Einer, dem der Kragen zu eng wurde. Über Christoph Willibald Gluck, S. 270Kudielka, Robert
Sternbilder, Atem und Stimme. Über Eugen und Nora Gomringer, S. 275Cziesla, Wolfgang
Die Geburt des Firwitzes, S. 278
Printausgabe bestellen
3/2015Heft 3/2015 enthält:
Koeppen, Wolfgang
Gleich Kanonen hämmert Gas!
Unveröffentlichte Gedichte, S. 293Müller-Waldeck, Gunnar
Ein expressionistischer Dichter
namens Wolfgang Koeppen, S. 300Die Antwort des Bertolt Brecht – befragt nach dem Einfluß des Expressionismus auf seine frühe Dichtung – ist berühmt. Sie war verächtlich und (...)
LeseprobeRang, Florens Christian
Abrechnung mit Gott.
Pädagogik und Bildung. Vorbemerkung von Anne Weber, S. 309Demus, Klaus
Gezeitengangs tiefes Atemholen. Gedichte, S. 319Szentkuthy, Miklós
Marginalien zu Casanova.
Alfons von Liguori (1696–1787), S. 322Alfons von Liguori (1696–1787) Der Heilige Alfons starb im Alter von einundneunzig Jahren, doch das Schreiben hatte man ihm, nachdem er unzählige (...)
LeseprobeEigner, Gerd-Peter
Schlangen und Betschwestern. Gedichte, S. 335Stevenson, Robert Louis
Charles d’Orléans, S. 339D’Orléans, Charles
Balladen, S. 364Xianliang, Zhang
Die Geschichte vom alten Xing
und seinem Hund, S. 367Stiggas, Yannis
Atemübungen. Gedichte, S. 389Segal, Ron
Die Frau im Pappband, S. 392Schoch, Julia
Das erfüllte Leben, S. 396Bettinger, Martin
Wenn der Vater nicht stirbt, S. 400Nikolić, Jovan
Letzte Worte, S. 405Die Kindheit Wie groß ist die Welt, wenn du klein bist. Die Menschen, der Hund, die Bäume und der Fluß. Der Himmel so fern und die Wolken ein (...)
LeseprobeBredekamp, Horst
Das lange Halbjahrhundert.
Rede zur Eröffnung von Klaus Staecks Berliner Ausstellung, S. 409Frahm, Thomas
Idealismus und Verranntheit.
Vom Übersetzen aus kleinen Sprachen, S. 412Krieger, Hans
Ungarettis Unermeßlichkeit.
Überlegungen zu einem alten Übersetzungsproblem, S. 419Hörner, Wolfgang
Der fliegende Hans.
Nachruf auf Hans Stilett, S. 420Kinsky, Esther
Franz Hessel - Dichter - Übersetzer - Flüchtling, S. 423
Printausgabe bestellen
4/2015Heft 4/2015 enthält:
Jahnn, Hans Henny
Hamburger Ansprache 1946. Mit einer Vorbemerkung von Sandra Hiemer, S. 437Aus den Tiefen der Archive. Eine Vorbemerkung Der Schriftsteller und Orgelbauer Hans Henny Jahnn verbrachte die NS-Jahre auf der dänischen (...)
LeseprobeCombe, Sonia
Die Leerstelle. Über Erinnerungen und Polizeiakten, S. 440Wedde, Ian
Der Rettungsschwimmer, S. 448Horn, Eva
Air Conditioning. Die Zähmung des Klimas als Projekt der Moderne, S. 455Ankunft in Changi Airport, Singapur. Ich betrete eine luxuriöse Teppichlandschaft mit großen Orchideeninseln, kühl und geordnet, die Abfertigung (...)
LeseprobePiglia, Ricardo
Ein Fisch im Eis, S. 463Grünbein, Durs
Artischocken. Gedichte, S. 475Zapperi, Roberto
Goethe als Geschichtsschreiber von Florenz, S. 481Jaccottet, Philippe
Und dennoch, S. 490Stoessel, Marleen
Der siebte Sinn oder die Zwölf ist ein Löwe. Erfahrungen mit Synästhesie, S. 497Synästhesie – ein Wort so luftig wie ein seidenes Gewebe, rötlich schimmernd, Y und I sticken etwas Gold und Gelb hinein. Ein schönes, (...)
LeseprobeKillert, Gabriele Helen
Gieriger Mund, gieriges Brot, S. 509Stückemann, Frank
Ein britischer Verlaine. Der Dichter Ernest Dowson, S. 512Dowson, Ernest
Bleiches Bernsteinlicht, S. 521Hensel, Kerstin
Der hochgelehrte Kauz. Begegnung mit Karl Mickel, S. 526Damm, Sigrid
Gerettete Lebenstage sind Schreibtage. Erinnerungen an Eva und Erwin Strittmatter, S. 534Titze, Marion
Der Geschmack der Liebe. Für Christoph Meckel, S. 555Roth, Patrick
Wie zu lesen sei oder Begegnung mit Herrn K., S. 557Hartwig, Ina
Berenbergs Zeitkapsel, Hinkes Sternstunde. Laudatio zum Kurt Wolff Preis, S. 559Völker, Klaus
Mitgefühl, aber keine Einfühlung. Nachruf auf Gert Voss, S. 565Grass, Günter
Was der Mann geleistet hat. Über Alfred Döblin, S. 567
Printausgabe bestellen
5/2015Heft 5/2015 enthält:
Eich, Günter
Das Wolburg-Fragment (1945).
Mit einer Vorbemerkung von Axel Vieregg, S. 581Vorbemerkung Am 25. April 1946 schrieb Günter Eich an Karl Krolow, der ihn anscheinend um einen Prosa-Beitrag für ein »eigenes (...)
LeseprobeKoepsell, Kornelia
Die große Einsamkeit. Gedichte, S. 602Wagner, Jan
Süßes Erschrecken. Über Eduard Mörike, S. 605Wer niemals seine Schritte nach Mergentheim und Wermutshausen lenkte, nie in Weilheim, Kirchheim, Pflummern und Ochsenwang gewesen ist, wer nie nach (...)
LeseprobeBuch, Hans Christoph
Helden des Rückzugs.
Erinnerungen an den Literaturbetrieb (II), S. 615Un, Ko
Bettler aller Bettler. Gedichte, S. 626Decker, Gunnar
Hermann Hesse und Indien.
Von äußeren und inneren Ost-West-Passagen, S. 630Susman, Margarete
Mächte im Weltgeschehen. Mit einer
Vorbemerkung von Elisa Klapheck, S. 640Sznurkowski, Przemyslaw
»Wo Juden sind, entsteht auch
Literatur«. Gespräch mit Chaim Noll, S. 657PRZEMYSŁAW SZNURKOWSKI: Sie zeichnen in Ihren Büchern ein differenziertes Bild der israelischen Gesellschaft. Besonders in Ihrem 2014 erschienenen (...)
LeseprobeWodin, Natascha
Ich war nie in Mariupol, S. 668Markov, Georgi
Als Stalin starb, S. 679Margwelaschwili, Giwi
Eine Völkerfriedensstiftung.
Mit einer Vorbemerkung von Jörg Sundermeier, S. 683Bleutge, Nico
Auf der Lichtung. Dankrede zum Christian-
Wagner-Preis, S. 701Lehr, Thomas
Die Tage ohne Kopf, S. 707Kleinschmidt, Sebastian
Der Zirkelschlag des Gedichts.
Laudatio auf Adam Zagajewski zum Heinrich-Mann-Preis, S. 708
Printausgabe bestellen
6/2015Heft 6/2015 enthält:
Zambra, Alejandro
Ferngespräch, S. 725Morábito, Fabio
Schalte die Finsternis an. Gedichte, S. 736González, Tomás
Glühwürmchen, S. 741Guignery, Vanessa; Roberts, Ryan
»Was der Tod alles mit sich bringt.« Gespräch mit Julian Barnes, S. 745Barnes, Julian
Wo Sibelius verstummte, S. 759Koschel, Christine
Auf der Insel Aberland. Gedichte, S. 764Schlaffer, Hannelore
Zweierlei Sprache.
Rilke, seine Frauen, seine Interpreten, S. 766Dotzauer, Gregor
Innen leben. Abschied von einer
romantischen Idee, S. 7741 In Peking hängen die Wolken an versmogten Tagen so tief, daß einem der Himmel bis in den Hauseingang nachkriecht. Das Firmament hockt auf der (...)
LeseprobeJoas, Hans
Ein Christ durch Krieg und Revolution.
Alfred Döblins Erzählwerk »November 1918«, S. 784Wie der Selbstmord erscheint uns die religiöse Konversion als individueller Akt im reinsten Sinne. Wir nehmen an, daß erschütternde existentielle (...)
LeseprobeGrynberg, Henryk
Der Sieg. Mit einer Nachbemerkung
von Lothar Quinkenstein, S. 800Dieckmann, Friedrich
Stunde Null im Erzgebirge.
Eine Kindheitserinnerung, S. 811Ziebritzki, Henning
Vogelwerk. Gedichte, S. 827Prammer, Theresia
Mönchsgrasmücken, Tamarisken,
Bekassinen. Der Dichter Giovanni Pascoli, S. 830oci oci oci oci oci oci, fi fideli fideli fideli fi, ci cieriri ci ci cieriri, ci ri ciwigk cidiwigk fici fici. Oswald von (...)
LeseprobePascoli, Giovanni
Drachensteigen. Gedichte, S. 835Hartung, Harald
Provisorische Schlüsse, S. 841Zagajewski, Adam
Romanlektüre in der Pension »Zuflucht«.
Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis, S. 851Lawrence, D.H.
Apropos Lady Chatterleys Liebhaber, S. 855
Printausgabe bestellen