Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 54 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr
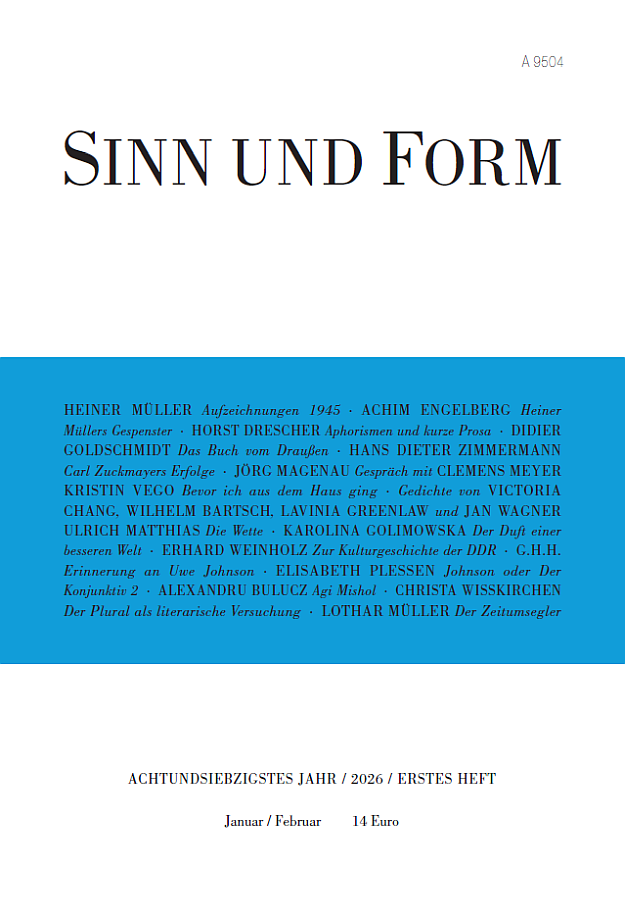
[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-87-4
Kostenlose Lieferung:
innerhalb Deutschlands ab 20 €,
ins Ausland ab 30 € Bestellwert.
[€ 14,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten- Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Heft 1/2026 enthält:
Müller, Heiner
»Ein Dramatiker darf keine Ansichten haben«. Aufzeichnungen 1945. Mit einer Vorbemerkung von Renate Ziemer, S. 5
Vorbemerkung
Schon als Kind entdeckte Heiner Müller das Lesen, denn sein Vater hatte eine umfangreiche Bibliothek. Weil der den Sohn für (...)
Engelberg, Achim
Heiner Müllers Gespenster, S. 14
Chang, Victoria
Obit. Gedichte, S. 26
Drescher, Horst
»Das fürchte ich von ganzem Herzen«. Aphorismen und kurze Prosa. Mit einer Vorbemerkung von Carsten Wurm, S. 30
Bartsch, Wilhelm
Hensel und Grätel. Gedichte, S. 42
Goldschmidt, Didier
Das Buch vom Draußen, S. 46
Zimmermann, Hans Dieter
Carl Zuckmayers Erfolge. Hundert Jahre »Der fröhliche Weinberg«, S. 51
Meyer, Clemens
»Die Welt ist ein unruhiger Ort«. Ein Gespräch mit Jörg Magenau über das Mysterium des Erzählens, das Raubtier Mensch und Bahnhöfe als mythologische Räume, S. 61
JÖRG MAGENAU: Ihr Roman »Die Projektoren« ist ein Jahrhundertroman, nicht nur deshalb, weil der historische Bogen von 1930 bis 2016 reicht. Er (...)
Greenlaw, Lavinia
Außerhalb des Werks. Gedicht, S. 73
Vego, Kristin
Das habe ich geschrieben, bevor ich aus dem Haus ging. Wer ist der Ich-Erzähler eines Romans?, S. 76
Ich wurde gebeten, eine kleine Poetikvorlesung zu halten: Ob ich über meine Methode sprechen könne, warum ich beim Schreiben tue, was ich tue. Ich (...)
Matthias, Ulrich
Die Wette, S. 85
Wagner, Jan
Pelze und Felle. Gedichte, S. 98
Golimowska, Karolina
Der Duft einer besseren Welt, S. 103
Weinholz, Erhard
Das schräge Dreieck oder Können wir noch einmal über die DDR-Kultur reden? , S. 109
G. H. H.
Erinnerung an Uwe Johnson, S. 121
Plessen, Elisabeth
Uwe Johnson oder Der Konjunktiv 2, S. 124
Bulucz, Alexandru
Das Hebräische als Zuhause und Versteck. Laudatio auf Agi Mishol, S. 128
Wisskirchen, Christa
Poetische Randnotizen, S. 132
Müller, Lothar
Der Zeitumsegler. Laudatio auf Wilhelm Bartsch, S. 135
Printausgabe bestellen
