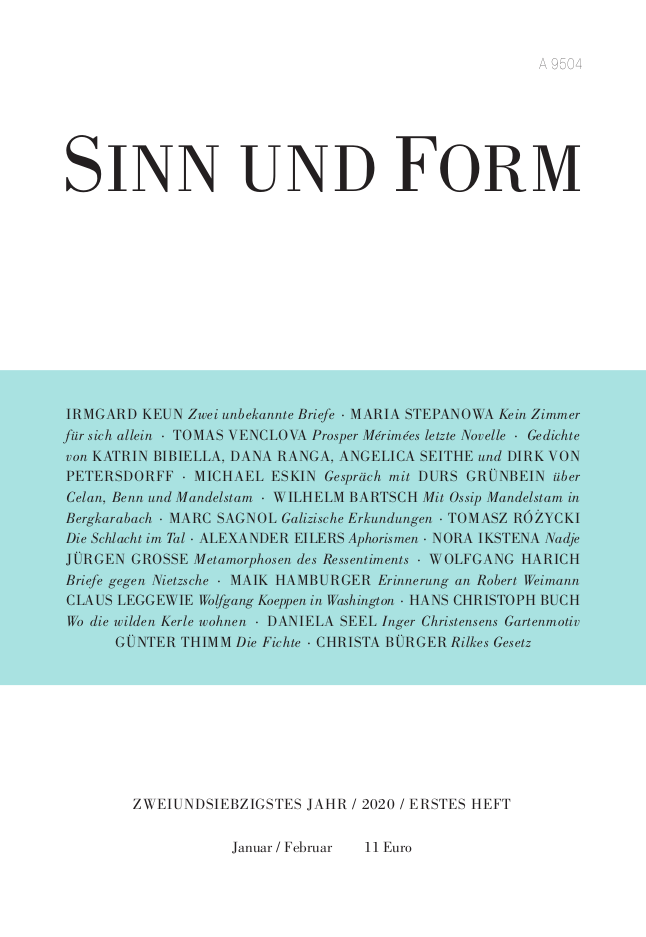
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-51-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2020
Leggewie, Claus
Auf den Spuren Wolfgang Koeppens in Washington
»Die Kasernen der geimpften Kreuzritter auf Europas Boden, der erneuerte Limes am Rhein, Raketenrampen im schwarzen Revier, Versorgungsbasen bei der hohen Schule von Salamanca, Bulldozer, Planierungsmaschinen, Höhlenbohrer, Verstecke für die Angst, Unterstände für die Torheit, die alten Weinberge den Göttern und den Heiligen und dem Umsatz geweiht, das deutsche Vorfeld, die germanische Mitte, des Erdteils gebrochenes Herz, Maginots wiedererstandene Illusionen, die Kolonien der Feldoffiziere und Sergeanten mit dem Indianergesicht, Nachbarschaft und Isolierung, die Main Street mitgebracht …«
Was für ein Eröffnungssatz! Der sich dann im gleichbleibenden Stakkato über zwei weitere Seiten erstreckt und, noch ganz unter dem Eindruck eines amerikanisch besetzten und beglückten Landes, den Bericht von einer Reise durch das Land der »Weltherrschaftsaspiranten« und des »guten Gelds des Marshallplans« einleitet. Liest man Wolfgang Koeppens »Amerikafahrt« von 1959 heute wieder, bekommt man ein Bewußtsein für den Anfang und das Ende des Vorbilds, das »Amerika« nicht nur in unseren Breiten darstellte.
Genau deswegen gestattete ich mir das Vergnügen, das vor sechzig Jahren im Henry Goverts Verlag erschienene Buch zum Cicerone einer neuerlichen Reise durch die Vereinigten Staaten zu machen, wo ich im Unterschied zu Koeppen einige Jahre leben und arbeiten durfte. Manhattan war der Sehnsuchtsort des Schriftstellers, bei dem bis heute vor allem die spätere Schreibhemmung und das nicht erschienene Werk herausgestellt werden – ein Werk, dessen Gesamtausgabe nun freilich nicht weniger als sechzehn Bände umfaßt. Amerika, das Koeppen dreimal besuchte, wobei er vor allem New York mit Reiseberichten bedachte, war nicht sein einziges Ziel, zuvor hatte er von Spanien, Frankreich und Rußland erzählt, und diese literarischen Reportagen wurden zu seiner Haupteinnahmequelle. Der Schriftstellerfreund Alfred Andersch leitete damals das Abendstudio des Süddeutschen Rundfunks, der die Reise mit Unterstützung durch das State Department finanzierte.
Und dem Autor alle Freiheiten ließ. Im Fall Koeppens war das die eingangs zitierte assoziative Parataxe und Montage, deren Eigentümlichkeit einen Rezensenten wie den Schriftsteller Helmut Heißenbüttel zu dem Urteil brachte, man wolle sie wohl lieber hören als lesen. Amerika war für Koeppen ein Experimentierfeld der literarischen Moderne, deren Koryphäen er in seinen frühen BRD-Romanen meisterhaft imitiert hatte, bis hin zu dem von Gertrude Stein entlehnten Titel »Tauben im Gras«. So kam Amerika »schon zu Koeppen, bevor er nach Amerika gehen konnte«, schreibt Michael Kimmage, der Übersetzer der erst 2012 erschienenen Übertragung ins amerikanische Englisch. Koeppens eigentlicher Guide war allerdings Karl Roßmann aus Kafkas Roman »Amerika«.
Der 1906 in Greifswald geborene Romancier war kein Bewunderer der Vereinigten Staaten. Er steckte tief im Erfahrungsraum zweier Weltkriegskatastrophen und im Erwartungshorizont einer atomaren Konfrontation zwischen den Supermächten, die er gleich zu Beginn aufruft. Koeppen schaut weder auf die USA herab, wie viele seiner Generation, noch bewundert er sie, wie viele meiner und späterer Generationen. »Hier war ich Europäer, und ich wollte es bleiben.« Stereotypen und Platitüden finden sich selten beziehungsweise genau da, wo sie hingehören, wo das Land seinen Besuchern nämlich aus Film & Fernsehen ohnehin stets bekannt vorkommt. (Ein europäischer Schriftsteller bekundete mir während seines USA-Stipendiums in den neunziger Jahren seine Langweile: »Das kenn ich eh schon alles.«)
Koeppen war im April 1958 per Schiff angereist und in New York an Land gegangen. Von dort reiste er mit dem Zug nach Washington D. C. und New Orleans, mit dem Greyhound-Bus weiter durch Texas und Arizona, mit der Santa-Fe-Bahn nach Los Angeles, von dort nach San Francisco und über Salt Lake City nach Chicago und Boston. Von New York trat er im Juni den Rückflug nach Europa an. Gute zwei Monate sind länger als das berüchtigte »Europe in ten days«, das dollarschwere US-Bürger damals absolvierten, aber doch sehr knapp bemessen für etwas, das mehr als eine Tour d’horizon sein sollte. Die freilich lieferte Koeppen als luzider Beobachter, ob und gegebenenfalls mit wem er sich unterhalten hat, notiert er kaum. Mal war er amüsiert über Kindsköpfiges, mal schockiert über die strikte, kaum durchbrochene Rassentrennung, gelegentlich animiert durch Striptease und Sex und stets voller Bewunderung für US-Autoren. Die Diagnose des Soziologen David Riesman, Amerika bilde eine »einsame Masse« und kenne das aus Europa bekannte Kollektivhandeln nicht, formulierte Koeppen so: »Kein Land der Masse, ein Land der Einsamkeit.« Und einsam wollte er ja auch auf Reisen sein, sich wenigstens so stilisieren zwischen Katastrophenfurcht und Selbstentfremdungslust.
Koeppen tat gut daran, ganz Amerika zu durchreisen und es nicht bei Manhattan oder Berkeley zu belassen. Damals regierte Dwight D. Eisenhower im Weißen Haus, jener General, der die Deutschen erst besiegt und dann in die westliche Allianz aufgenommen hatte, um den Preis dauerhafter Teilung und periodischer Berlin-Krisen. Koeppen schrieb vor der Konsolidierung dieser Asymmetrie zur (niemals harmonischen) »Deutsch-Amerikanischen Freundschaft« und der Routine transatlantischer Lobby Groups. Washington erlebte er noch als hitzeschwüle, fast idyllische SüdstaatenCity, deren Hotels er sich dennoch nicht leisten konnte. Der Aufstieg von Senator John F. Kennedy aus Massachusetts stand noch bevor, ebenso das Free Speech Movement an der Universität von Berkeley, der er einen Besuch abstattete. Mit Jack Kerouac wußte er etwas anzufangen, aber nicht mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg, die bei Teilen meiner Generation eine Haßliebe zu den USA erzeugten.
Ganz anders ist heute das Verhältnis zur rivalisierenden Großmacht: Mittlerweile ist eher von einer »collusion«, einer unappetitlichen Verquickung von Geschäftsinteressen des amtierenden Präsidenten Donald Trump mit Putins Oligarchen und versuchter Wahlmanipulation aus Moskau die Rede. Zur Zeit darf man aus europäischer Sicht beide Ex-Schutzmächte als trollartige Akteure wahrnehmen, die der EU schweren Schaden zufügen. Eine kämpferische Restrivalität zeigt sich nur, wenn der Straßenabschnitt vor der russischen Botschaft in Washington »Boris Nemtzov Plaza« getauft wird, in Erinnerung an den vor dem Kreml heimtückisch ermordeten Oppositionellen. Und der amerikanische Freiheitsdrang ist noch vital im (gescheiterten) Bemühen, die New Hampshire Avenue vor der saudischen Botschaft »Jamal Khashoggi Way« zu nennen, um das Bekenntnis der USA zur Pressefreiheit zu unterstreichen.
Von Koeppen ließ ich mich zu einer Konferenz in die Georgetown University begleiten, die »alte Jesuitenuniversität«, deren Umgebung vom »Negerslum« zum Viertel der »Diplomaten, Staatssekretäre, Stars des Journalismus« avanciert war (die mittlerweile auch weitergezogen sind). Schülerinnen und Schüler, so war ihm aufgefallen, standen »in nach Rassen getrennten Gruppen beisammen, doch ein blonder Junge interessierte sich lebhaft für eine dunkle Schönheit; ich verstand seine Begeisterung, ich fühlte mit ihm, und ich fragte Amerikaner, wie in diesem Fall die Aussichten der Liebe seien, der Liebe auf dem Schulweg, und die Amerikaner wußten es nicht zu sagen …« Diese Passage wäre heute nicht nur politisch inkorrekt, weil über racial relations (die noch so heißen dürfen) in dieser Weise nachgedacht wird (und Koeppen ungeniert das N-Wort benutzt). Aber auch die »Rassenbeziehungen« haben sich gewandelt. Als ich den GeorgetownCampus überquerte, riefen gemischte Gruppen die Kommilitonen auf, sich an einer Wiedergutmachungsaktion für die Nachfahren jener 272 Sklaven zu beteiligen, die 1838 verkauft worden waren, um die bankrotte Uni zu retten. Offenbar ist deren Genealogie noch nachvollziehbar, und so sollen Nachgeborene aller Hautfarben ihnen einen Obolus leisten. Das nicht bindende Referendum fand eine überwältigende Zustimmung. Reparationszahlungen für die Leiden und Langfristfolgen der Sklaverei sind ein häufiges, auch von den meisten demokratischen Präsidentschaftsbewerbern aufgegriffenes Thema – das die Nation immer noch spaltet.
Viel hat sich seit 1959 verändert, manches blieb. Die Mehrheit der Washingtonians ist immer noch schwarz, aber es ist eine potente schwarze Mittelschicht entstanden – und Barack Obama hat zwei Amtszeiten regiert. Dennoch ist die Neigung der Weißen, bestimmte Viertel zu besuchen, weiterhin begrenzt. Ich erinnere mich an meinen ersten Aufenthalt in D. C., als mich ein Polizeifahrzeug flankierte und die Cops mich besorgt fragten, ob ich hier wirklich weiter spazierengehen wolle. (Sie fuhren weiter, so daß mir gar nichts anderes übrigblieb, den Spaziergang habe ich unbeschadet überstanden.) Ein paar Jahre später wollten wir zur informellen Amtseinführung Bill Clintons, der sie aus Dankbarkeit für die Stimmen der Afroamerikaner an die berüchtigte Ecke von Georgia und Florida Street verlegt hatte – der indische Taxifahrer fuhr erst los, als wir ihm nachdrücklich versichern konnten, der Präsident höchstpersönlich werde dort sein. Mittlerweile hat die Gentrifizierung auch die Schwarzen Viertel östlich der 16th Street ergriffen. Die Gegend um Howard University wird von wohlhabenden Schwarzen bewohnt und hat das hippste Nachtleben, aber die ärmeren sind in andere Viertel abgedrängt worden. Weiterhin gibt es gute Gründe für die Proteste von »Black Lives Matter«, aber endlich findet man auf Washingtons Museumsmeile auch ein Museum für afroamerikanische Geschichte und Kultur.
Koeppen interessierte sich nicht sonderlich für amerikanische Innenpolitik. Er mokierte sich über die Washingtoner Wichtigtuer, ging aber fast ehrfürchtig ins Capitol, den Sitz des Kongresses, und wohnte einer Debatte zum Arbeitsrecht bei. Aus der Perspektive des Bonner »Treibhauses« war das die hohe Schule der Politik. Ins Capitol kann man, nach eher schlampiger Leibesvisitation, immer noch hinein, um Ausschußsitzungen zu lauschen, aber der Kongreß achtet nicht länger auf parlamentarische Regeln und menschlichen Anstand, sucht längst nicht mehr parteiübergreifend den Kompromiß. Die Südstaaten-Demokraten waren damals rechts von der »Grand Old Party« angesiedelt, seit Jahrzehnten hat sich das Koordinatensystem gedreht und die Republikaner haben die niedrigsten Instinkte der Politik freigesetzt. Wie Trump eine über Jahrzehnte gewachsene Gewaltenteilung demontiert und die Demokratie aufs Spiel setzt, ist wohl die größte Veränderung (und Enttäuschung) seit 1959.
Auf Koeppens Spuren wollte ich noch in die Library of Congress, doch ein privates Event sperrte die Wißbegierigen aus dem »Hohen Tempel des Alphabetentums« aus. Kein Betteln und Flehen verschaffte ihnen Zugang in die »ideale Bücherei«, wo mittlerweile elektronisch ausgeliehen wird und die Lesesäle vom Klappern der Laptops erfüllt sind. Auch das White House, das Koeppen mit »Schulen, Schulen, Schulen« besuchte, war weiträumig abgesperrt: Staatsbesuch des ägyptischen Militärdiktators Abdel Fattah El-Sisi, den Trump später ungebührlich rühmte, genau wie Bolsonaro, Duterte und andere Autokraten. Der Washington Post war dann zu entnehmen, daß der Präsident die Chefin der »Homeland Security«, die ohnehin schon schärfste Kontrollen der Grenzen und die Vertreibung von Illegalen vorantrieb, an die Luft setzte. Die Abschottung gegen Immigration, obgleich keine Neuigkeit in der US-Geschichte, hat sich seit den fünfziger Jahren gravierend verstärkt.
Die Grand Tour des 20. Jahrhunderts führte nach Amerika. Gilbert K. Chesterton hat einmal gewitzelt, von jedem, der über den großen Teich fahre, werde ein Buch erwartet. Und so war es auch in Deutschland – jedes Jahr erschien mindestens ein »großes Amerika-Buch«, das Bewunderung, Abneigung oder Grundaussage meist schon im Titel verriet. Koeppens Radioreportage hieß »Die Früchte Europas. Amerika westwärts – Amerika ostwärts«. Diese eurozentrische Sicht, wonach die Alte Welt von Amerika etwas zu lernen, sich vor ihm zu fürchten oder es zu übertrumpfen habe, haben kommentierte Editionen auch bei Koeppen diagnostiziert. Zu seiner Zeit ging die kulturelle Amerikanisierung erst richtig in die Breite. Immer noch wird »amerikanische Kultur«, neuerdings in Form von Serien, Streaming-Angeboten und Plattformen aus dem Silicon Valley, reichlich rezipiert, Anlässe für große Reiseberichte sehen aber eigentlich nur noch heimkehrende TV-Korrespondenten, die persönlich Bilanz ziehen wollen. Das transatlantische Politikgeschäft ist zur Selbstbeschäftigung verkommen, für Work & Travel nach dem Abi sind eher Australien oder Bali angesagt, das wechselseitige Desinteresse wächst rapide. Der Kontrast zwischen der weißen Suprematie im Süden und der gelebten Multikulturalität an der Westküste sollte, wie Koeppen damals meinte, aufgehoben werden im Kosmopolitismus der Vereinten Nationen, deren Gebäude am East River er vor dem Abflug seine Reverenz erwies. Das war, dreizehn Jahre nach Kriegsende, sicher auch als Aufforderung an die Deutschen zu verstehen. Und das ist sie heute für die ganze »westliche Welt«, die sich damals zur Lebensform entwickelte und gerade zum Auslaufmodell wird.
SINN UND FORM 1/2020, S. 123-127
